(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=09.10.2023a Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 12.10.23
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Definitionslehre, Definition und definieren bei Wundt_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Abteilung Wissenschaftstheorie in der Psychologie, Bereich Beweistheorie, und hier speziell zum Thema:
Definitions-Register-Psychologie
und Psychowissenschaften
Definitionslehren, Definition
und definieren bei Wilhelm Wundt (1832-1920)
Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen
Inhaltsverzeichnis:
- Editorial.
Zusammenfassung-Wundt-Def.
Zusammenfassung-Wundt-1907-Def.
Fundstellen Doku:
Vollständiges Definitionskapitel Logik 1907, S. 40-47.
Grundzüge der Physiologischen Psychologie, Dritter Band, 5. A.
Lindau, Hans (1902) NAMENVERZEICHNISS UND SACHREGISTER ZU WUNDT'S LOGIK ZWEITE AUFLAGE.
Checkliste definieren.
Checkliste Beweis und beweisen.
Anmerkung: Wundts Chauvinismus und sein Schweigen zu den Hereros.
Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen
Editorial
Auf dieser Seite geht es darum, welches Verständnis die Psychowissenschaften, in erster Linie die Psychologie, von Definition und definieren haben, was gelehrt wird, wie definieren, in der Psychologie geht oder gehen soll. Dass hier vieles im Argen liegt, ist mir bei meinen Analysen zu Beweis und beweisen in der Psychologie aufgefallen. Den Anstoss gab meine letzte Analyse zu Definition und definieren bei Kurt Lewin, wobei sich mir am 6.10.2023 der Verdacht bzw. meine Hypothese erhärtete, dass die Definitions-Inkompetenz in der Psychologie ein Grundübel ihrer mangelhaften Wissenschaftlichkeit ist.
Das elementare formale und allgemeine Gerüst für einen Begriff, Kernelement einer Definition, besteht aus Name, Inhalt, Referenz, wobei die Referenz angibt, wo und wie man den den Definitionsinhalt in der Welt und bei den Menschen finden kann. Das wird in der Psychologie so gut wie nie erörtert und ausgeführt und steht bis heute in kaum einen Lehrbuch (teilweise Westermann). Und genau das ist wahrscheinlich der Kern des Problems: Referenzieren ist schwer, meinen und oberflächeln hingegen leicht. Die besonderen Definitions- und Referenzierungsprobleme der Psychologie liegen im Erleben- besonders dem direkt nicht zugänglichen fremden Erleben. Hier gibt es noch sehr viel zu tun. Ich hoffe, auch diese Seite trägt zur Klärung und Entwicklung bei.
Für die Geschichte und Entwicklung der Psychologie ist natürlich Wilhelm Wundt als einer der großen Pioniere der wissenschaftlichen Psychologie ganz besonders zu berücksichtigen, zumal er in seiner Logik einen ganzen Abschnitt der Definitionslehre widmet.
Zusammenfassung-Wundt-Def > Zusammenfassung W1907-Def.
Begriff wird 1903 und vor allem 1907 nicht klar in Name, Inhalt, Referenz gefasst; und die Referenz fehlt auch in der Definition. Zusätzlich fehlt die besondere Anwendungs- und Problemsituation in der Psychologie. In seiner Logik 1907, S. 41f führt Wundt aus:
- "In diesem Sinne bilden Definitionen die Grundlage einer jeden systematischen
Wissenschaft. Es ist aber dazu keineswegs erforderlich, daß sie,
wie in dem Euklidischen System, der Entwicklung der Deduktionen und sonstigen
Untersuchungen vorangestellt werden, sondern es genügt vollkommen,
wenn eine jede an dem Orte vorkommt, wo sie zum ersten [>42] Male gebraucht
wird."
Physiologische Psychologie Bd. 1 1908, 6.A.
Sachregister
Gefühl, als subjektives Elementdes Seelenlebens 44. Begriffsbestimmung
des G. als psychischen Elements409. Unterschied von
der Empfindung411. Charakteristische Eigenschaften 412. Geschichte
des Wortes u. Begriffs G. 413ff. Gefühlssinn 410, 414.
Gefühlsvermögen bei Tetens 414. Intellektuelles G. 47. G.-Leben,
individuelles, Schwierigkeit seiner Analyse 32. Gefühlston 418.
Physiologische Psychologie Bd. 2 1910, 6.A.
Sachregister
"Gefühle, Grundformen der G. 295 ff. Die Grundformen der G. als
dreidimensionale Mannigfaltigkeit 298, Fig. 230. Verwandtschaft
der Grundformen der G. 310. Frage nach der Ein- oder Mehrdimensionalität
der G. 380 Einfache G., Begriff 316. Eigenschaften
der einfachen G. 320 ff. Qualitative Unterschiede der einfachen G.
329 ff. Verlauf der einfachen G. 342 ff. Kontrastprinzip
der G. 347ff-, bei der Verbindung der einfachen G. zu Affekten 350.
Angebliche Unvorstellbarkeit der G. 382. Verbindungen der einfachen G.
353 ff Assoziationen der einfachen G. 359 ff Psychologische Bedeutung der
G. 363 ff. Intellektualistische Interpretationen 364. Die G. als Reaktion
der Apperzeption auf den einzelnen Bewußtseinsinhalt 367. Psychophysische
Substrate der G. 370 ff- Geschichte der Gefühlstheorien 372 ff. Gefühlsanalyse,
Methoden der G. 274 fr. Gefühlsdauer, Einfluß auf die Ausdruckssymptome
316. Gefühlselemente 294 f. Verbindung der G. 351 ff-Gefühlsempfmdungen
(nach Stumpf) 379-Gefühlskompensation 311.
Gefühlskomponenten 317. Gefühlskontinuum 317. Gefühlskurve
323, 327. Gefühlsqualität 317. Analogie zu den Empfindungsqualitäten
318. Gefühlsresultanten 320, 351. Gefühlssinn bei Joh. Müller
356, 379. Gefühlsstärke 320ff. Unmöglichkeit einer exakten
Messung der G. 326 f. Versuche einer mathematischen Formulierung der
Abhängigkeit der G. vom Empfindungsreiz 328 f. Gefühlssymptome
301 ff. Vgl. Ausdruckserscheinungen. Gefühlstheorien, Geschichte der
G. 363 ff., 372 ff. Gefühlston der Empfindungen 321fr., 342 fr. Der
G. angeblich als dritte Dimension der Empfindung 379 u. Anm. I. Gefühlsverlauf
299, symbolische Darstellung
Fig. 231. Der G. in Abhängigkeit von den Empfindungen 342 ff.
Gefühlsverbindungen 352 f. Gefühlsvermögen 373. Gefühlsverschmelzung
353 f."
Physiologische Psychologie Bd. 3 1911, 6.A.
Sachregister
Gefühle, zusammengesetzte G. 99. Zeitfolge von G. und Vorstellung
105fr., 113. Wirkung der G. bei Reproduktion 108, 489.
Die G. als Reaktion der Apperzeption aufdie einzelnenBewußtseinserlebnisse
11z. Angebliche Dunkelheit der G. 322.
Gefiihlsassoziationen 526. Gefühlsästhetik, metaphysische
G. 182. Gefühlskontrast, beieinfachenRhythmen144. Gefühlskurven
bei
aktiver und passiver Apperzeption 317, Fig. 360. Gefühlslage 107.
Gefühlsresultanten, bei Affekten 199. Gefühlston 102, Verwertung
des G. in den Affekttheorien 213. Gefühlsverbindungen 500. Gefühlsverlauf
bei der Einwirkung regelmäßig sich wiederholender Taktschläge
19, Fig. 33i-. Gefühlsverschmelzung, in den ästhetischen
Elementargefühlen176. GefühlswechselbeizusammengesetztenRhythmen145.
Gefühlswirkungen der Vorstellungen 101.
Wundt, Wilhelm. 1891. Zur Lehre von den Gemüthsbewegungen. Philosophische
Studien 6: 335-393
Kein Inhaltsverzeichnis und Sachregister
Fundstellen "fühl" 181
W1907-Def Wundt, Wilhelm (1907) Logik der exakten Wissenschaften Band 2, 3. A.
G e s p e r r t bei Wundt hier 12p fett Textfundstelle "defin" 14p fett kursiv von mir markiert
Zusammenfassung-Wundt-1907-Def
Im Band 2 der 3. A. von 1907 findet sich 211 Fundstellen "defin". Im
Definitionskapitel S.40-47 finden sich 76.
"Untersuchung und Darstellung greifen in ihrer wissenschaftlichen
Anwendung fortwährend ineinander ein. Keineswegs lassen sie daher
in dem Sinne sich scheiden, daß die erstere völlig abgeschlossen
sein müßte, wenn die zweite beginnen soll. Wohl aber setzt jede
systematische Darstellung voraus, daß eine Reihe von Begriffen durch
vorangegangene Untersuchungen zureichend festgestellt sei, um einerseits
die wünschenswerte Abgrenzung der einzelnen Gebiete zu ermöglichen,
und um anderseits für die Fortführung der Untersuchung die erforderlichen
Grundlagen darzubieten. Diese Aufgabe erfüllt die Definition.
Sie ist die elementarste unter den systematischen Formen, weil Klassifikation
und Beweisführung auf ihr weiterbauen, und sie steht ihrer tatsächlichen
Entstehung nach mitten inne in dem Verlauf der induktiven Forschung. Denn
jedes Resultat der letzteren sucht in einer zureichenden Begriffsbestimmung
seinen Abschluß zu finden, damit dann an diese die Deduktion anknüpfen
könne."
"In diesem Sinne bilden Definitionen
die Grundlage einer jeden systematischen Wissenschaft. Es ist aber dazu
keineswegs erforderlich, daß sie, wie in dem Euklidischen System,
der Entwicklung der Deduktionen und sonstigen Untersuchungen vorangestellt
werden, sondern es genügt vollkommen, wenn eine jede an dem Orte vorkommt,
wo sie zum ersten [>42] Male gebraucht wird. Doch hat dieser Umstand sowie
der andere, daß geläufige Begriffsbestimmungen leicht als selbstverständlich
vorausgesetzt werden können, zuweilen die fundamentale Bedeutung der
Definition
übersehen lassen."
Wundt erörtert typische Hauptformen der Definition:
Nominaldefinition, Realdefinition, Analytische Definition, Synthetische
Definition, Genetische Definition, Deskriptive Definition.
Auf das besondere Problem der Referenzierung geht
Wundt nicht ein. Das Wort "referenz" erzielt in seiner Logik keinen Treffer.
Die Lehre vom Begriff hat kein eigenes Kapitel
Wundt legt in seiner Logik zwar eine Definitionlehre
vor, aber er äußert sich nicht zur speziellen Definitionssituation
in der Psychologie.
Vollständiges Definitionskapitel S. 40-47
"
Zweites Kapitel.
Die Formen der systematischen Darstellung.
1. Die Definition.
Untersuchung und Darstellung greifen in ihrer wissenschaftlichen Anwendung
fortwährend ineinander ein. Keineswegs lassen sie daher in dem Sinne
sich scheiden, daß die erstere völlig abgeschlossen sein müßte,
wenn die zweite beginnen soll. Wohl aber setzt jede systematische Darstellung
voraus, daß eine Reihe von Begriffen durch vorangegangene Untersuchungen
zureichend festgestellt sei, um einerseits die wünschenswerte Abgrenzung
der einzelnen Gebiete zu ermöglichen, und um anderseits für die
Fortführung der Untersuchung die erforderlichen Grundlagen darzubieten.
Diese Aufgabe erfüllt die Definition. Sie ist die elementarste
unter den systematischen Formen, weil Klassifikation und Beweisführung
auf ihr weiterbauen, und sie steht ihrer tatsächlichen Entstehung
nach mitten inne in dem Verlauf der induktiven Forschung. Denn jedes Resultat
der letzteren sucht in einer zureichenden Begriffsbestimmung seinen Abschluß
zu finden, damit dann an diese die Deduktion anknüpfen könne.
[>41]
Dieser Doppelstellung entspricht die Natur der Definition.
Als systematische Form sucht sie einen gegebenen Begriff auf das schärfste
von den verwandten Begriffen zu trennen; als nächstes Ergebnis einer
Untersuchung, welcher die Begrenzung der Begriffe erst zu einem tieferen
Eindringen in den Gegenstand verhelfen soll, kann sie nicht das Wesen dieses
Gegenstandes erschöpfend bestimmen wollen, sondern sie muß sich
mit der Hervorhebung derjenigen Elemente begnügen, welche zur sicheren
Unterscheidung zureichend sind. Die Definition
bildet aber in doppelter Weise die Grundlage für die Weiterführung
der Untersuchung: einmal durch sich selbst, insofern die klare Feststellung
der charakteristischen Elemente eines Begriffs für die Untersuchung
desselben und seines Verhältnisses zu anderen Begriffen ein wesentliches
Erfordernis ist, und sodann durch die nahe Beziehung, in der die Definitionen
zu den Grundsätzen stehen, auf welche die Deduktion die einzelnen
Theoreme zurückzuführen sucht. Diese Beziehung stellt sich wieder
in einer doppelten Form dar. Entweder gestatten, wie in der Mathematik
und in den reinen Begriffswissenschaften, gewisse Fundamentaldefinitionen
eine unmittelbare Transformation in axiomatische Sätze; oder es lassen
sich umgekehrt Erfahrungsgesetze, die durch Induktion gewonnen sind, in
Definitionen
allgemeiner Begriffe umwandeln, wie in den physikalischen Disziplinen.
Der Unterschied beider Formen entspringt daraus, daß in den erstgenannten
Wissenschaften die Feststellung der Begriffe auf einer willkürlichen,
wenn auch durch die Natur der Anschauung nahegelegten Konstruktion beruht,
deren Sinn festgestellt sein muß, ehe man zu Gesetzesformulierungen
übergehen kann, während im zweiten Fall der durch den Zwang der
Wahrnehmung sich aufdrängende Zusammenhang der Erscheinungen zunächst
zur Annahme gesetzmäßiger Beziehungen herausfordert, die dann
erst nachträglich einem allgemeinen Begriff subsumiert werden. Die
systematische Darstellung verwischt schließlich diese Unterschiede
der Entstehungsgeschichte. In ihrem Streben nach zwingender Deduktion sucht
sie alle Theoreme als apodiktische Folgerungen aus einer begrenzten Zahl
ursprünglich gegebener Begriffsbestimmungen darzustellen, wobei dann
die Frage, wie man zu diesen Begriffsbestimmungen gelangt sei, nicht weiter
zur Erörterung zu kommen braucht. In diesem Sinne bilden Definitionen
die Grundlage einer jeden systematischen Wissenschaft. Es ist aber dazu
keineswegs erforderlich, daß sie, wie in dem Euklidischen System,
der Entwicklung der Deduktionen und sonstigen Untersuchungen vorangestellt
werden, sondern es genügt vollkommen, wenn eine jede an dem Orte vorkommt,
wo sie zum ersten [>42] Male gebraucht wird. Doch hat dieser Umstand sowie
der andere, daß geläufige Begriffsbestimmungen leicht als selbstverständlich
vorausgesetzt werden können, zuweilen die fundamentale Bedeutung der
Definition
übersehen lassen.
Da wir uns als Zeichen der Begriffe im allgemeinen
der Worte bedienen, so ist jede Definition
zunächst eine Worterklärung; und da Begriffe immer nur
durch andere Begriffe, also auch Worte nur durch andere Worte erklärt
werden können, so besteht die Definition
regelmäßig darin, daß ein Wort, dessen begrifflicher Sinn
noch nicht festgestellt ist, durch Worte bestimmt wird, deren begriffliche
Bedeutung als bekannt vorausgesetzt werden darf. Dieser regelmäßigen
Aufgabe scheint es zu widerstreiten, wenn man die Worterklärung von
der eigentlichen Definition zu unterscheiden
pflegt, indem man beide als Nominal- und Realdefinition einander
gegenüberstellt. In der Tat ist auch diese Unterscheidung deshalb
bekämpft worden, weil es niemals Definitionen
der Dinge selbst geben könne, sondern immer nur Definitionen
der Wörter, mit denen wir die Dinge bezeichnen. Die Realdefinition
ist daher, wie Mill meint, ebenfalls nur eine Worterklärung; sie unterscheide
sich aber von der bloßen Nominaldefinition
durch den Umstand, daß sie daneben noch die Voraussetzung einschließe,
es gebe ein Ding, das dem Wort entspreche ). Dennoch ist es offenbar nicht
der Gedanke an reale Existenz, der uns hier zunächst beschäftigt.
Vielmehr liegt der eigentliche Unterschied darin, daß wir bei der
bloßen Nominaldefinition völlig
absehen von dem wissenschaftlichen Zusammenhang, in den der betreffende
Begriff durch die Definition gebracht
werden soll, indem wir bei ihr den nämlichen Zweck verfolgen wie bei
der Übersetzung eines Wortes aus einer fremden Sprache: die Nominaldefinition
ersetzt nur das Wort von unbekannter Bedeutung durch synonyme Ausdrücke
und Umschreibungen ohne jede Rücksicht auf die systematische Stellung
der Begriffe. Der Realdefinition ist
es dagegen um die letztere zu tun. An und für sich kann daher ebensogut
die Nominaldefinition eines Pferdes
wie die Realdefinition eines Centauren
gegeben werden, auch wenn man nicht im geringsten daran zweifelt, daß
das Pferd ein wirkliches Tier und der Centaur ein bloßes Geschöpf
der Phantasie sei. Hiernach bedarf es kaum der Bemerkung, daß die
bloße Worterklärung kein Gegenstand logischer Untersuchung ist,
sondern daß diese sich nur mit Realdefinitionen
im obigen Sinne, d. h. mit solchen Definitionen
zu beschäftigen hat, durch welche die [>43] Stellung eines Begriffs
innerhalb eines allgemeineren Zusammenhangs von Begriffen bestimmt wird.
Diese Aufgabe wird nun in der einfachsten Weise
erfüllt, wenn man erstens den zunächst übergeordneten Begriff
angibt, unter den der zu definierende
gehört, und wenn man zweitens das Merkmal oder den Komplex von Merkmalen
bestimmt, wodurch er sich von den ihm koordinierten Begriffen unterscheidet.
Im günstigsten Fall können so zwei Namen, ein Gattungsname
und eine Eigenschaftsbezeichnung, zur Definition
genügen. Diese Regel des genus proximum und der differentia specifica
ist in der systematischen Naturgeschichte für die hauptsächlich
seit Linne üblichen, aber schon vor ihm gebrauchten Doppelbezeichnungen,
wie Felis domestica, Canis familiaris u. dgl., maßgebend geworden.
Die Benennung soll hier eine kurze Definition
ersetzen, die aber freilich infolge der Willkürlichkeit der Genusbenennung
und der oft planlosen Auswahl des spezifischen Unterschieds der eigentlichen
Aufgabe einer Realdefinition wenig entspricht.
Darum pflegt man selbst in der systematischen Naturgeschichte diesen Namen
ausführlichere Definitionen folgen
zu lassen, und in anderen Gebieten, wie bei mathematischen, physikalischen,
juristischen und national-ökonomischen Begriffsbestimmungen, behält
die Regel des genus proximum und der differentia specifica nur noch in
einem allgemeineren Sinne ihre Geltung, insofern nämlich, als bei
jeder systematischen Definition die
zur Verwendung kommenden Begriffe in zwei Gruppen zerfallen, von denen
die eine einen oder mehrere übergeordnete Begriffe enthält, die
als bekannt aus vorangegangenen Definitionen
vorausgesetzt werden, während die andere die besonderen Bestimmungen
hinzufügt, durch welche der betreffende Begriff in eindeutiger Weise
von allen ihm verwandten Begriffen abgegrenzt wird. Damit eine solche eindeutige
Abgrenzung zu stände komme, darf der Definition
selbstverständlich kein für den Begriff wesentliches Element
fehlen; und ebenso fordert der systematische Zweck, daß sie nicht
mit unwesentlichen, etwa schon in anderen Elementen vorausgesetzten Bestimmungen
überlastet werde. Je einfacher und zugleich logisch durchgebildeter
ein Begriffsgebiet ist, umso mehr wird aber eine Definition,
die der Forderung der Eindeutigkeit genügt, doch zugleich eine vollständige
Einsicht in die Konstitution des Begriffs gewähren. In vollkommenster
Weise besitzen diese Eigenschaft die mathematischen Begriffe. Die exakte
Definition
einer geometrischen Kurve enthält ebenso wie die für sie aufzustellende
Gleichung bereits alle ihre Eigenschaften vorgebildet. Der Definition
in Worten kann daher in diesem [>44] Fall der analytische Ausdruck als
eine symbolische Form der Definition
substituiert werden. Am weitesten dagegen entfernen sich von diesem idealen
Ziel die Begriffsbestimmungen konkreter Naturobjekte. Nur in geringem Umfange
sind wir im stande, die charakteristischen Eigenschaften einer Pflanze
oder eines Tieres in einen solchen Zusammenhang zu bringen, daß sich
uns aus bestimmten einzelnen dieser Eigenschaften die anderen mit Notwendigkeit
ergeben. Die Definition muß sich
darum in diesem Falle damit begnügen, diejenigen Merkmale herauszugreifen,
in deren Konstanz eine Bürgschaft ihrer begrifflichen Bedeutung zu
liegen scheint, ohne daß sie aber den Anspruch erheben kann, damit
irgendwie das Wesen des Objekts anzugeben, wie man dies so oft als
die Aufgabe aller Definition angesehen
hat, eine Aufgabe, die selbstverständlich nur erfüllt werden
kann bei Begriffen, deren Bestimmung nach Inhalt wie Umfang schließlich
in unserer eigenen Macht liegt. Neben der Mathematik sind es daher die
systematischen Geisteswissenschaften, wie die Rechts- und Staatslehre,
sowie die verschiedenen Zweige der systematischen Philosophie, in denen
jene ideale logische Aufgabe der Definition
am ehesten annähernd erreichbar ist.
Da jede Definition
zur Feststellung eines Begriffs anderer Begriffe bedarf, so setzt sie diese
als bereits gegeben voraus, sei es, daß sie durch vorangegangene
Definitionen
bestimmt, sei es, daß sie unmittelbar aus der Anschauung bekannt
und daher keiner Definition bedürftig
sind. Sobald eine Definition die gewöhnliche
Gliederung in das genus proximum und die differentia specifica zuläßt,
so ist regelmäßig das erstere der Gegenstand vorangegangener
Definitionen,
während die letztere an die unmittelbare Erfahrung appelliert, die
höchstens eine anschauliche Zerlegung, in keiner Weise aber eine Feststellung
mittels anderer Begriffe gestattet. Die Definition
der übergeordneten Begriffe zerfällt nun selbstverständlich
ihrerseits wieder in ein oberes Genus und eine spezifische Differenz, von
denen jenes abermals eine ähnliche Zerlegung erfährt, bis man
schließlich bei denjenigen Allgemeinbegriffen des betreffenden Gebietes
angelangt ist, die einen weiteren Rückgang nicht mehr gestatten. Indem
dieser Prozeß von den zunächst untersuchten Begriffen alle anschaulichen
Elemente sukzessiv losgelöst hat, bleiben schließlich als nicht
weiter
definierbare oberste Gattungen
solche Begriffe übrig, die völlig abstrakter Art sind, d. h.
unmittelbar gar keine anschaulichen Elemente mehr enthalten, wie die Begriffe
Ding, Substanz, Größe, Zahl u. dgl. Auf diese Weise führt
die Analyse der Definitionen auf zweiundefinierbare
Bestandteile von völlig verschiedenem Charakter: erstens auf die Elemente
der unmittelbaren [>45] Erfahrung oder die Inhalte des Bewußtseins,
die wahrgenommen werden müssen und eben darum nicht definiert
werden können, und zweitens auf die allgemeinsten Abstraktionen, die,
insofern ihnen jeder anschauliche Inhalt abhanden gekommen ist, eine bloß
formale
Bedeutung besitzen, da in ihnen lediglich die intellektuellen Funktionen
zum Ausdruck kommen, deren wir uns bei der Ordnung des empirischen Stoffes
bedienen. Diese Funktionen sind wiederum einer eigentlichen Definition
nicht zugänglich, sondern es können bei ihnen höchstens
die Bewußtseinsakte beschrieben werden, die bei der Erzeugung der
Begriffe wirksam sind. So führen wir z. B. den Begriff des Dings auf
die selbständige Apperzeption des einzelnen Wahrnehmungsinhalts, den
Begriff der Zahl auf die Verbindung einer Reihe von Apperzeptionsakten
zurück u. s. w. (Bd. I, Abschnitt III, Kap. II ff.)
Indem die Definition
einen gegebenen Begriff stets durch eine Mehrheit anderer Begriffe
erklärt, kann sie nun entweder auf einer Zerlegung in diese
oder aber auf ihrer Verbindung zu einem neuen Begriffe beruhen.
Die Definition stützt sich daher
auf die elementareren Methoden der Analyse und Synthese, und sie läßt
hiernach zwei Hauptformen zu: die analytische
und die synthetische Definition.
Die analytische Definition
ist die nächstliegende und darum häufigste Form. Fast unerläßlich
bei der Begriffsbestimmung von Erfahrungsobjekten bietet sie sich auch
auf abstrakten Gebieten immer zunächst dar, weil sie von dem gegebenen
Begriff, der definiert werden soll,
ausgeht. Die einfachste Art analytischer Definition
besteht aber in der Hervorhebung der unterscheidenden Merkmale, welche
die Beschreibung des Gegenstandes an ihm kennen lehrt. Diese deskriptive
Definition ist selbst nichts anderes als eine abgekürzte, auf
die charakteristischen Eigenschaften eingeschränkte Beschreibung.
Wie die Beschreibung überhaupt, so hat sie den Nachteil, daß
sie die Begriffselemente nur äußerlich aneinander reiht, ihre
innere Beziehung aber nicht kennen lehrt. So in den bekannten Definitionen
der Naturgeschichte, aber auch bei mathematischen Begriffsgebilden, wo
jedoch die exakte Bestimmung der Begriffselemente leicht jene Beziehung
ergänzen läßt. Wenn wir z. B. den Kreis als diejenige in
einer Ebene gelegene Linie definieren,
deren Punkte sämtlich gleich weit von einem festen Punkte der nämlichen
Ebene entfernt sind, so ist diese Begriffsbestimmung an sich rein deskriptiv;
trotzdem schließt sie infolge der scharfen Fassung des Begriffs der
Äquidistanz alle wesentlichen Eigen[>46]schaften des Kreises in sich.
Immerhin müssen wir auch hier die deskriptive
Definition verlassen, wenn die wechselseitige Beziehung
der Begriffselemente angegeben werden soll. Dies geschieht in der analytischen
Definition im engeren Sinne, die symbolisch immer in der Form einer
Funktionsgleichung
M = (F a, b) . . . u, v . . .)
ausgedrückt werden kann, wo M den zu definierenden
Begriff, die konstanten, u, v ... die variablen Elemente, in die er zerlegt
wird, und endlich das Zeichen F die Funktionsbeziehung bezeichnet, die
zwischen allen diesen Elementen stattfindet. In diesem Sinne ist die Gleichung
des Kreises zugleich die analytische Definition
desselben. Sie enthält alle Elemente der deskriptiven
Definition und außer ihnen mit Hilfe der Operationssymbole
den exakten Ausdruck ihrer wechselseitigen Relationen. Neben der Mathematik
sind es wieder die einer strengeren logischen Kultur zugänglichen
Geisteswissenschaften, wie die Erkenntnislehre, die Rechtswissenschaft
und zum Teil die Nationalökonomie, in denen analytische
Definitionen erstrebt werden können. Da uns aber hier
ein dem algebraischen ähnliches Zeichensystem mangelt, so müssen
die Beziehungen der Begriffselemente mit den gewöhnlichen Hilfsmitteln
der Sprache ausgedrückt werden, ein Umstand, der infolge der ungenügenden
Präzision dieser Hilfsmittel nicht selten die Definition
ganz oder teilweise auf die deskriptive Stufe zurücksinken läßt.
Den entgegengesetzten Weg schlägt die synthetische
Definition
ein. Sie gibt an, wie sich der Begriff aus seinen charakteristischen Elementen
zusammensetzt. Hierbei erscheinen dann meistens diese Elemente zugleich
als die Bedingungen seiner Entstehung, und die synthetische nimmt so die
geläufige Form der genetischen Definition an. Wenn man mit
geringer Abänderung der oben gegebenen Beschreibung den Kreis durch
die Bewegung eines Punktes in der Ebene entstehen läßt, der
von einem festen Punkt der nämlichen Ebene immer gleich weit entfernt
bleibt, wenn man ferner die verschiedenen Kurven zweiten Grades aus bestimmten
Modifikationen dieses Bewegungsgesetzes ableitet oder noch einfacher als
Schnitte eines geraden Kegels durch eine Ebene von wechselnder Lage auffaßt,
so gewinnt man abermals genetische Definitionen,
wobei übrigens, wie das letzte Beispiel zeigt, im allgemeinen für
ein und dasselbe Raumgebilde verschiedene Entstehungsweisen und darum verschiedene
genetische Erklärungen möglich sind. Doch ist dies nur der Fall,
wo die Definition, wie in der Mathematik,
Ausdruck einer willkürlichen [>47] Konstruktion ist. Bei Erfahrungsobjekten
kann die genetische Definition immer
nur in dem Versuch einer Nacherzeugung der wirklichen Entstehung des Gegenstandes
bestehen, und da diese in der Regel nur eine einzige ist, so ist hier im
allgemeinen nur eine Form derselben möglich. Bloß wo
es sich um eine genetische Definition
solcher Objekte handelt, die unserer unmittelbaren Erfahrung entrückt
sind, wie der Sprache, der ursprünglichen Rechts- und Staatsformen,
der mythologischen Vorstellungen, da haben wohl auch verschiedene genetische
Begriffsbestimmungen nebeneinander Raum, die nun aber freilich nicht, wie
in der Mathematik, ein gleiches Recht für sich in Anspruch nehmen,
sondern als Ausdrucksformen verschiedener hypothetischer Anschauungen einander
bekämpfen. Nicht selten geschieht es ferner, daß nur einzelne
Seiten eines Begriffs eine genetische Definition
zulassen, während andere, die zur Unterscheidung von verwandten Begriffen
immerhin der Hervorhebung bedürfen, bloß einer Beschreibung
zugänglich sind. Es entstehen dann gemischte, genetisch-deskriptive
Definitionen. Die Andeutung eines derartigen Verhaltens
findet sich in den Artbenennungen der Naturgeschichte, wo die eine Hälfte
der Doppelbezeichnung, das genus proximum, auf die Abstammung der Art hinweist,
während die differentia specifica, die Aufzählung der charakteristischen
Artmerkmale, einer bloß deskriptiven Aneinanderreihung überlassen
bleibt.
Die angegebenen Unterschiede der Definition
stehen
in nahem Zusammenhänge mit den Eigenschaften derjenigen systematischen
Form, die sich auf die Definition stützt,
indem sie die fundamentalen Definitionen
eines Wissensgebietes zu dessen geordneter Gliederung verwertet. Diese
Form ist die Klassifikation.
Es folgt der Abschnitt 2. Die Klassifikation.
W1903-Def Wundt, Wilhelm (1903) Grundzüge der Physiologischen Psychologie, Dritter Band, 5. A. Leipzig: Engelmann.
defin 52
Inhaltsverzeichnis 0 (aber es finden sich mehrere Einträge zu
"begriff")
- Fundstellen "defin"
im Kurzkontext
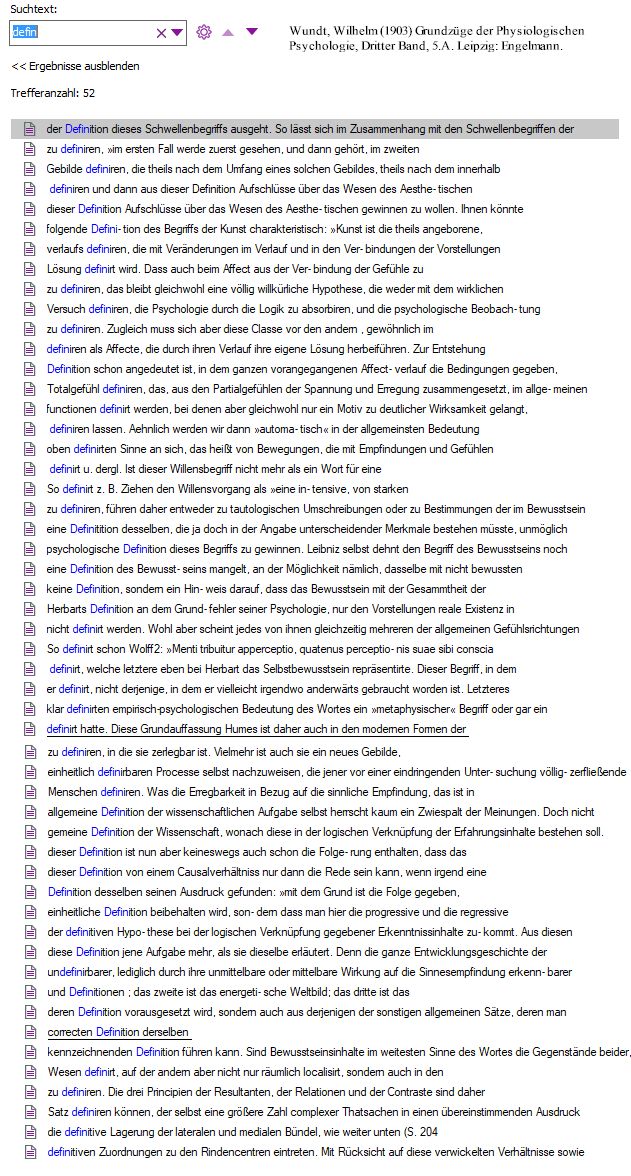
L1902 Lindau, Hans (1902) NAMENVERZEICHNISS UND SACHREGISTER ZU WUNDT'S LOGIK ZWEITE AUFLAGE. Stuttgart: Enke.
Sachregister Logik 2. A., S. 23:
Definition I, 77. 189 f. 195. 205 f. 229.
- 329. 504; II, 2. 84 f. 39 f. 67 f. 70.
105. 107 f. 130 f. 168. 181. 380. 388;
III, 192 f. 499 f. 509 f. 517 f. 522 A.
531. 561. 580 f. 636; Definitions-
gleichung II, 328; III, 194; D. und
Axiom I, 575 f. 580 A.; II , 118 f.;
analytische D. II, 44 f.; synthetische
D. II, 45 f.; genetische D. II, 178;
III, 519.
Sachregister Logik 2. A., S. 16f:
Begriffe III, 221. 518; B. bei Aristoteles
- II, 276; Begriffsformen bei Kant III,
638 f.; wissenschaftliche B. I, 95;
Rechtsbegriffe 111,478; Begriffsbildung
I, 33.35.43 f. 328. 391 ; III, 580; Defini-
tion des Begriffs I, 51. 502; Merkmale
der B. I, 94 f.; Begriff und Gattungs-
vorstellung I, 101; Gattungsbegriffe
I, 106 f. 493.502; II, 25 f.; Allgemein-
u. Einzelbegriffe I, 105 f. ; Beziehungs-
begriffe I, 108; Beziehungsformen der
B. I, 144 f.; abstracte und concrete
B. I, 111 f.; Inhalt und Umfang I,
110 f.; Begriffsvergleichung I, 127 f.;
naturgemässer und künstlicher Be-
griffewandel I, 133; Verhältnisse der
B. I, 127 f.; III, 522 A.; Arten der
B. I, 118 f.; Begriffsoperationen I,
251 f.; Begriffszerlegung u. -bestim-
mung I, 75 f.; Begriffsanalyse als
Hülfsverfahren der synthetischen De-
duktion II, 35; B. a. H. d. analyti-
schen Deduktion II, 36 f. 383; Trans-
formation von Begriffen II, 37 f.;
Begriff und Urtheil I, 55 f. 93; B.
und Gedankenverlauf I, 73 f.; B. und
Sprache I, 74; B. und Anschauung
II, 514 A.; B. und Gedanke I, 158;
Begriffs- und Lautgeschichte III, 72;
allgemeine Begriffsaxiome I, 331; [>17]
Begriffs- und Anschauungs- gegen-
über den Erfahrungswissenschaften II,
33. 36. 40. 49.
Checkliste definieren
Checkliste-Beweisen
Methodik-Beweissuche in der Psychologie
Viele positive oder bejahende Feststellungen oder Aussagen haben kein Suchtextkriterium, so dass Fundstellen nur durch lesen, Zeile für Zeile, erfassbar sind. Negative Feststellungen oder Aussagen sind hingegen oft durch ein "nicht" zu finden.
Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen [Stand 27.03.2023, 18:21 Uhr]
Beweissuchwortkürzel.
Hauptunterscheidungskriterien mit Kürzeln (In Entwicklung und Erprobung) siehe bitte Beweissignierungssystem.
Literatur (Auswahl)
Links (Auswahl)
_
ChatGPT:
- https://chat.openai.com/
- https://chatgpt.ch/
- https://talkai.info/de/chat/
_
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
Standort: Definitionslehre, Definition und definieren bei Wundt.
*
Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen.: Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * Checkliste-Beweisen * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * »«
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Definitionslehre, Definition und definieren bei Wundt. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/DefRegister/Wundt.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: 11.10.2023 irs Rechtschreibprüfung und überflogen
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
12.10.2023 Editorial aktualisiert.
11.10.2023 irs Rechtschreibprüfng und überflogen
06.10.2023 angelegt.