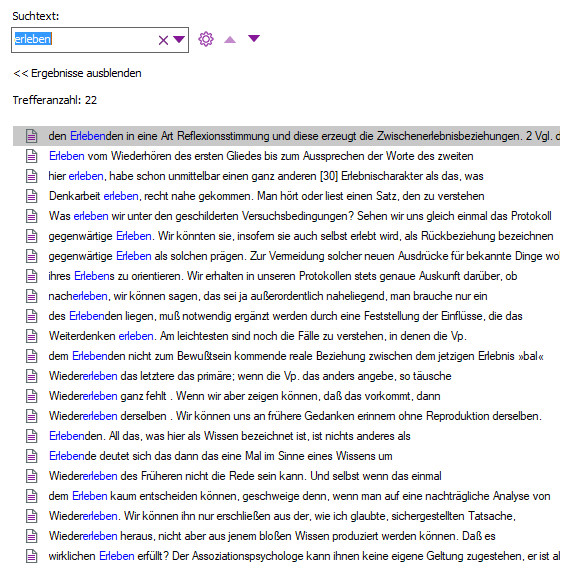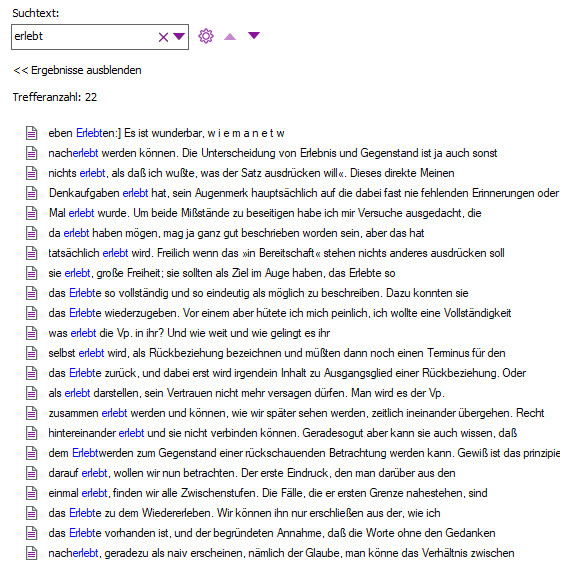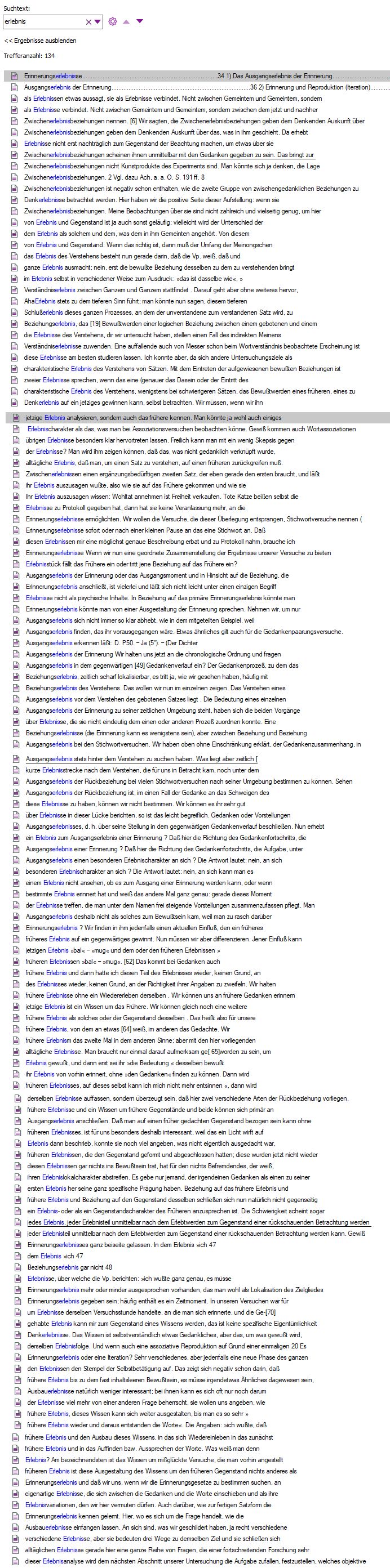(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=29.12.2022 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 03.09.24
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Erleben und Erlebnis bei Karl Bühler_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Erleben und Erlebnis bei Karl Bühler (1879-1963)
Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen
Haupt- und Verteilerseite Definitions-Register Psychologie * Checkliste Definition, gpds-Regel * Definition und definieren: referenzieren * ist-Bedeutungen * Begriffscontainer (Containerbegriff) * Begriffsverschiebebahnhöfe * Wissenschaftliches Arbeiten, Regeln Grundbegriffe, Begriffsbasis, Zitieren, Hochstaplerzitierstil * Aristoteles Zum Geleit * Sprachkritik und Sch^3-Syndrom * Methode der Textanalyse * Methodik-Beweissuche in der Psychologie * Beweissuchwortkürzel. * Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen * Checkliste-Beweisen.: Beweisregister Psychologie * Beweis und beweisen in der Psychologie * natcode Register * Übersicht allgemeine Beweisseiten * Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse , Tabelle Fundstelleninformationen erleben, erlebt, Erlebnis * Hauptbedeutungen Erleben * Elementare Dimensionen des Erlebens * »«
Inhaltsübersicht
- Info Fundstellenkürzel
Ti, IV, SR, T.
- Zusammenfassungen (chronologisch 1903-1934):
- Gesamtzusammenfassung Fazit Karl Bühler 11 Werke 1903-1934.
- Zusammenfassung-Disseration-1903.
- Zusammenfassung-Komplizierte-Denkvorgänge-1904.
- Zusammenfassung-Denkvorgänge-I-Über-Gedanken-1907.
- Zusammenfassung-Denkvorgänge II Über Gedankenzusammenhänge 1908a.
- Zusammenfassung-Denkvorgänge III Über Gedankenerinnerung 1908b.
- Zusammenfassung-Die Gestaltwahrnehmungen 1913.
- Zusammenfassung-Die geistige Entwicklung des Kindes-1918.
- Zusammenfassung-Die Erscheinungsweisen der Farben 1922.
- Zusammenfassung-Krise der Psychologie 1926 (Artikel Kantstudien).
- Zusammenfassungen Krise der Psychologie 1927 (Buch):
- Zusammenfassung Erleben in Krise der Psychologie 1927 (Buch).
- Zusammenfassung Erlebnis in Krise der Psychologie 1927 (Buch).
- Zusammenfassung-Ausdruckstheorie 1933.
- Zusammenfassungen-Sprachtheorie-1934:
- Dissertation 1903.
- Komplizierte-Denkvorgänge-1904.
- Denkvorgänge-I-Über-Gedanken-1907.
- Denkvorgänge II Über Gedankenzusammenhänge 1908a.
- Denkvorgänge III Über Gedankenerinnerung 1908b.
- Die Gestaltwahrnehmungen 1913.
- Die geistige Entwicklung des Kindes-1918.
- Die Erscheinungsweisen der Farben 1922.
- Krise der Psychologie 1926 (Artikel Kantstudien).
- Krise der Psychologie 1927 (Buch).
- Ausdruckstheorie 1933.
- Sprachtheorie 1934:
Signierungen und Signierungssystem.
Checkliste definieren. Checkliste-Beweisen.
Methodik-Beweissuche in der Psychologie.
Signierung von Beweiserwähnungsbeurteilungen.
Beweissuchwortkürzel.
Literatur, Links, Glossar, Anmerkungen und Endnoten, Querverweise, Copyright und Zitierung, Änderungen
Editorial
Karl Bühler gilt als bedeutender Erlebnis Psychologe noch der Blütezeit der deutschen Psychologie und war sehr um die Einheit der Psychologie und die Überwindung der Schulen bemüht, wie besonders sein Werk Die Krise der Psychologie (1927, Buch; 1926 Artikel Kantstudien) zeigt. Auf dieser Seite werden 12 Arbeiten Bühlers aus 32 Jahren zu erleben, erlebt und Erlebnis erfasst: Med. Dissertation 1903, vier zum Denken (1904-1908), Gestaltwahrnehmungen 1913, Geistige Entwicklung des Kindes 1918, Erscheinungsweisen der Farben 1922, zwei zur Krise der Psychologie (1926-1927), Ausdrucktheorie 1933 und die letzte zur Sprachtheorie (1934). Es zeigt sich für mich überraschend, dass Bühler dem Erlebens- und Erlebnisbegriff (Grundregeln Begriffe) nicht die Aufmerksamkeit widmet, die notwendig gewesen wäre, um für die Psychologie des Erlebens und der Erlebnisse Grundlegendes und Systematisches zu leisten. Aber Bühler gibt viele wichtige Anregungen (z.B. 1904: "Was erleben wir, wenn wir denken?", Denkprotokolle und eine Bestätigung der Lipp'schen (1905) Idee des gegenständlichen Erlebens (erlebeng), ohne sich auf Lipps zu beziehen). Die Definition der Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten (bei Bühler noch Benehmen) geht wahrscheinlich auf ihn zurück (S.29).
Info Fundstellenkürzel Ti, IV, SR, T.
Jenachdem ob erleben, erlebt oder Erlebnis im Titel, im Inhaltsverzeichnis, Sachregister oder im Text vorkommt, wird dies standardmäig erfasst. Kommt erleben, erlebt oder Erlebnis im Ti vor, sollten erleben, erlebt, Erlebnis in dem Werk eine besondere Rollen spielen, das gilt auch für Aufnahmen ins Inhaltsverzeichnis oder ins Sachregister.
Ti Kommt erleben, erlebt, Erlebnis im Titel vor? Falls ja Signierung Ti+, fall nein Ti-
IV Wenn es kein Inhaltsverzeichnis gibt, wird -IV signiert.Gibt es ein Inhaltsverzeichnis, aber keinen Eintrag erleben, erlebt oder Erlebnis, wird IV- signiert. Gibt es Einträge wird IV+ signiert.
SR Wenn es kein Sachregister gibt, wird dies mit -SR signiert. Gibt es im Sachregister keine Einträge erleben, erlebt oder Erlebnis wird SR- signiert. Gibt es Einträge, wird SR+ signiert.
Text Die Vorkommen oder Erwähnungen von erleben, erlebt und Erlebnis werden ausgezählt. e = erleben + erlebt, E = Erlebnis. Hier wird angegeben, wie oft e := erleben + erlebt und E := Erlebnis vorkommen.
Handelt es sich um ein Werk, von dem erwartet werden darf, dass erleben, erlebt, Erlebnis definiert oder näher erläutert werden darf, wird in der Tabelle unter Gebrauch ein A (Analyse) signiert. Wird erleben, erlebt., Erlebnis gebraucht und darf eine Analyse nicht erwartet werden, wird ein G (Gebrauch) signiert.
Kommt der Suchtext erleben, erlebt, Erlebnis in einm Werk gar nicht vor, kann die Verwendung auch nicht beurteilt werden, es wird Fssn (Frage stellt sich nicht) signiert.
Eine Definition oder nähere Erläuterung hat das Kürzel DE, erfüllt DE+, nicht erfüllt DE-.
Zusamenfassungen
Gesamtzusammenfassung Karl Bühler
1903, 1904, 1907, 1908(2), 1913, 1918, 1922, 1926, 1927, 1933, 1934
Es wurden 12 Arbeiten ( 1 Dissertation, 4 Denken, 1 Gestaltwahrnehmungen,
1 Geistige Entwicklung Kindheit, 1 Farben, 2 Krise, 1 Ausdruckstheorie,
1 Sprachtheorie) Bühlers in der Zeit von 1903-1934, also 32 Jahre,
mit der Methode der Textanalyse nach erleben, erlebt, Erlebnis durchsucht,
gesichtet, ausgezählt und interpretiert, teilweise vollständig.
Nirgendwo definiert oder erläutert Bühler näher, was man
nach der Grundregel für wichtigere Begriff (Regeln
Grundbegriffe) erwarten darf, was er unter erleben oder Erlebnis versteht,
auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweise oder Literaturhinweis,
obwohl er quasi implizit eine Erlebnispsychologie anwendet, die er aber
nicht systematisch aufbaut und darlegt. Aus dem Kontext der Fundstellen
lässt sich jedoch schließen, dass erleben all das ist, was sich
im Bewusstsein ereignet und dort innerlich wahrgenommen wird Viele
seiner Ansätze und Ideen (1904: "Was erleben wir, wenn wir denken?"
wird man aber für eine Erlebens- und Erlebnispsychologie nutzen können.
Definieren war und ist die große Schwachstelle der PsychologInnen,
der Klassiker wie auch auch der modernen.
- Zusammenfassung-Dissertation-1903: In der Dissertation werden erleben, erlebt, Erlebnis nicht erwähnt.
- Zusammenfassung-Komplizierte-Denkvorgänge-1904: Die dreieinhalb-Seiten Arbeit beginnt mit der verheißungsvollen Frage: "Was erleben wir, wenn wir denken?", die Bühler allerdings nicht beantwortet. Er gebraucht erleben 1x, erlebt 1x, Erlebnis 8x davon Denkerlebnis 4x, aber Bühler erklärt nicht, was er unter Erleben oder denken erleben versteht, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Bühler1904 hat den Erlebensbegriff grundlegend nicht verstanden, wie die 10 dokumentierten Fundstellen (hier durchnumeriert von 1-10, Index vor dem Suchwort) belegen.
- Zusammenfassung-Denkvorgänge-I-Über-Gedanken-1907: Bühler definiert, erklärt, erörtert die Begriffe erleben und Erlebnis nicht, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Ich ziehe daraus den Schluss, dass Bühler erleben und Erlebnis für allgemeinverständliche und nicht weiter erläuterungsbedürftige Grundbegriffe erachtet. Aber die Arbeit bringt viele konkrete und dokumentierte Beispiele für Denkerlebnisse, die von bleibendem denkpsychologischen und historischen Wert sind.
- Zusammenfassung-Denkvorgänge-II-Über-Gedankenzusammenhänge-1908a: Erleben und Erlebnis werden in dieser Arbeit gebraucht, aber nicht näher definiert oder erläutert. Bühler hebt, S.9, wie Lipps 1905 den Unterschied zwischen Erlebnis und Gegenstand (erlebeng) hervor. Allerdings zitiert er Lipps 1905 nicht. Fundstellen: Ti-, -IV, -SR, T: e=4, E=24. Erleben 1, erlebt 3, Erlebnis 24.
- Zusammenfassung-Denkvorgänge-III-Über-Gedankenerinnerung-1908b: Erleben, erlebt und Erlebnis werden zusammen 143x gebraucht, aber nicht definiert oder näher erklärt. Auch nicht das Ausgangserlebnis der Erinnerung (S.48). Das sollte natürlicherweise sein: ich erinnere, aber das ist nicht zwingend. Man kann einfach erinnern ohne bewusstes Metaerlebnis ich erinnere. Dazu habe ich bei Bühler nichts gefunden. Fundstellen: Ti-, IV+, -SR, T: e=40, E=103. Erleben 21, erlebt 19, Erlebnis 103.
- Zusammenfassung-Gestaltwahrnehmungen-1913: Es wurden die Fundstellen bestimmt: Ti-, IV-, -SR, T: e=19, E=100. erleben=9, erlebt 10, Erlebnis=100. Sodann habe ich sämtliche 9 Fundstellen von S.5 bis S.235, also 231 Seiten, zu erleben erfasst und dokumentiert. In keiner der 9 Fundstellen wird erleben definiert oder näher erläutert, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweise oder Literaturhinweis. Den 100 Fundstellen zu Erlebnis kann man entnehmen, dass der Erlebnisbegriff in den Gestaltwahrnehmungen Bühlers eine große Rolle spielt. Beim Sichten der Fundstellen "Erlebnis" fiel mir auf, dass Bühler eine ganze Reihe von Erlebnisklassen benennt, die er allerdings nicht ordentlich definiert oder näher erläutert. Er gebraucht hier eine - quasi implizite -Erlebnispsychologie, ohne sie systematisch aufzubauen. Viele von Bühlers Ideen werden wahrscheinlich in einer künftigen und systematischen Erlebens- und Erlebnispsychologie genutzt werden können.
- Zusammenfassung-Die-geistige-Entwicklung-des-Kindes-1918: Fundstellen: Fundstellen: Ti-, IV+, SR+, T: e=32, E=106. Ein wichtiges Buch für die Entwicklung des Erlebens und der Erlebnisse in der Kindheit. Im Inhaltsverzeichnis gibt zwei Einträge zu Erlebnissen und im Sachregister werden vier Erlebnisklassen (Aha-E., Begriffs-E., Gewißheits-E., Überzeugungs-E.) eingetragen, aber nicht erleben oder das Erlebnis selbst. Ich habe die ersten 11 Fundstellen "erleb" im Text von S.7-S.47, also 41 Seiten, im Buch erfasst und dokumentiert, weil man erwarten darf, dass wichtigere Begriffe dort definiert oder näher erläutert werden, wo sie die ersten Male erwähnt werden (Regeln Grundbegriffe). Eine ausdrückliche Definition oder nähere Erläuterung zum Erleben oder zu den Erlebnisse habe ich bei den ersten 11 Erwähnungen, S.7-S.47 von "erleb" nicht gefunden, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis. Man kann aber aus dem Gebrauch im Kontext [4,5] schließen, dass erleben all das ist, was sich im Bewusstsein ereignet und dort mit der inneren Wahrnehmung vergegenwärtigt wird. Es werden aber auch unbewusste Mechanismen, z.B. S. 236, erwähnt (unbewußt insgesamt 7x). Das Buch bietet viele Anregungen und Ideen für die Erlebens- und Erlebnispsychologie.
- Zusammenfassung-Farben-1922: Es gibt in dem 209 Seiten Text nur wenige Fundstellen: erleben 0, erlebt 2, Erlebnis 1. In dem Werk werden erlebt und Erlebnus nur gebracuht, aber nicht definiert oder näher erläutert, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.
- Zusammenfassung-Krise-der-Psychologie-1926 (Artikel Kantstudien): Die Arbeit in den Kantstudien zur Krise der Psychologie ist ein Jahr vor der Buchveröffentlichung erschienen. Sie wurde nach erleben, erlebt, Erlebnis und nach defin durchsucht: Ti-, -IV, -SR, T: e=18, E=69; defin=9, womit Verständnis und Gebrauch Definition, definieren, definiert von Bühler in dieser Arbeit erfasst wird. Das ist auch interessant hinsichtlich einer Zusammennennung mit erleben und Erlebnis. Geht man die jeweils 9 Fundstellen zum Erleben und erlebt durch (meist mit Bezug zu Spranger), findet man keine Definition oder nähere Erläuterung, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis, Literaturhinweise durch die Bezugnahmen auf Spranger. S.458: "Die derart gestellte Sinnfrage aber führt konsequent erstens zu neuen Aufgaben der deskriptiven Bestimmung der Erlebnisse und zweitens zu spezifisch teleologischen Verlaufsgesetzen des seelischen Geschehens." S.459 spricht vom "Endziel der Psychologie als der Wissenschaft von den Erlebnissen." Bühler verheddert sich in die Sinnfrage und kommt dadurch nicht weiter. Kryptisch und offen bleibt die These S. 473: "... niemand kann letzten Endes darüber Aufschluß geben, was Sinn eigentlich ist, außer der Erlebnispsychologie." S. 486 spezifiziert: "... Erlebnisanalysen von Affekt- und Willensverläufen, ... ". Die Seite 458 angesprochene Aufgabe der deskriptiven Bestimmung der Erlebnisse erfüllt Bühler an keiner Stelle. Er bleibt wie die meisten Erlebensforscher im Allgemein-Abstrakten und er fällt im Grunde deutlich hinter Brentano zurück.
- Zusammenfassungen Erleben und Erlebnis in der Krise der Psychologie 1927 (Buch):
- Zusammenfassung-Erleben-in-Krise-der-Psychologie-1927-(Buch): "erleben" wird im Text 52x erwähnt. Weder im Inhaltsverzeichnis noch im Sachregister wird ein Eintrag "erleben" geführt. Ich habe die ersten 13 Erwähnungen im Text von S. 17 bis Seite 84 erfasst und dokumentiert. Nirgendwo wird erleben erklärt oder näher ausgeführt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis, so dass ich davon ausgehe, dass Karl Bühler erleben für einen nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichtigen, sondern für einen allgemeinverständlichen Grundbegriff hält.
- Zusammenfassung-Erlebnis-in-Krise-der-Psychologie-1927-(Buch): "Erlebnis" wird 160x erwähnt. 4x im Inhaltsverzeichnis, 13x im Sachregister und 160x im gesamten Text. In den 29 dokumentierten Fundstellen S.2-29 wird der Begriff Erlebnis nicht erklärt oder näher charakterisiert, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Ich gehe daher davon aus, dass Karl Bühler den Begriff nicht für erklärungs- oder begründungsbedürftig hält und als allgemeinverständlichen Grundbegriff gebraucht.
- Ausdruckstheorie-1933:
- Zusammenfassung-Erleben-in-der-Ausdruckstheorie-1933: Fundstellen: Ti-, IV-, SR+, T: e=29, E=69. erleben 22 (ohne 4 Pseudos); erlebt 7, Erlebnis 69. Zur genauen Analyse habe ich die ersten 10 lückenlosen Fundstellen von S. 10 bis S. 147, also 138 Seiten erfasst und dokumentiert. An keiner Stelle wird erleben definiert oder näher erläutert, auch nicht durch Fußn ote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.
- Zusammenfassungen-Sprachtheorie: Insgesamt kann man davon ausgehen, dass Bühler die Begriffe erleben und Erlebnis in der Sprachtheorie für nicht weiter erklärungs- oder erläuterungsbedürftig hält.
- Zusammenfassung-Erleben-in-der-Sprachtheorie-1934: Erleben wird 5x erwähnt (insgesamt 9x mit 4 Pseudos). In keiner der 5 Textstellen (S. 41, 53f, 68f, 135, 374f) wird erleben erklärt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis.
- Zusammenfassung-Erlebnis-in-der-Sprachtheorie-1934: Suchen nach "Erlebnis" ergibt insgesamt 68 Fundstellen. Eine geht auf das Geleitwort von Kainz, die zweite auf das Inhaltsverzeichnis, verbleiben noch 66. Ich habe die ersten 10 Fundstellen ab Seite 8 bis Seite 126 erfasst und bei keiner eine Erklärung oder nähere Ausführung zu Erlebnis gefunden. Auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Ich gehe daher davon aus, dass Bühler den Begriff in seiner Sprachtheorie von 1934 für nicht erklärungs- oder begründungsbedürftig, sondern für allgemeinverständlich hält. Ich habe dann aufgehört weiter zu suchen und zu dokumentieren, weil ich davon ausgehe, was in den ersten 10 Erwähnungen der ersten 118 Seiten nicht erklärt wird, wie es nach den Grundregeln für wichtigere Begriffe, eigentlich sein sollte, auch wahrscheinlich später nicht mehr erklärt.
Analyse der Fundstellen in den Arbeiten Karl Bühlers 1903-1934
Dissertation-1903
Bühler, Karl (1903) Beiträge zur Lehre von der Umstimmung
des Sehorgans. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der medizinischen Doktowürde.
Med. Fak. Albert Ludwigs Universität. Freiburg.
Keine Fundstellen erleben, erlebt, Erlebnis.
Komplizierte-Denkvorgänge-B1904:
Denkerleben1904: Was erleben wir, wenn
wir denken?
Bühler, Karl (1904) Eine Analyse komplizierter Denkvorgänge.
In (263-266) 1904 BERICHT über den I. Kongreß für experimentelle
Psychologie in Würzburg vom 18. bis 21. April 1904. Leipzig: Barth
(1907).
Z-Fazit-B1904: Die dreieinhalb-Seiten
Arbeit beginnt mit der verheißungsvollen Frage: "Was erleben wir,
wenn wir denken?", die Bühler allerdings nicht beantwortet. Er
gebraucht erleben 1x, erlebt 1x, Erlebnis 8x davon Denkerlebnis 4x, aber
Bühler erklärt nicht, was er unter Erleben oder denken erleben
versteht, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis.
Bühler1906 hat den Erlebensbegriff grundlegend nicht verstanden.
Z1-Bestandstücke Denkerlebnis,
S. 264: "...: Welches sind die Bestandstücke der beschriebenen
Denkerlebnisse?
Antwort: Vorstellungen [I13]
aller Art, aller Sinnnesgebiete, Sach- und Wortvorstellungen, aber außer
ihnen viel häufiger, reicher und mannigfaltiger andere Gebilde, die
am häufigsten als Gedanken [I07]
oder in Anlehnung an Marbe und Ach als Bewußtseinslagen
oder Bewußtheiten, auch als Wissen oder Überzeugung bezeichnet
wurden"
_
Alle 10 Fundstellen
"erleb" in Bühler1904
263f: Was erleben wir, wenn wir denken
"Was 1erleben wir, wenn
wir denken? Das ist offenbar die nächstliegende und allgemeinster,
freilich darum auch inhaltärmste Enge, die sich eine psychologische
Untersuchung der Denkvorgänge stellen kann. Sie weist unmittelbar
auf eine einfache Analyse unserer 2Denkerlebnisse
hin. Der Vortragende hat sich als ersten Teil einer umfangreicheren Untersuchung
eine solche Analyse als Ziel gesetzt und hier eine Skizze seiner Resultate
zu bieten versucht Als Material seiner Aufstellungen dienten ihm Analysen,
die ihm geübte Psychologen von ihren eigenen 3Denkerlebnissen
geboten hatten. Es ist die seit langer Zeit schon im Wüzburger psychologischen
Institut geübte Methode der Selbstbeobachtung an experimentell
erzeugten 4Erlebnissen,
die er sich für seine Zwecke ausgebaut hat Weil er zu der Überzeugung
gekommen war, daß man geübten Denkern keine Kinderaufgaben geben
darf, wenn man ein wirkiches Denken erhalten will, und daß die kompliztierteren
Denkvorgänge einer Analyee leichter zugänglich sind als die ganz
einfachen, hat er seinen Versuchspessonen schwierigere Denksaufgaben vorgelegt·
Er fragte sie z. B.: verstehen Sie? oder: ist es richtig? und las ihnen
dann einen Aphorismus vor; nach der Antwort ja oder nein ließ er
sich unmittelbar zu Protokoll geben, was sie über ihre 5Erlebnisse
von der Auffassung des 6Erlebten
bis zu dem ja oder nein angeben konnten. Eine mannigfattige Variation der
Denkaufgaben war naheliegend und einfach durchzuführen. [>264]
Eine Orientieungg in der bunten Mannigfattigkeit
dieser Protokolle wird zunächst zu der ohne Kommentar verständlichen
Frage führen: Welches sind die Bestandstücke der beschriebenen
7Denkerlebnisse?
Antwort: Vorstellungen aller Art, aller Sinnnesgebiete, Sach- und Wortvosstellungen,
aber außer ihnen viel häufiger, reicher und mannigfaltiger andere
Gebilde, die am häufigsten als Gedanken oder in Anlehnung an Marbe
und Ach als Bewußtseinslagen oder Bewußtheiten, auch
als Wissen oder Überzeugung bezeichnet wurden. Es zeigt sich daß
man Vorstellungen und Gedanken im allgemeinen ganz sicher auseinander zu
halten vermag. Nun fragt es sich was beide für unser Denken leisten.
Der Vortragende kommt zu der Behauptung: Vorstellungen sind keine notwendigen
Bestandstücke unserer 8Denkerlebnisse
(Vorstellungen stets in dem Sinn der Versuchspersonen als sinnliche Vorstellungen
gefaßt), und gründet diese Behauptung indirekt auf die Tatsache
der handgreiflchen Inadäquatheit zwischen dem Gedankengehalt und dem
was vorgestellt wird, und direkt auf die Tatsache des absolut vorstellungslosen,
rein unanschaulichen Denkens, d. h. eines Denkens in 9Erlebnissen
die sich in keinem Teile durch die Bestimmtheiten sinnlicher Qualitäten
oder Ingnsltäten charakteriseeren lassen, insbesondere auch keine
Spur irgend einer Wortvorstellung enthalten. Die Vorstellungen können
also keine wesentliche Bedeutung für unser Denken haben, sondern dürfen
nur als Stützen, Hilfen, Fixierungspunkte der Gedanken angesehen werden.
Die eigentlichen Bestandstücke des Denkens sind nur die Gedanken.
Nun erhebt sich natürlich gebieterisch die Frage:
was sind denn diese Gedanken? Man wird, besonders wenn man an eine genetische
Betrachtungsweiee der psychischen Gebilde gewöhnt ist, zunächst
an eine Art verdichteter oder sublimierter Vorstellungen denken. Oder man
wird geneigt sein, das aus anderen Tatsache erschlossene unbewußt
Psychische auch hier zu verwerten und zur Erklärung des unanschaulichen
Denkens etwa „erregte Dispositionen“ zu Vorstellungen oder „aufgeschlossne
Assoziationsbahnen“, Vorstellungsrmöglichkeiten oder die „Gewißheit
der Vorstellungsmöglichkeiten oder wie sonst die Formulierungen desselben
Gedankens lauten mögen, heranzuziehen.
Beide Erklärunrvgrssuhge glaubt der Vortragende als
unzureichend ablehnen zu müssen. Die Annahme der „erregten Dispositionen“
ist gewiß gut begründet und die Versuche, auf die sich seine
Ausführungen stützen, bieten selbst ein reiches Material zu [>265]
ihrer weiteren Ausgestaltung. Aber diese Dispositionen sind eben als Unbewußtes
nicht das Bewußte des Gedankens und wenn wir auf sie allein angewiesen
wären, ständen wir im Falle des auch wortlosen Gedankens vor
der Gleichung: der bewußte, klare und deutliche Gedanke == einer
Summe von unbewußten Dispositionen, oder etwas psychisch Wirkliches
== einer Summe von psychischen Möglichkeiten. Auch gegen die Verdichtuggsannahme
lassen sich aus der einfachen Analyse unserer 10Denkerlebnisse
gewichtige Bedenken gewinnen: die realen Bestimmthetten des Gedankens fallen
in keiner Weise zusammen mit denen der sinnlichen VorsteHungen. Ein Gedanke
kann nicht charaktertetert werden durch Qualität, Intensität
u. s. w. wie die Vorstellungen, auch wenn er noch so klar und deutlich
in uns gegenwärtig ist und gerade dann am wenigsten, und ob eine noch
so gründtiche „psychische Chemie“ diese Eigenschaftskluft wird überbrücken
können, dürfte doch zum mindesten recht fraglich sein.
..."
Ende Bühler 1904
Denkvorgänge
Die Arbeit über die Denkvorgänge besteht aus drei Teilen
und wurde 1907-1908ab im Archiv für die gesamte Psychologie veröffentlicht.
Denkvorgänge I Über
Gedanken
Bühler, Karl (1907) Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie
der Denkvorgänge I. Über Gedanken. Archiv für die gesamte
Psychologie, 9, 297-365.
Fazit: Bühler definiert, erklärt, erörtert die Begriffe erleben und Erlebnis nicht, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Ich ziehe daraus den Schluss, dass Bühler erleben und Erlebnis für allgemeinverständliche und nicht weiter erläuterungsbedürftige Grundbegriffe erachtet. Aber die Arbeit bringt viele konkrete und dokumentierte Beispiele für Denkerlebnisse, die von bleibendem denkpsychologischen und historischen Wert sind.
Inhaltsverzeichnis-1907
"§ 2. Die Bestandstücke unserer Denkerlebnisse. 314"
Kein Sachregister.
Fundstellen: erleb 178, erleben 22, erlebt 22, Erlebnis... 134
Schauen wir uns die Fundstellen "erleben" an, regen 4 und 5 zu einer
näheren Betrachtung an:
- Fundstelle (4) 29: "... Mit diesen Versuchen sind wir, wie ich glaube,
den
Verhältnissen der außerexperimentellen Wirklichkeit, dem was wir täglich bei unserer
wissenschaftlichen Denkarbeit erleben, recht nahe gekommen. ..."
Fundstelle (4), S. 29 gibt nichts her - außer, dass erleben
nicht definiert, erklärt, erörtert oder sonstwie näher ausgeführt
wird, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis,
so dass bis herher angenommen werden muss, dass Bühler erleben für
allgemeinverständlich und nicht weiter erklärungsbedürftig
hält.
Fundstelle (5) 34: " Wir gliedern die Einzelversuche auch nicht erst nach den Versuchsarten sondern betrachten
sie gleich alle zusammen unter dem Gesichtspunkt unserer allgemeinen Frage. Die Aufgabe, die wir
uns zunächst hier stellen, ist eine rein deskriptive. Was erleben wir unter den geschilderten
Versuchsbedingungen?
Sehen wir uns gleich einmal das Protokoll eines gut gelungenen Versuches an:
K. A13617 . – Ja (13''). – »Es kam mir zunächst das Oxymoron deutlich zum Bewußtsein. Dann hatte ich den
Gedanken an zukünftige Bedeutung und damit fiel mit ein, daß ein Satz da war, der das vorher und nachher
betonte, mehr nicht. Jetzt konstruiere ich ihn mir ganz. (Daß man keine Feinde hat, wenn man weit genug voraus
oder zurück ist.) – Es ist merkwürdig, daß mir jetzt erst der Unterschied der beiden Gedanken auffällt, erst hab'
ich nur das Gemeinsame gefunden.«
D. A13. – Ja (3''). – (Keine Suppe ist teurer, als die man umsonst ißt.)
– »Erst verstand ich den Sinn des
Satzes, dann hatte ich einen Gedanken, der allgemeiner war und den
ich ungefähr so wiedergeben kann: es gibt
scheinbare Vorteile, die durch größere Nachteile aufgewogen
werden. Daran sofort ein Wiederkommen des
vorhin Gehabten, ein Ähnlichkeitsbewußtsein, etwa wie wenn
ich sagen würde: so ähnlich war der Gedanke [46]
vorhin da (aber ganz ohne Worte). Beim Aussprechen kommt mir der Satz
fremder vor, als ich erst vermeint
hatte. – [ Wie erfolgte von dem Wiedererkennen aus der Abstieg?]: »Erst
wußt' ich, daß es vorhin konkreter war,
dann kamen mir die Begriffe 'Suppe' und 'teuer' (mit den Worten) und
dann sprach ich das Ganze aus.«
Was finden wir da? Die Vp. beschäftigt sich
mit dem vorgelegten Gedanken, sucht ihn zu
verstehen. Da »fällt« ihr, wie sie ein Moment des
Gedankens näher ins Auge faßt oder sich den
tiefer liegenden Sinn des Satzes in einem allgemeineren Gedanken zum
Bewußtsein bringt, etwas
von einem früheren Gedanken »ein«. Sie wendet sich
diesem früheren zu, sucht sich ihn zu
ergänzen, und die Worte, die ihn ausdrückten, wiederzugeben.
Es sind drei Dinge, die uns an diesem
Vorgang interessieren. Wann, d. i. im A n s c h l u ß a
n w e l c h e s g e g e n w ä r t i g e
E r l e b n i s s t ü c k
f ä l l t d a s F r ü h e r e e i n o
d e r t r i t t j e n e B e z i e h u n g a u f
d a s F r ü h e r e
e i n? W a s i s t d i e s e B e z i e h u
n g a u f d a s F r ü h e r e o d e r
v o r h e r, w a s e r l e b t
d i e Vp.
i n i h r? U n d w i e w e i t u n d
w i e g e l i n g t e s i h r a n z u g e b e n,
w i e d i e s e s F r ü h e r e
l a u t e t e? Im Mittelpunkt steht natürlich die Beziehung selbst
(wir wählen absichtlich diesen
unbestimmten Terminus, um nichts mit dem Worte zu präsumieren).
In oder mit ihr gewinnt ja
offenbar das Frühere einen bestimmenden Einfluß auf das
gegenwärtige Erleben. Wir könnten
sie,
insofern sie auch selbst erlebt wird, als Rückbeziehung bezeichnen
und müßten dann noch einen
Terminus für den realen Einfluß des Früheren auf das
gegenwärtige
Erleben als solchen prägen. Zur
Vermeidung solcher neuen Ausdrücke für bekannte Dinge wollen
wir indes lieber das Wort
Erinnerung vorerst in etwas weitem und unbestimmteren Sinne als pars
pro toto gebrauchen. Die [>35]
nähere Bestimmung wird sich später von selbst ergeben. An
was sich die Beziehung anschließt, das
ist das Ausgangserlebnis der Erinnerung
oder das Ausgangsmoment und in Hinsicht auf die
Beziehung, die in der Erinnerung liegt und die ja zwischen zwei Gliedern
stattfindet, das
Ausgangsglied der Erinnerung (gegenüber dem Zielglied), vom Standpunkt
einer dynamischen
Analyse aus könnte es als Erinnerungsmotiv bezeichnet werden.
Was sich an dies primäre
Erinnerungserlebnis anschließt,
ist vielerlei und läßt sich nicht leicht unter einen einzigen
Begriff
bringen. Es steht wohl unter einem einzigen Gesichtspunkt, es kann
nämlich als Hilfsmittel oder als
Weg zu der Wiedergabe des früheren Satzes be-[47]trachtet werden,
aber das charakterisiert ja die
Erlebnisse nicht als psychische
Inhalte. In Beziehung auf das primäre Erinnerungserlebnis
könnte
man von einer Ausgestaltung der Erinnerung sprechen. Nehmen wir, um
nur ein Wort zu
haben, einmal diesen Ausdruck für den ganzen dritten Komplex von
Vorgängen."
Fundstelle (5) 34 beschreibt zwar ein konkretes Denkerlebnis und
erfasst es in einem Denkerlebnisprotokoll, aber erleben wird auch hier
nicht definiert, erklärt oder erörtert, auch nicht durch Querverweis,
Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis, so dass bis hierher angenommen
werden muss, dass Bühler erleben für allgemeinverständlich
und nicht weiter erklärungsbedürftig hält.
Bühler 1907 Denkvorgänge I Sämtliche Fundstellen erleben, erlebt, Erlebnis im Kontext
Denkvorgänge II Über
Gedankenzusammenhänge
Bühler, K. (1908). Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie
der Denkvorgänge II: Über Gedankenzusammenhänge. Archiv
für die gesamte Psychologie 12, pp. 1-23.
Zusammenfassung-Denkvorgänge-II-Über
Gedankenzusammenhänge
Erleben und Erlebnis werden in dieser Arbeit gebraucht, aber nicht
näher definiert oder erläutert. Bühler hebt, S.9, wie
Lipps
1905 den Unterschied
zwischen Erlebnis und Gegenstand (erlebeng)
hervor. Allerdings zitiert er Lipps 1905 nicht.
Fundstellen: Ti-, -IV, -SR, T: e=4, E=24. Erleben 1, erlebt 3,
Erlebnis 24.
Inhaltsverzeichnis-Denkvorgänge-II
II. Über Gedankenzusammenhänge 6
- § 1. Über zwischengedankliche, bewußte Beziehungen
6
§ 2. Über das Auffassen von Gedanken (das Verstehen von Sätzen) 12
S.9 Unterscheidung Erlebnis und Gegenstand (>Lipps 1905)
"... Die Unterscheidung von Erlebnis und
Gegenstand ist ja auch sonst geläufig; vielleicht wird der Unterschied
der bewußten Beziehungen einmal mit anderem zusammen befahigt
sein, ihn fester zu begründen, als das der einfache Hinweis auf die
Selbstbeobachtung vermag. Wir würden dann sagen: der gekennzeichnete
Unterschied in den Beziehungen ist vorhanden; dieser muß
auf einem Unterschied der Beziehungspunkte beruhen, also sind wir
berechtigt, in dem was wir zurückschauend über eben gehabte Bewußtseinsvorgänge
auszusagen vermögen zu scheiden zwischen dem,
was dem Erlebnis als solchem und dem, was dem in ihm Gemeinten
angehört. Von diesem Gesichtspunkt aus wäre es interessant zu
wissen, ob die unterschiedenen Beziehungen auch in anderen Richtungen
Verschiedenheiten aufweisen. Und ich glaube eine solche liegt
in ihrem Verbalten zum Gedächtnis. Einiges werden darüber unsere
Erinnerungsversuche zutage fördern. Doch sind die Beobachtungen
noch zu spärlich, als daß ich sie hier schon verwerten könnte. ..."
_
Denkvorgänge III Über Gedankenerinnerung
Bühler, K. (1908). Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgänge III: Über Gedankenerinnerung. Archiv für die gesamte Psychologie 12, pp. 24-92.
Zusammenfassung-Denkvorgänge
III Über Gedankenerinnerung: erleben, erlebt und Erlebnis
werden zusammen 143x gebraucht, aber nicht definiert oder näher erklärt.
Auch nicht das Ausgangserlebnis der Erinnerung (S.48). Das sollte natürlicherweise
sein: ich erinnere. Aber das sagt Bühler nicht. Fundstellen: Ti-,
IV+, -SR, T: e=40, E=103. Erleben 21, erlebt 19, Erlebnis 103.
Inhaltsverzeichnis-Denkvorgänge III Über Gedankenerinnerung
- III. Über Gedankenerinnerungen 20
Einleitung 20
- § 1. Die Versuche 21
- 1) Die Gedankenpaarung (P) 21
2) Die Ergänzungsversuche (E) .23
3) Die Analogieversuche (A) 26
4) Die Stichwortversuche (St) 30
5) Versuchspersonen und Versuchanzahl 32
- 1) Das Ausgangserlebnis der Erinnerung
.36
2) Erinnerung und Reproduktion (Iteration) 44
3) Die Ausgestaltung der Erinnerung (das Finden der Sätze) 52
Versuchstexte zu III. Über Gedankenerinnerungen 64
Gsperrt bei Bühler hier fett.
S.48: "1) Das Ausgangserlebnis der Erinnerung.
Wir halten uns jetzt an die chronologische Ordnung und fragen
zunächst: Was kann als Ausgangsglied einer Erinnerung fungieren?
Darauf läßt sieh eine summarische Antwort geben: nicht
nur
Gedanken und Vorstellungen sondern auch Gefühle,
nicht nur ganze Gedanken sondern auch Gedankenteile,
Gedankenmomente. Wir wollen den Einzelnachweis zugleich mit
der Antwort auf eine zweite Frage zu geben versuchen. Welche
Stelle nimmt das Ausgangserlebnis in dem gegenwärtigen
[>49]
Gedankenverlauf ein? Der Gedankenprozeß, zu dem das Ausgangsglied
gehört, ist in unseren Versucben ein Verstehen. Nun
ist das wesentlichste Stück dieses Prozesses, das Beziehungserlebnis,
zeitlich scharf lokalisierbar, es tritt ja, wie wir gesehen
haben, häufig mit einem inneren Elan, einem »aha «
ein. Daher
ist es für die Vp. leicht, sich nach diesem markanten Punkt ihres
Erlebens zu orientieren. Wir erhalten in unseren Protokollen stets
genaue Auskunft darüber, ob das Ausgangsglied einer Rückbeziehung
zeitlich vor oder hinter jenem »aha« lag. Auch die Angaben
über
die funktionelle Bedeutung des Ausgangsgliedes für den gegenwärtigen
Prozeß richten sich ganz nach dem spezifischen Beziehungserlebnis
des Verstehens. Das wollen wir nun im einzelnen zeigen.
Das Verstehen eines gebotenen Gedankens ist vollstlländig
abgeschlossen, man denkt den Gedanken nun weiter oder
schaut auf das Erlebte zurück, und dabei erst wird irgendein
Inhalt zum Ausgangsglied einer Rückbeziehung. Oder die Rückbeziehung
schließt sich sofort an das Hören des Satzes oder eines
einzelnen Wortes in ihm an, sie tritt also ein vor jedem Verstehen
des in dem Satze enthaltenen Gedankens. Zwischen diesen
extremen Fällen erscheinen alle Möglichkeiten verwirklicht,
die
man sieh von vomherein konstruieren kann. Wir wenden uns zunächst
dem ersten Falle zu."
[Es folgen Beispiele aus den Versuchen.]
_
Gestaltwahrnehmungen-1913
Bühler, Karl (1913) Die Gestaltwahrnehmungen. Experimentelle Untersuchungen zur psychologischen und ästhetischen Analyse der Raum- und Zeitanschauung. Erster Band. Spemann, Stuttgart 1913.
Zusammenfassung-Gestaltwahrnehmungen-1913:
Es wurden die Fundstellen bestimmt: Ti-, IV-, -SR, T: e=19, E=100. erleben=9,
erlebt 10, Erlebnis=100. Sodann habe ich sämtliche 9 Fundstellen von
S.5 bis S.235, also 231 Seiten, zu erleben erfasst und dokumentiert. In
keiner der 9 Fundstellen wird erleben definiert oder näher erläutert,
auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweise oder Literaturhinweis.
Den 100 Fundstellen zu Erlebnis kann man entnehmen, dass der Erlebnisbegriff
in den Gestaltwahrnehmungen Bühlers eine große Rolle spielt.
Beim Sichten der Fundstellen "Erlebnis" fiel mir auf, dass Bühler
eine ganze Reihe von Erlebnisklassen benennt,
die er allerdings nicht ordentlich definiert oder näher erläutert.
Er gebraucht hier eine - quasi implizite -Erlebnispsychologie, ohne sie
systematisch aufzubauen. Viele von Bühlers Ideen werden wahrscheinlich
in einer künftigen und systematischen Erlebens- und Erlebnispsychologie
genutzt werden können.
Alle 9 Fundstellen erleben in lückloser Reihenfolge Gestaltwahrnehmungen
[1] S.5
"... Auch andere Gestalten, z. B. Melodien und Rhythmen, können
wir
uns so untersucht denken, wie es die Geometrie mit den Raumgestalten
tut, d. h. ohne Rücksicht darauf, was wir bei ihrer Auffassung
erleben; auch sie haben ihre (objektiven)
Strukturgesetze ... ."
[2] S.7
"Der Ausgang von einem amorphen Empfindungsaggregat ist
darum auch für unzulässig erklärt worden. Es sei kein
Aufbau
komplexerer Gebilde aus Elementen, den wir in den Gestaltungsvorgängen
erleben, sondern vielmehr eine Analyse
und Gliederung.
Der Komplex und seine Charaktere seien im Bewußtsein immer
das Frühere, zu den sogenannten Empfindungselementen kämen
wir erst durch Abstraktion. ..."
_
[3] S.19
"... und wir erleben sie dann doch
so, als ob sie den Gegenständen
anhafteten. ..."
_
[4] S.20
"... Wenn ein Sechseck exponiert wird, kann
der Beobachter es gelegentlich auf das deutlichste erleben,
wie erst
eine ganze Reihe von Auffassungsakten der Teile vorausgeht, und
dann erst der Gesamteindruck „Sechseck" nachfolgt. ..."
_
[5] S.30
"... So schreibt z. B.
von Kries2): "Alle diese Erscheinungen lassen erkennen, wie einem
Eindruck, der uns als ein gegebener zum Bewußtsein kommt und
sich hierdurch als ein direkt physiologisch bedingter ausweist,
doch ein physiologischer Mechanismus besonderer
Art vorgeschaltet ist 3), der sich durch jene Eigentümlichkeit
seiner Funktion verrät." Gemeint ist mit dieser Eigentümlichkeit
der springende Wechsel, den wir z. B. an Vexierbildern beim
Hervortreten der Figur, an anderen Gestaltmustern bei Auffassungsänderungen
erleben können. ...."
- 3) dort nicht gesperrt [hier fett]
[6] S.32
"Lipps behauptete nun, diese Gestalteindrücke, so wie wir sie
unmittelbar in der Wahrnehmung erleben, seien zunächst den
Netzhautbildern kongruent, enthielten alle Daten genau so in sich,
wie sie uns die Empfindungen liefern. ..."
_
[7] S.68
"... Denn ein Verschiedenheitsbewußtsein kann tatsäch-•
lich durch andere Momente oder Stücke eines Komplexes
verursacht werden als die, auf die es der Erlebende im
Urteil bezieht. ..."
_
[8] S.130
"... Das kommt
natürlich daher, daß wir reine Variationen des Größeneindrucks
an jeder Geraden beliebig herbeiführen und erleben können. ..."
_
[9] S. 235
"Das Pendant zu dem Hereinplatzen kann ich für mein Erleben
am besten bezeichnen als Absatz vor dem letzten Schlag, oder
als ein Abrücken dieses Schlags, weg von dem vorausgehenden."
_
Erlebnisklassen
Bei der Suche nach "Erlebnis" fiel mir auf, dass Bühler eine ganze
Reihe von Erlebnisklassen benennt, die er allerdings nicht ordentlich definiert
oder näher erläutert. Er gebraucht hier eine Erlebnispsychologie,
ohne sie systematisch aufzubauen. Viele von Bühlers Ideen werden wahrscheinlich
in einer künftigen und systematischen Erlebens- und Erlebnispsychologie
genutzt werden können.
Vorwort "neue Erlebniseinheiten"
S.10 "erschlossene Erlebnisse"
S.11.1 Relationserlebnis
S.11.2 Zitat Benussi "„ ... Die innere
Beobachtung gestattet nicht ohne weiteres, psychische Erlebnisse,
die uns Gestalten, und solche, die uns Verschiedenheiten
vergegenwärtigen, als zu einer Klasse psychischer Geschehnisse
gehörig anzusehen."2) ..."
S.13 "spezifisches Erlebnis"
S.14.1 ""kategorialen" Relationserlebnissen"
S.14.2 "kategoriale Beziehungserlebnisse"
S.17 "gefühlsartige Erlebnisse"
S.18.1 "Apperzeptionserlebnisse"
S.18.2 "Charakter der Gestalterlebnisse"
S.68.1 "fundierenden Erlebnissen"
S.68.2 "oder Erlebnismomenten"
S.68.3 "Erlebniskomlex"
S.68.4 "Verschiedenheitserlebnis"
S.132 "Übergangserlebnis"
S.157.1 "kommendes Erlebnis"
S.157.2 "besonderes Erlebnisstück"
S.165.1 "unterscheidbaren Erlebnissen"
S.165.2 "einziges Erlebnis"
S.167 "charakteristisches Erlebnis"
S.168.1 "Urteilserlebnis" (viele Erwähnungen auf anderen Seiten)
S.168.2 "dynamische Erlebnisse"
S.177 "subtilen Erlebnisse"
S.215 "Rhythmuserlebnis"
S.229 "g-Erlebnisse"
S.231 "bekannte Erlebnisse"
S.234 "eigentümliche Erlebnisse des Wiedererkennens"
S.235 "Erlebnis der Überraschung"
S.237 "... Die Erlebnisse sind sehr aufdringlich. Wenn sie auftreten,
ist
das Urteil sofort fertig und ganz sicher, neben ihnen wird selten
noch etwas anderes berücksichtigt. ..."
S.240.1 "motorische Erlebnisse"
S.240.2 "optische Erlebnisse"
S.240.3 "Erlebnis der Gleichheit"
S.257 "Erlebnis des Sichzusammendrängens der Schläge"
S.269 "Die Sache ist die, daß vor allem die Sicherheit der g-Urteile
sehr leidet, bei so kleinen Intervallen hat man das Erlebnis des
Absatzes vor dem letzten Schlag nicht mehr. ..."
S.275 "ähnliche Erlebnisse"
S.281 "modifizierte Urteilserlebnisse"
S.282 "normale Urteilserlebnisse"
S.291 "Beschleunigungserlebnisse"
Die geistige Entwicklung des Kindes-1918
Bühler, Karl (1918) Die geistige Entwicklung des Kindes. Verlag Gustav Fischer, Jena 1918.
Zusammenfassung-Geistige-Entwicklung-des-Kindes-1918:
Fundstellen: Ti-, IV+, SR+, T: e=32, E=106. Ein wichtiges Buch für
die Entwicklung des Erlebens und der Erlebnisse in der Kindheit. Im Inhaltsverzeichnis
gibt zwei Einträge zu Erlebnissen und im Sachregister werden vier
Erlebnisklassen (Aha-E., Begriffs-E., Gewißheits-E., Überzeugungs-E.)
eingetragen, aber nicht erleben oder das Erlebnis selbst. Ich habe die
ersten 11 Fundstellen "erleb" im Text von S.7-S.47, also 41 Seiten,
im Buch erfasst und dokumentiert, weil man erwarten darf, dass wichtigere
Begriffe dort definiert oder näher erläutert werden, wo sie die
ersten Male erwähnt werden (Regeln
Grundbegriffe). Eine ausdrückliche Definition oder nähere
Erläuterung zum Erleben oder zu den Erlebnisse habe ich bei den ersten
11 Erwähnungen, S.7-S.47 von "erleb" nicht gefunden, auch nicht durch
Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis. Man kann aber
aus dem Gebrauch im Kontext [4,5] schließen, dass erleben all das
ist, was sich im Bewusstsein ereignet und dort mit der inneren Wahrnehmung
vergegenwärtigt wird. Es werden aber auch unbewusste Mechanismen,
z.B. S. 236, erwähnt (unbewußt insgesamt 7x). Das Buch bietet
viele Anregungen und Ideen für die Erlebens- und Erlebnispsychologie.
_
Inhaltsverzeichnis-1918
§ 25. Zur Analyse der Denkprozesse 242
a) Über die Urteile 242
- Brentano und G. E. Müller 242. Das Erlebnis der Gewißheit
(belief) 243.
Die Natur der Gewißheitserlebnisse 251.
Sachregister 1918 (aber nicht erlebt oder Erlebnis als eigenen Eintrag):
- Aha-Erlebnis, das 280.
- Begriffserlebnis 318.
- Gewißheitserlebnis 243. 251. -, Ausgeprägtheit des 248
- Überzeugungserlebnis 295.
Text: e=32 (erleben + erlebt), E=106-
erleben 17 ohne Pseudos (Kinderleben, Thierleben, Negerleben), erlebt 15, Erlebnis 106.
Die ersten 11 Fundstellen "erleb" im Text 1918
[1] S.7
"... Wieweit sich für die Untersuchung der späteren Fortschritte
das
Reaktionsexperiment mit Instruktionen als fruchtbar erweisen wird,
läßt sich heute noch nicht voraussagen; vermutlich wird
die Unfähigkeit
des Kindes, uns direkte Mitteilungen über seine Erlebnisse
zu machen, ihm enge Schranken setzen. Denn ohne
Selbstbeobachtung ist dem Reaktionsversuch nur wenig zu entnehmen."
[2] S.21
"Die Anfänge des Seelenlebens.
Die allerersten Regungen psychischen Lebens haben verschiedene
Autoren schon beim Fötus im Mutterleib vermutet. Der
Embryo befinde sich, so stellen sie sich vor, in den letzten Monaten
der Schwangerschaft im allgemeinen in einem Zustand, der dem
eines tiefen, traumlosen Schlafes nicht unähnlich sei; dann und
wann
und schließlich häufiger aber werde dieser Zustand unterbrochen
durch dumpfe, gefühlsbetonte Sensationen. Das seien Empfindungen
oder empfindungsähnliche Erlebnisse der Haut-
und Muskelsinne,
die ausgelöst werden durch die Bewegungen, welche die Frucht
selbst ausführt (Beugungen und Streckungen des Rumpfes und der
Gliedmaßen) und durch die Bewegungen der Mutter und der mütterlichen
Organe, welche die Frucht umgeben.1) Es läßt sich nichts
Stichhaltiges gegen diese Annahme einwenden, verifizieren kann
man sie aber vorläufig nicht. "
[3] S.30.1-2
"Was das sei, das können wir Erwachsenen nicht mehr nacherleben,
weil eben alle unsere Erlebnisse
differenziert und tausendfach
in unser reiches psychisches Geschehen eingewoben sind. ..."
[4] S.31.1
"Wir fanden, es sei nicht unwahrscheinlich, daß das Kind
schon in seinen ersten Lebenstagen gewisse einfache Bewußtseinszustände
erlebe. ..."
[5] S. 31.2
"... Diese Zustände sind wohl zeitlich noch nicht
kontinuierlich aneinander gereiht; es gibt noch keinen ununterbrochenen
Zusammenhang des Bewußtseins beim wachenden Kind.
Vielmehr wird es so sein, daß die Erlebnisse
nur sporadisch aus
der Nacht der Bewußtlosigkeit aufleuchten, oder aber sich von
einem dunklen Hintergrund abheben, der einen gefühlsartigen Charakter
tragen mag. "
[6] S.45.1
"2. Unsere kompliziertesten Gedächtnisleistungen sind die Erinnerungen.
Wenn wir Erwachsenen uns innerlich einem Ereignis
zuwenden, das uns vor Tagen, Wochen oder Jahren zugestoßen
ist, dann steigt unter günstigen Umständen dies ganze vergangene
Ereignis noch einmal vor unserem geistigen Auge auf. Wir erleben
uns wieder in der Situation von damals, wir sehen und hören innerlich,
was vorgeht vielfach in der zeitlichen, räumlichen und logischen
Anordnung der Teile, die auch früher bestanden hat. ..."
[7] S.45.2
"... Denken wir uns diese bewußte Beziehung auf das Frühere
noch unbestimmter und noch weiter zurücktretend, dann kommen
wir zu dem, was man die Bekanntheitsqualität eines gegenwärtigen
Erlebnisses bezeichnet. ... "
[8] S.46.1
"... Das Kind durchläuft die Stufen
oder Phasen, die wir da abstraktiv gefunden haben, in Wirklichkeit
[>46]
als Entwicklungsstufen seiner Erinnerungsfähigkeit; durchläuft
sie
in dem Sinne, daß die unbestimmten Bekanntheits- (und Verschiedenheits-)
eindrücke zuerst, dann die Erlebnisse
des bestimmteren
Wiedererkennens und schließlich vollständige Erinnerungen
mit Lokalisation und Temporalisation bei ihm
konstatiert werden können."
[9] S.46.2
"Die ersten Objekte, denen gegenüber das Kind einen Bekanntheits-
oder Fremdheitseindruck erlebt,
sind die Gesichter der Menschen,
die es umgeben und die Räume, in denen es sich befindet.
Das zufriedene Lächeln, wenn sich die gewohnten Personen mit ihm
beschäftigen, auf der einen Seite, der starrende Blick, die Abwehrbewegungen
und das Unlust verratende Schreien, wenn sich fremde
Personen ihm nähern und sich mit ihm abgeben wollen, auf der
anderen Seite, das sind die Zeichen, aus denen man auf das Vorhandensein
von Bekanntheits- und Fremdheitseindrücken schließt."
[10] S.46.3
"Die ersten Bekanntheitseindrücke und die ersten Akte des
Wiedererkennens beziehen sich immer nur auf Dinge, die das
Kind dauernd umgeben, gründen sich also auf zeitlich eng
gereihte Ketten von Erlebnissen.
Unterbrechungen von wenigen
Wochen schon genügen, um dem Kinde Menschen und Räume
zu entfremden. Man hat festzustellen versucht, welche Zeitstrecken
unter günstigsten Umständen gerade noch »überbrückt«
werden können, und gefunden, daß sie sich noch im zweiten
Halbj ahr nach Tagen bemessen lassen und sich nur in Ausnahmefällen
auf zwei oder gar drei Wochen ausdehnen. ..."
[11] S.47
"... Affektbetonte Erlebnisse sind
in erster
Linie dazu geeignet; Gegenstände, welche mit den kleinen Unfällen
des Kindes irgendwie im Zusammenhang stehen, Personen, die ihm
einmal einen Schmerz zugefügt oder eine ungewöhnliche Freude
bereitet haben, werden nach Tagen und Wochen noch wiedererkannt
und entsprechend behandelt. ..."
Erscheinungsweisen der Farben
Bühler, Karl (1922) Die Erscheinungsweisen der Farben. Jena: Gustav Fischer.
Zusammenfassung-Farben-1922: Es gibt in dem 209 Seiten Text nur wenige Fundstellen: erleben 0, erlebt 2, Erlebnis 1. In dem Werk werden erlebt und Erlebnus nur gebracuht, aber nicht definiert oder näher erläutert, auch nicht durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.
S.4
"... Dagegen wurde eingewandt, daß doch ein
objektives Ding, das seine Entfernung vom Auge irgendwie beträchtlich
ändere, zunächst mit Zerstreuungskreisen erscheine, und
daß es erst nach einer Änderung der Akkommodation, die sich
auch für das Bewußtsein als Empfindung bemerklich mache,
wieder scharf
gesehen werde. Freilich ist das so, aber was haben solche
Akkommodationsempfindungen an sich und ursprünglich mit Räumlichkeit
zu tun? Durch Erfahrung kommt eine Beziehung zwischen
beiden zustande, gewiß ; aber ihrem Wesen nach stehen beide als
disparate Erlebnisse lediglich nebeneinander."1)
Die Natur hat
aber eine bessere, elegantere Lösung gefunden; wenn die zwei
Augen des Menschen wie ein Organ funktionieren, das die geringfügige
Querdisparation der beidseitigen Netzhautbilder ausnützt_
oder wenn nach Hering bereits den Sinnespunkten des Einauges
verschiedene Tiefenwerte physiologisch zugeordnet sind, dann bleibt
freilich B e r k e l e y s Ansatz, daß die Tiefenwahrnehmung
über die
Leistung der zweidimensionalen Punktordnung der Netzhaut als
solcher hinausgeht, zurecht bestehen, ist aber aufgehoben in einer
Betrachtung der Gesamtleistung des Sehorganes, die ja keineswegs
als schlichte Summe isoliert gedachter Punktleistungen aufgefaßt,
werden muß. ... "
- 1) Formulierung von E b bin gh aus, Grundzüge der
Psychologie S. 476.
Die berühmte sect. 2 in der „theory of vision" lautet: It is, I think, agreed by
all that distance of itself, and immediately, cannot be seen. For distance being a.
line directed endwise to the eye, it projects only one point in the fand of the
eye — which point remains invariably the same, whether the distance be louger
or shorter."
S.44
"... Hering zog aus seiner Beobachtung den Schluß, es sei mit
dem Grün vor Rosa offenbar so wie man es sonst wohl auch beim
binokularen Wettstreit oder bei anderen widerstreitenden Eindrucksbedingungen
erlebt d. h. an einigen Stellen überwiege bei unreinem
Glase usw. das Grün, an anderen das Rosa, so daß eigentlich der
Eindruck einer gesprengelten Fläche entstehen müßte. Geschehe
dies nicht, so sei die ergänzende Vorstellungstätigkeit mit im Spiel,
die nach Lage der dem Beobachter ja bekannten Versuchsbedingungen
die Grünflecke und die Rosaflecke je zu einer lückenlosen
Fläche ergänzen. Was in Wahrheit gesehen wird, empfunden
wird, sind nicht zwei lückenlose Farbflächen hintereinander. Fallen
aber die Unregelmäßigkeiten hinweg, dann hat die Phantasie keinen
Anhalt mehr zu einer Spaltung der einheitlichen Empfindung. Fazit :
Rein wahrnehmungsmäßig, rein reizbedingt ist das
Hintereinander von Farborten nicht."
_
S.170:
".... Ferner, daß der Glanz
ein Mittleres ist zwischen vollkommener Spiegelung und diffuser Reflexion,
daß das überschüssige Licht des Glanzes dem Spiegelding
genommen, sozusagen von der Kohärenzfläche eingefangen und mit
ihr flächig ausgespannt wird, hat Wundt richtig aufgespürt und
ahnend beschrieben; aber eine Angelegenheit komplexer „Vorstellungsbildung",
wie er meint, ist dies nicht. Sonst bliebe mit
das Auffallendste besonders am bewegten Glanz unverständlich; ich
meine außer dem unmittelbar erlebten Charakter einer rein reizbedingten,
von Vorstellungszutaten nicht wesentlich beeinflußten Erscheinung,
die ungedämpfte, kaleidoskopische Vielgestaltigkeit und
Beweglichkeit des Phänomens."
Ende Erscheinungsweisen der Farben
Artikel Die Krise der Psychologie (1926)
Bühler, Karl (1926) Die Krise der Psychologie. Kantstudien XXXI, 455-526. [72 Seiten]
Fundstellen Erleben 9, erlebt 9, Erlebnis 69.
Ti-, IV-, SR+, T: e=18, E=69; defin=9.
Zusammenfassung-Bühler1926-Krise-Artikel:
Die Arbeit in den Kantstudien zur Krise der Psychologie ist ein Jahr vor
der Buchveröffentlichung erschienen. Sie wurde nach erleben, erlebt,
Erlebnis und nach defin durchsucht: Ti-, -IV, -SR, T: e=18, E=69; defin=9,
womit Verständnis und Gebrauch Definition, definieren, definiert von
Bühler in dieser Arbeit erfasst wird. Das ist auch interessant hinsichtlich
einer Zusammennennung mit erleben und Erlebnis. Geht man die jeweils 9
Fundstellen zum Erleben und erlebt durch (meist mit Bezug zu Spranger),
findet man keine Definition oder nähere Erläuterung, auch nicht
durch Fußnote, Anmerkung, Querverweis, Literaturhinweise durch die
Bezugnahmen auf Spranger. S.458: "Die derart gestellte Sinnfrage
aber führt konsequent erstens zu neuen Aufgaben der deskriptiven Bestimmung
der Erlebnisse und zweitens zu spezifisch teleologischen Verlaufsgesetzen
des seelischen Geschehens." S.459 spricht vom "Endziel der Psychologie
als der Wissenschaft von den Erlebnissen." Bühler verheddert
sich in die Sinnfrage und kommt dadurch nicht weiter. Kryptisch und offen
bleibt die These S. 473: "... niemand kann letzten Endes darüber Aufschluß
geben, was Sinn eigentlich ist, außer der Erlebnispsychologie." S.
486 spezifiziert: "... Erlebnisanalysen von Affekt- und Willensverläufen,
... ". Die Seite 458 angesprochene Aufgabe der deskriptiven Bestimmung
der Erlebnisse erfüllt Bühler an keiner Stelle. Er bleibt wie
die meisten Erlebensforscher im Allgemein-Abstrakten und er fällt
im Grunde deutlich hinter Brentano zurück.
Fundstellen Erleben und erlebt Bühler 1926
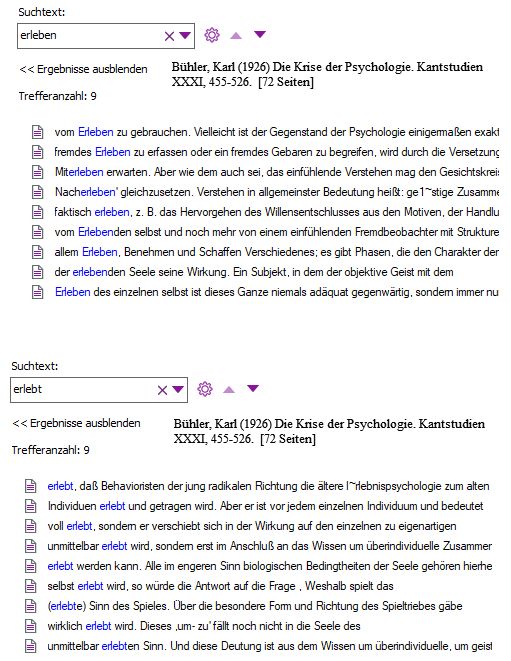
Fundstellen Bühler1926
Erlebnis
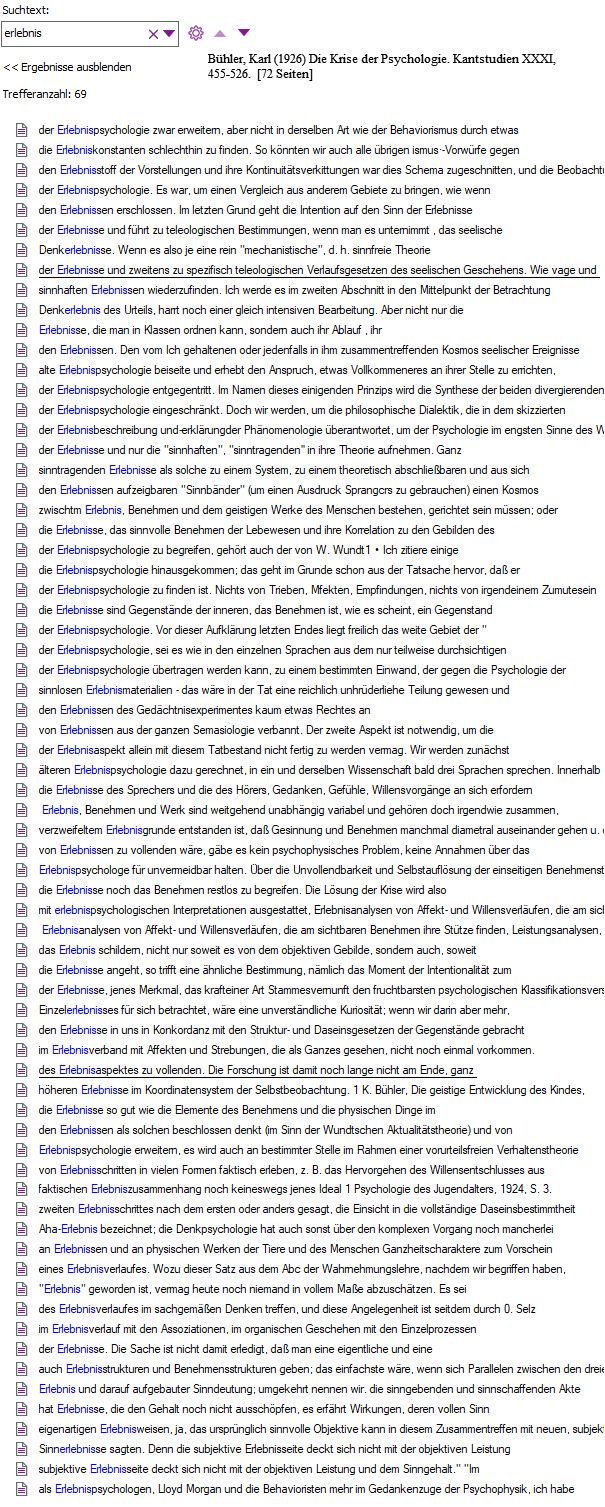
_
Buch Krise der Psychologie (1927) Kürzel B1927
Bühler, Karl (1927) Die Krise der Psychologie. Verlag Gustav Fischer, Jena 1927. [212 Seiten ohne Registerseiten]
Fundstellen in B1927: erleben 52, erlebt(e,n) 13, Erlebnis 160.
In der 2. unveränderten Auflage von 1929 schreibt er in seinem
Vorwort, wobei in den vier Axiomen in I, II und IV Erlebnis erwähnt
wird :
- "Der Text ist unverändert geblieben, ich möchte zwei Hinweise
und eine neue Formulierung hier im Vorwort unterbringen.
Eine Fortbildung der Theorie des Kinderspieles, die im Mittelpunkt meiner Kritik der Psychoanalyse steht, ist in dem Buche C h. Bühlers „Kindheit und Jugend" 1928 zu finden; das ist das eine. Die Fruchtbarkeit der Dreiaspektenlehre hat sich bewährt in einer „Theorie der tierischen und menschlichen Handlung", an der ich arbeite; das ist das andere. Die neue Formel erfaßt den Gehalt der klassischen Assoziationstheorie. Es sind, kurz gesagt, die folgenden vier Axiome, um die es geht bei der Auseinandersetzung der neueren Richtungen in der Psychologie mit jener (systematisch nie zu Ende gedachten) Lehre, die mit Locke und Hume anhob und um 1890 kulminierte:
I. Das subjektivistische Axiom: Der einzige legitime Ausgang der Psychologie ist die Selbstbeobachtung; ihr Gegenstand
sind die Erlebnisse.
II. Das atomistische Axiom: Die Analyse der Erlebnisse findet fest umschriebene elementare Bewußtseinsinhalte; die sogenannten verwickelten oder höheren Phänomene sind Komplexionen aus ihnen.
III. Das sensualistische Axiom: Genetisch originäre Inhalte sind nur die Sinnesdaten mit Einschluß der ‚elementaren' Gefühle.
IV. Das mechanistische Axiom: Die Bildung der Komplexionen und der Erlebnisverlauf unterstehen dem Kontiguitätsgesetz, dem Assoziationsprinzip; es gibt Simultan- und Sukzessionsverkittungen. Gegen das eine oder andere dieser Axiome wendet sich jede von den neuen Richtungen; die Denkpsychologie z. B. speziell gegen III und IV; die Gestaltpsychologie gegen II und IV; der Behaviorismus gegen I; die geisteswissenschaftliche Psychologie mehr oder weniger gegen alle, speziell aber gegen I und IV.
Wien, im Februar 1929.
Karl Bühler."
Fundstellen in B1927: erleben 52, erlebt 13, e=65.
Zusamenfassung Erleben in B1927 : erleben wird im Text 52x erwähnt. Weden im Inhaltsverzeichnis noch im Sachregister wird ein Eintrag "erleben" geführt. Ich habe die ersten 13 Erwähnungen im Text von S. 17 bis Seite 84 erfasst und dokumentiert. Nirgendwo wird erleben erklärt noder näher ausgeführt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis, so dass ich davon ausgehe, dass Karl Bühler erleben für einen nicht weiter erklärungs- oder begründungspflichtigen, sondern für einen allfemeinverständlichen Grundbegriff hält.
Erleben im Text B1927:
- 17: "... Die Psychologie war seit Descartes und Locke gedacht als die Wissenschaft von den Erlebnissen, als eine Theorie dessen, was der sogenannten inneren Wahrnehmung, der Selbstbeobachtung, zugänglich ist. Jeder hat sein eigenes Ich und sein Gesichtsfeld der inneren Wahrnehmung, in das ihm kein Nachbar unmittelbar hineinschauen kann. So war die Psychologie ihrem Ausgangsgegenstand nach eine solipsistisch aufgebaute Wissenschaft. Mit dem ABC der Psychologie haben wir modernen Europäer diese Überzeugung von der Prärogative der inneren Wahrnehmung in uns aufgenommen. „Um die Psychologie scharf zu definieren, müssen wir ausgehen von einer ganz grundsätzlicheh Feststellung, auf welcher alle Philosophie (und alle Wissenschaft) ruht, nämlich von der Feststellung les unauflösbaren schlicht hinzunehmenden Ur -Sachverhaltes: Ich habe bewußt etwas, oder kurz: ich weiß etwas, und zwar, indem ich zugleich weiß, daß ich weiß — scio me scire (Augustinus)"1). An diesem Ausgang wird nichts geändert, wenn man beim Ausbau der Wissenschaft Hypothesen über die Seelensubstanz wie Descartes oder über das Unbewußte wie Freud einführt. Nichts geändert an dem solipsistischen Ausgang, wenn man nachträglich vom Ich zum Du und zu Annahmen über fremdes Erleben und fremdseelisches Geschehen fortschreitet."
- 51f: "... Wir wollen uns zu diesem Zwecke die Vorgänge, welche sich in der Bienenseele abspielen mögen, so weitgehend menschlich, so weitgehend nach Analogie unseres eigenen Sprach-[>52]erlebens vorstellen, als es die Tatsachen irgend zulassen. ..."
- 65f: "Es gibt Steuerungen [> 66] auch an toten Systemen, man kann ihr Vorhandensein und ihre Richtpunkte, auch ohne von vornherein bestimmte Annahmen über den Steuermann zu treffen, bestimmen. ... Und nichts hindert, diesen Begriff in gleicher Weise vom Benehmen und vom Erleben zu gebrauchen. Vielleicht ist der Gegenstand der Psychologie einigermaßen exakt durch diesen Begriff zu charakterisieren. ..."
- 70: "So sei denn versucht, dieselbe Harmonie der Theoretiker auch für die Kehrseite der Medaille anzubahnen. Spranger
- 73-1: "... Offenbar besteht hier ein ziemlich weiter Spielraum. Ich kann das Gebilde erleben rein als l'neare Gestalt; dann kommt es psychologisch auch nur auf das bedeutungsfreie Sehen an (von mir gesperrt): auf .die subjektive
- 73-2: "... Ich kann aber, ohne dabei zu verweilen, es sofort erleben mit der Bedeutung: Buchstabe H oder, wenn ich im griechischen Geisteszusammenhang lebe, mit der anderen: Buchstabe Eta. ..."
- 81f: "...Was wir in unseren eigenen Wahrnehmungen z. B. als Konstanz der Sehdinge im Beleuchtungswechsel oder als Größenkonstanz der Sehdinge im Entfernungswechsel vorfinden, ist nach allem, was wir darüber wissen, keine [>82] auf das menschliche Erleben eingeschränkte, vom Menschen neu erworbene, Verfassung, sondern ein Gemeinbesitz zum mindesten
- 83-1: "Hier aber nehmen wir unseren Ausgang von der Grundtatsache des seelischen Kontaktes und suchen erst einmal das, was im seelischen Kontakt an Möglichkeiten des Verstehens angelegt ist, begrifflich scharf zu erfassen. Max Scheler, der bahnbrechende Denker auf diesem Gebiet, hat die kühne These von einer Art Wahrnehmbarkeit des fremden Erlebens im seelischen Kontakte aufgestellt und Widerspruch gefunden. Das ist der gegenwärtige Stand der Diskussion1). ..."
- 83-3: "... Daß das Benehmen gesteuert wird, ist eine Feststellung der Außenansicht, des behavioristischen Aspektes; daß das Erleben gesteuert wird, wissen wir aus eigener innerer Erfahrung und nehmen es darüber hinaus auch von anderen Menschen und von Tieren an, deren Benehmen wir in Kontaktsituationen gesteuert sehen. Genau betrachtet ergibt sich, daß eine Koppelung der beiden Aspekte, ein Ineinandergreifen, bereits im Ausgangstatbestande vorliegt und unaufhebbar ist. ... "
- 84-1: "Der Sachverhalt im ganzen ist jedem aus dem seelischen Verkehr mit anderen Menschen bekannt und geläufig. Man steht im Kontakt mit dem Partner der Situation und versteht sein Benehmen; fast so im günstigsten Fall, als wäre er gar nicht ein anderer, sondern „als wärs ein Stück von mir", wie es im Liede vom guten Kameraden heißt. Man vermeint aber nicht nur das sinnlich wahrnehmbare Benehmen, sondern darin, daraus, dahinter, oder wie sonst man sich ausdrücken mag, die Beseeltheit (oder im besonderen Fall auch einmal die Unbeseeltheit) des fremden Benehmens und sogar das Erleben des anderen mehr oder minder unmittelbar zu erfassen. ..."
- 84-2: "... Der solipsistische Aspekt der Psychologie, der diesen Tatbestand programmgemäß nur in dem Einerkoordinatensystem der ichhaften Ereignisse zu beschreiben und zu begreifen versucht, macht irgendwie aus zwei eins. Die naive Bestimmung dagegen kennt mein und dein, ob sie vom Benehmen oder Erleben spricht. ..."
- 84-3: "... Die solipsistische Theorie nimmt in ihrem ersten Ansatz entweder das fremde Erleben in das Ich herüber oder läßt umgekehrt das Ichhafte, wie wenn es irgendwie entfremdet wäre, in der Sphäre des Partners stattfinden. Man versetzt sich selbst, so wird uns im Sinne der zweiten Formel gesagt, fiktiv in die Lage des anderen, um ihn zu verstehen. Das Bild müßte für viele Fälle noch intimer sein; bald in die Haut, will sagen in die Sinne, bald in die Muskeln, will sagen in den Bewegungsapparat, bald ins Erlebniszentrum des andern versuche man sich mit mehr oder minder gutem Erfolge zu versetzen und nehme dann mit ihm wahr, bewege mit ihm seine Glieder, spreche, entscheide sich, handle aus dem besetzten Erlebniszentrum heraus. ..."
- 84-4: "... Umgekehrt, im Sinne der ersten Formel, bestimmt die Aktivität und Führereigenschaft des anderen unser eigenes Erleben, unsere primär ichhaften Erlebnisse derart, daß wir an ihnen abzulesen vermögen, wie es dem Partner zumute ist. ..."
schlägt eine Basis vor: „Wäre die Biopsychologie und ihre Erweiterung zur Entwicklungspsychologie schon weiter ausgestaltet,
als es heute, besonders in Deutschland, der Fall ist, so würde die Differenz zwischen naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Psychologie im definierten Sinne weniger auffallend sein als jetzt, wo bisweilen der Übergang von der Sinnespsychologie etwa zur Psychologie des ästhetischen Erlebens und Verhaltens beinahe sprunghaft erfolgt. ..."
Verschiebung, Größe, Helligkeit, Deutlichkeit oder Undeutlichkeit des Bilderlebnisses. ..."
des ganzen Wirbeltierstammes.
83-2: "... Ich will zeigen, daß Scheler im wesentlichen recht hat; wir können seine These so interpretieren, daß die Paradoxie verschwindet und eine Erkenntnisart des Fremdseelischen zum Vorschein kommt, für die der Ausdruck „Wahrnehmung" durchaus gebräuchlich ist. Faktum ist, daß im seelischen Kontakte eine gegenseitige Steuerung des Benehmens und des Erlebens der Partner stattfindet. ..."
Erleben-Pseudos in B1927
:
45: Tierleben
Erlebnis in B1927 Inhaltsverzeichnis
- Sachregister - Text
Ti-, IV+, SR+, T: e=49, E=143.
Zusamenfassung-Erlebnis-in-B1927: "Erlebnis" wird 160x erwähnt. 4x im Inhaltsverzeichnis, 13x im Sachregister und 160x im gesamten Text. Erleben im gesamten 49 (ohne drei Pseudos Kinderleben). In den 29 dokumentierten Fundstellen S.2-29 wird der Begriff Erlebnis nicht erklärt oder näher charaktersiert, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. Ich gehe daher davon aus, dass Karl Bühler den Begriff nicht für erklärungs- oder begründungsbedürftig hält und als allgemeinverständlichen Grundbegriff gebraucht.
Erlebnis im Inhaltsverzeichnis B1927:
- 3. Das alte Programm der Erlebnispsychologie 17.
- § 4. Der Erlebnisaspekt in der Sprachtheorie 30
- Ernst- und Scheinerlebnisse, Vergleich mit dem Schauspieler 98.
- Kindheitserlebnisse und Charakter, Stufen und Phasen in der Sexualentwicklung 174.
Erlebnis im Sachregister B1927:
- Erlebnis 28f.
Erlebnisaspekt
- Ich und Du im E. 100.
- in d. Sprachtheorie 30 ff.
Notwendigkeit des E. 60, 67.
- u. Verstehen 101.
- Einseitigkeit der E. 64.
solipsistischer Ausgangspunkt der E. 17.
- u. Behaviorismus 22.
- u. Denkpsychologie 13.
- u. Semantik 50.
Erlebnis im Text B1927:
- 2: "§ 1. Der Impressionismus und die klassische Assoziationspsychologie um 1890. Merkwürdig, wie manchmal Überkommenes und Neues sich mischt, um eine Einheit zustande zu bringen. Hume und
- Herbart waren da, aber es bedurfte eines zeitbedingten Grunderlebnisses bei E. Mach , um eine Physik und Psychologie um-[>3]schließende Weltanschauung aus dem alten Gedankengut neu erstehen zu lassen. ... "
- 3: Machs philosophisches Grunderlebnis: "„Ich habe es stets als ein besonderes Glück empfunden, daß mir sehr früh (in einem Alter von 15 Jahren etwa) in der Bibliothek meines Vaters Kants „Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik" in die Hand fielen. Diese Schrift hat damals einen gewaltigen, unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht, den ich in gleicher Weise bei späterer philosophischer Lektüre nie mehr gefühlt habe. Etwa 2 oder 3 Jahre später empfand ich plötzlich die müßige Rolle, welche das »Ding an sich« spielt. An einem heißen Sommertage im Freien erschien mir einmal die Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend. Obgleich die eigentliche Reflexion sich erst später hinzugesellte, so ist doch dieser Moment für meine ganze Anschauung bestimmend geworden. Übrigens habe ich noch einen langen und harten Kampf gekämpft, bevor ich imstande war, die gewonnene Ansicht auch in meinem Spezialgebiete festzuhalten." (A. d. E. 6. Aufl. S. 24 Anm. Die Auszeichnung von mir. Das geschilderte philosophische Grunderlebnis Machs fällt in das Jahr 1855 oder 1856.)"
- 9: "... Zwei Psychologien nebeneinander, die eine als die Lehre vorn sinnerfüllten Leben und die andere als die Lehre von den an sich sinnlosen Erlebnismaterialien — das wäre in der Tat eine reichlich unbrüderliche Teilung gewesen und keiner der beiden „Wissenschaften" auf die Dauer gut bekommen. ..."
- 12: "... Denkpsychologie und Psychoanalyse — ihre Methoden sind sehr verschieden. Dort wird der größte Wert auf Protokolle, auf eine sorgfältige Festlegung des Erlebnistatbestandes, von dem man ausgeht, gelegt; hier ist alles zugerichtet auf Indizienbeweise, auf ein mehr oder minder scharfsinniges Detektivverfahren. Nun, jedes an seinem Platze. ..."
- 13: "... Gleichviel, wie man heute über viele Einzelheiten denken mag, jenes Programm verlangte klar und zwingend eine bestimmte Umstellung der Interessen der Erlebnispsychologie. ..."
- 14-1: "... Ich will hier nicht beschreiben, wie und in welchem Ausmaß das Programm in der neuen Psychologie des Willens und des Denkens verwirklicht worden ist; jedenfalls war mit ihm das einfache Schema der klassischen Assoziationstheorie durchbrochen und ein neuer Horizont für die Wissenschaft von den Erlebnissen erschlossen."
- 14-2: "Im letzten Grund geht die Intention auf den Sinn der Erlebnisse und führt zu teleologischen Bestimmungen, wenn man es unternimmt, „das seelische Leben und Weben in sich selbst zu erfassen, die qualitativen Unterschiede im psychischen Verhalten, in der Art und Weise, wie der seelische Organismus arbeitet" (Stumpf), zu begreifen."
- 14-3: "Dessen war sich die Denkpsychologie von Anfang an klar bewußt; in meiner ersten Arbeit 1907 z. B. steht ausdrücklich der Satz vom teleologischen Charakter der Denkerlebnisse. Wenn es also je eine rein „mechanistische", d. h. sinnfreie Theorie des Seelenlebens gab, so war die Abwendung von ihr bereits vor zwei Dezennien vollzogen."
- 14-4: "Die derart gestellte Sinnfrage aber führt konsequent erstens zu neuen Aufgaben der deskriptiven Bestimmung der Erlebnisse und zweitens zu spezifisch teleologischen Verlaufsgesetzen des seelischen Geschehens. Wie vage und formelhaft waren doch die seit Lockes und Humes Zeiten überlieferten deskriptiven Grundbegriffe „Wahrnehmung", „Vorstellung", „Gefühl" usw. in der Assoziationstheorie stehen geblieben!"
- 14-5: "Wenn die neue Beschreibung das empfindungsmäßige Bild von dem gedanklichen Gehalt einer Vorstellung unterschied, so konnte sie sich dabei vor allem auf die an der Sprache klar erkennbare und nie verkannte Zweiheit von Klangbild und Wortbedeutung stützen; diese Analogie und das an ihr abzulesende komplexe Verhältnis von Zeichen und Bedeutung ist in den mannigfachsten Modifikationen an allen sinnhaften Erlebnissen wiederzufinden. Ich werde es im zweiten Abschnitt in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen und darum hier nicht weiter behandeln."
- 14f: "... Störring und Lindworsky, auf die weit ausholenden Untersuchungen über Gestalten und die Relationswahrnehmung nur kurz verwiesen. Anderes, z. B. das weite Gebiet der Affekte und das zentrale [>15] Denkerlebnis des Urteils, harrt noch einer gleich intensiven Bearbeitung.
- 15: "... Aber nicht nur die mehr oder minder scharf abgrenzbaren einzelnen Erlebnisse, die man in Klassen ordnen kann, sondern auch ihr Ablauf , ihr Kommen und Verschwinden in geschlossenen Reihen und Verbänden, ist sinnerfüllt und sinnbestimmt in einer Art, der die Assoziationstheorie mit ihren Mitteln nicht gerecht werden konnte."
- 17: "3. Machen wir uns klar, daß von all dem der Aufbau und die alten Ringmauern der Psychologie nicht angetastet werden. Die Psychologie war seit Descartes und Locke gedacht als die Wissenschaft von den Erlebnissen, als eine Theorie dessen, was der sogenannten inneren Wahrnehmung, der Selbstbeobachtung, zugänglich ist. Jeder hat sein eigenes Ich und sein Gesichtsfeld der inneren Wahrnehmung, in das ihm kein Nachbar unmittelbar hineinschauen kann. So war die Psychologie ihrem Ausgangsgegenstand nach eine solipsistisch aufgebaute Wissenschaft."
- 18 (§ 3. Der Behaviorismus und die geisteswissenschaftliche Psychologie): "... Für die Amerikaner bedeutet es vielleicht einen Wendepunkt in ihrer kurzen Wissenschaftsgeschichte, daß sie sich von der Erlebnispsychologie weg dem englischen Einfluß erschlossen und das hier Empfangene in großem Stile auszubauen begonnen haben. Der Behaviorismus ist im Augenblick mehr als irgend etwas anderes ihre Angelegenheit und wird, wenn ich recht sehe, in bestimmten Grenzen auch unsere werden müssen."
- 19: "Merkwürdig genug und doch nicht unbegreiflich ist der Sachverhalt, daß das biologisch Erste im Menschen, das, was uns mit den Tieren gemeinsam ist, und das Sublimste, das, was uns zu Bürgern macht im Reiche des Sittlichen nicht nur, sondern auch in dem des Wahren, Schönen und aller anderen Werte, daß beides aus dem Erlebnisaspekt allein nicht verstanden werden kann."
- 22-1: "... Der Behaviorismus schiebt die alte Erlebnispsychologie beiseite und erhebt den Anspruch, etwas Vollkommeneres an ihrer Stelle zu errichten, eine Wissenschaft vom Benehmen, von den objektiv zu bestimmenden Verhaltungsweisen der Tiere und Menschen. ..."
- 22-2: "... Es ist gewiß kein Zufall, daß uns diese Wendung ins Teleologische genau so aus dem Schoße des Behaviorismus wie aus der Erlebnispsychologie entgegentritt. ..."
- 22-3: "... Im Namen dieses einigenden Prinzips wird die Synthese der beiden divergierenden Forschungsrichtungen vollzogen werden müssen. Und genauer besehen, ist sie tatsächlich schon vorbereitet, denn der Grundbegriff der psychischen Operationen bleibt nicht unübertragbar auf die Sphäre der Erlebnispsychologie eingeschränkt."
- 23-1,2 (Dilthey): "... Beim „Verstehen" und dem Strukturbegriff (§ 10) werden wir ihm wieder begegnen; wer aus einem seiner vollendetsten Bücher, aus „Erlebnis und Dichtung" den Begriff des (schöpferischen) Erlebnisses zum Ausgang wählt, findet Ideen darin, die noch kaum ausgeschöpft, geschweige denn überholt sind1). Von all dem sei hier abgesehen, um eine andere Leitlinie zu verfolgen, die, wie mir scheint, den spezifischen Gehalt und Charakter des geisteswissenschaftlichen Aspekts der Psychologie reiner und vollständiger als sonst etwas zu definieren vermag."
- 23-2 (Fußnote): "1) Vgl. dazu Charlotte Bühler, Der Erlebnisbegriff in der modernen Kunstwissenschaft. Vom Geiste neuer Literaturforschung. (Festschrift für O. Walzel) 1924, S. 195 ff."
- 26-1: "... Schon Hegel hat die in seinem System vorgeordneten Aufgaben der Psychophysik der Anthropologie, die Aufgaben der Erlebnisbeschreibung und -erklärung der Phänomenologie überantwortet, um der Psychologie im engsten Sinne des Wortes eine neue, systemhöhere Aufgabe zu stellen. ..."
- 26-2: "... Viele von den Neueren folgen ihm wenigstens in dem einen Punkt, daß sie eine Auslese treffen aus dem Material der Erlebnisse und nur die „sinnhaften", „sinntragenden" in ihre Theorie aufnehmen.
- 26-3: Ganz so schroff schematisch wie bei Hegel tritt die Teilung zwar nicht mehr auf. Aber immer noch die Voraussetzung und das Vertrauen, daß sich die sinntragenden Erlebnisse als solche zu einem System, zu einem theoretisch vollendbaren und aus sich begreifbaren Ganzen zusammenschließen, und daß man Lücken in diesem Ganzen hypothetisch zu überbrücken berechtigt sei durch die Annahme von sinntragenden Dispositionen, wenn ich mich kurz so ausdrücken darf. ..."
- 26-4: Das Neue besteht nun darin, daß man erstens diese Verflechtungen zum Ausgangsgegenstand der Psychologie wählt und zweitens die axiomatische Voraussetzung macht, daß die in den Erlebnissen aufzeigbaren „Sinnbänder" (um einen Ausdruck Sprangers zu gebrauchen) einen Kosmos bilden, jene Kohärenz und Geschlossenheit aufweisen, die man von den Gegenständen eines Gebietes voraussetzen muß, um den Versuch einer einheit-[>27]lichen Theorie für aussichtsreich zu halten. Die Sinnbändertheorie macht diesen interessanten Versuch, wir werden sehen, mit welchen Erfolgen."
- 27: "Das Verhältnis der Theorien zueinander. Die Psychologie soll ihre Schicksalsstunde, die zweite seit hundert Jahren, nicht versäumen. Kontakt, Kritik und Antwort sind lebensnotwendig für jede fortschreitende Wissenschaft, sie sind das erste, was wir wiederherstellen müssen, um unsere Krise zu lösen. Wir haben es erlebt, daß Behavioristen der jungradikalen Richtung die ältere Erlebnispsychologie zum alten Eisen warfen, daß Interpretationspsychologen den Namen Psychologie für ihr Unternehmen ganz allein „zurückgefordert" haben, während Psychophysiker und sonstige Experimentatoren in ihren Laboratorien sich peinlich frei zu halten strebten von den „Systemdichtern" und sonstigen „Spekulanten" aus dem Lagerder „Geistreichen und Schönschreiber". ..."
- 29: "II. Die drei psychologischen Aspekte. Wie ist Psychologie möglich? So würde Kant in unserer Lage fragen. Es obliegt in der Tat dem Philosophen, bald über die Möglichkeit, bald über die Notwendigkeit des Gegebenen nachzudenken. Und wir bedürfen der philosophischen Besinnung auf unsere Axiomatik, ihren Charakter und ihre Tragfähigkeit. Es ist eine Art transzendentaler Deduktion im Sinne Kants, die notwendig ist und hier erstrebt wird. Ich stelle die These auf, daß jeder der drei Aspekte möglich und keiner von ihnen entbehrlich ist in der einen Wissenschaft der Psychologie. Denn jeder von ihnen fordert die beiden anderen zu seiner Ergänzung, damit ein geschlossenes System wissenschaftlicher Erkenntnisse zustande kommt. Aus jedem von ihnen entspringen eigene, der Psychologie unentbehrliche Aufgaben, die sinnlos oder unlösbar werden, wenn man ihn aufgibt. Zum Ausgangsgegenstand der Psychologie gehören also die Erlebnisse, das sinnvolle Benehmen der Lebewesen und ihre Korrelationen mit den Gebilden des objektiven Geistes. Zum philosophischen Problem wird dann die Frage, ob und zu welcher noch unbenannten Einheit diese drei Ausgangsgegenstände als konstitutive Momente gehören oder hinführen."
Ausdruckstheorie-1933
Bühler, Karl (1933) Ausdruckstheorie. Das System an der Geschichte aufgezeigt. Verlag Gustav Fischer, Jena 1933.
Aus dem Vorwort zum Verständnis:
"Die Inhaltsangabe sei lang und dasVorwort kurz in diesem Buche,
um anzudeuten, daß darin von vielem die Rede ist, aber nicht
anders, als es das Thema selbst erfordert und rechtfertigt.
Die Geschichte der Ausdruckslehre läßt in großem Zuge
ihr sachgerechtes
System aufscheinen; das ist die tragende Behauptung des Buches.
Es gibt, wie ich glaube, nur einen Punkt, der einer Aufklärung
im
voraus bedürftig ist, das auf den ersten Blick überraschende
Faktum
nämlich, daß hier der Ausdruck als eine Art von Sprache
behandelt
wird, aber der sprachliche Ausdruck kat'
exochen des Menschen in
den Hintergrund verschoben bleibt; ungefähr so, wie es durch die
ganze Geschichte der Ausdruckslehre in der Regel gehalten worden ist.
..."
Zusammenfassung-Erleben-in-der-Ausdruckslehre-1933:
Fundstellen:
Ti-, IV-, SR+, T: e=29, E=69. erleben 22 (ohne 4 Pseudos); erlebt 7, Erlebnis
69. Zur genauen Analyse habe ich die ersten 10 lücklosen Fundstellen
von S. 10 bis S. 147, also 138 Seiten erfasst und dokumentiert. An keiner
Stelle wird erleben definiert oder näher erläutert, auch nicht
durch Fußn ote, Anmerkung, Querverweis oder Literaturhinweis.
Die ersten Textstellen "erleben" ohne Lücken
[1] S.10: ""In unserem Falle aber erschwert ein bemerkenswerter Umstand
die
Aufgabe des rückblickenden Historikers, sich für seinen
Helden mit bestem Könneneinzusetzen. Der Umstand nämlich,
daß jene experimentelle Arbeit stärker als gewöhnlich
der Veri-
fikation eines ansich imponierend großzügigen Modells gewidmet
war. Einer Psychophysik, einer Idee vomVerhältnis des Erlebens
zu den ,,körperlichen Begleitvorgängen", die ursprünglich
nicht für
den ,Ausdruck', sondern ,für den Eindruck' (kurz gesagt) ersonnen
war und dann erst spiegelbildlich sozusagen auch dem Ausdruck
übergeworfen worden ist. Ob der Ausdruck dies für einen anderen
angemessene Kleid, dieses Denkmodell verträgt und wie er darin
einhergeht, das ist eben die allererste Frage. Das Auszudrückende,
die Affekte, werden von Wundt im wesentlichen genauso in,,elementare
Gefühle" aufgelöst wie die Gesamtwahrnehmungenin elementare
Empfindungen und dann wird der Ausdruck axiomatisch als
eine Spiegelung der Affekte im Körperkraft elementarer Zuordnungen
aufgefaßt.
Andie Richtigkeit dieser Konstruktion glaubt
heutes o gut wie niemand mehr. Darum wäre es unzweckmäßig,
die Darstellung der Wundtschen Lehre mit ihr zu beginnen."
[2] S.29 "... die das Leben ohne den Umweg über das
Erleben via Klima, Alter und Krankheit hinterläßt? ..."
[3] S.46: "... Bald kommt dabei der Berg (das Abwesende)
zu Mohamed, bald geht Mohamed zumBerg, d. h. der Erlebende
fühlt sich hinversetzt an den Ort des abwesend Erinnerten oder
Phantasierten. ... "
S.64 Pseudo "der Lebensarbeit"
[4] S.65: "4. Als Auftakt zur feineren Explikation des Gedankengehaltes
der Respirationstheorie Bells benützt man zweckmäßig
eine rasch
skizzierte Überlegung in seinem Buche, die den nacherlebenden
Lesertief in das sonst (wenigstens in dem Ausdrucksbuche) ungeschriebene
Erstkonzept der ganzenIdee blicken läßt. DerHerzmuskel
und das Lungengewebe sind, so wird berichtet, nach den
Erfahrungen der Chirurgen unempfindlich für den Schnitt des
Messers und den Druck des Fingers. Begreiflich, so geht die Überlegung
weiter; denn wozu sollten sie auch für derartige Angriffe
empfindlich sein? Sie sind ja nicht wie die äußere Haut
dem Kontakt
mit der Außenwelt exponiert und nicht berufen, uns nach außen
hin
zu orientieren und zu schützen. Gibt es nichts anderes, worauf
sie
spezifisch ansprechen?— Soweit schreitet die Überlegung logisch
musterhaft vor, undes wird noch die allgemeine Erkenntnis des
Spezifitätsgesetzes auf dem Gebiet der afferenten Nervenvorgänge
wie eine Art Obersatz herangezogen. Dannwird das Folgende ein
Stückweit verschwommen; es kann weg bleiben in unserem Bericht.
Schließlich aber wird derFaden derÜberlegungen wieder deutlich;
es müsse, meint Bell, das gesuchte Analogon aus den biologisch
einsichtigen Funktionen des engverbundenen Herz-Lungen-Organsystems
konstruktiv zu finden sein. Das Stichwort, welches ihm
dauernd im Kopf herumgeht, heißt 'oxygenation of the blood'
(Versorgung des Bluts mitSauerstoff) und daß die gesuchten Reize
damit in Zusammenhang stehen müssen, ist ihm vor jeder konkreten
Verifikation evident. Das technische 'Wie' dagegen
bleibt dunkel."
[5] S.66 Zitat Bell:
",,Ich werdezu beweisen trachten, daß dasselbe, was Auge und
Ohr und die
tastende Hand für unseren Geist leisten, wenn sie uns mit den
Eigenschaften der
dinglichen Welt in unserem Erleben in Beziehung setzen, die Atmungsorgane
für
die Entwicklung unserer Gefühle bedeuten. Denn wir könnten
ohne sie zwar hören,
sehen und riechen, doch wir schritten kalt und teilnahmslos allen Erregungen
gegen-
über, die uns eigenartig anregenund menschlichen Gedanken und
Handlungen erst
ihren besonderen Reiz verleihen, unseren Erdenweg dahin"{84)."
[6] S.69 Zitat Bell
"... Wir sehen darin nur die
Intensive Zuwendung des Geistes zu dem Gegenstand eines Erlebens, seinen
direkten
Einfluß auf die Organe an der Körperoberfläche.
..."
[7] S.99
"Wer das an Beispielen nacherleben will, dem schlage
ich für das Oppositionsprinzip vor, die Entdeckungsgeschichte
der
vollständigen Geste des ,Zuckens mit der Schulter', wie sie S.
270ff.
niedergeleg tist, nachzulesen. Die Entdeckerhilfe, die der Forscher
dem ersten Hauptsatz verdankt, durchzieht das ganze Buch und
kann exemplarisch etwa an dem Symptom des Stirnrunzelns in
allen Modifikationen und Abschattungen, die Darwin gefunden
und beschrieben hat, verfolgt werden. Die Rolle der dritten Sucher-
regel dagegen steht auf einem anderen Blatte; sie verweist den
Forscher auf die Physiologie des Zentralnervensystems."
S.110 Pseudo "Kinderlebens"
S.113 Pseudo "Thierleben"
S.115 Pseudo "weiterleben"
[8] S.134:
"Sieht man zunächst von allen derart sekundär andem Bilde
vorgenommenen Einschränkungen und Retouchen ab, so denkt
sich alsoWundt das introspektiv Erfaßbare, das Erlebnis des Erlebenden,
dem Blicke eines Fremden momenthaft oder komponentenhaft
zugänglich in einem Spiegelbild körperlicher Begleiterscheinungen.
Woher bei ihm dies Spiegelgleichnis stammt, vermag ich
nicht zu sagen; rein logisch ist es wohl analog zu dem
Spiegelgleichnis von Leibniz eine bequeme Ausdrucksweise für Zuordnungen
des
einen zum anderen. Und monadenhaft gedacht ist
ja im Grunde auch diese ganze Wundtsche Konstruktion."
[9] S.141
"Man lasse sich, um das zu übersetzen, nicht ein auf die Frage,
ob die Entfaltung des Erlebens im Kindesalter mit der Formel
,vom Einfachen zum Zusammengesetzten' richtig und ausreichend
beschrieben ist oder nicht, sondern unterstreiche nur die Idee von
den neuen Situationen, die von allen Organismen stets zunächst
mit schon vorhandenen Mitteln der Reaktion beantwortet werden.
Das ist der Kerngedanke der HERBARTschen Apperzeptionslehre
und verdient auch heute noch Beachtung."
[10] S.147
"Schon hier kann der staunende Laie in diesen Dingen halt
machen und mit unbefangenem common sense die Frage dazwischen
werfen: Ja wozu denn eigentlich das ganze Konzert des,,wohlgeschulten
Orchesters"? Nach dem einzigen Axiom der Wundtschen
Theorie spiegelt es den einheitlichen Affekt, und natürlich
wäre ohne das Konzert der Affekt auch gar nicht da oder wenigstens
nicht voll und ganz was er ist, nämlich das eine Malz. B. eine
Erlebniswelle
der Seelenangst und das andere Maleine Welle der
jauchzenden Freude. Ist sie vorüber, die Welle, dann erscheint
auch vorüber oder wieder geglättet das Meer des Erlebens
und mit
ihm sein sichtbarer Spiegel, das Ausdrucksgelände des ganzen
Körpers, des Gesichtes und des Herz- und Atmungsapparates.
Wozu das Ganze? ..."
Ende Ausdruckstheorie.
Erleben und Erlebnis in Bühlers Sprachtheorie
(1934) Kürzel B1934.
Zusammenfassung
Erleben * Zusammenfassung
Erlebnis.
Insgesamt kann man davon ausgehen, dass Bühler die Begriffe erleben
und Erlebnis in der Sprachtheorie für nicht weiter erklärungs-
oder erläuterungsbedürftig hält.
Gliederung des Werkes Da ist zunächst das Geleitwort von Kainz (I-XIX). Es folgt das Vorwort von Bühler (XX-XXX). Sodann kommt das detallierte Inhaltsverzeichnis XXXI-XXXIV. Danach beginnt der Text 1-418. Abschließend das Namensregister 419-422 und das Sachregister 423-434. Die Literatur ist in den Text eingearbeitet und in Fußnoten ausgewiesen.
Inhaltsverzeichnis
Objektive Verifizierting der erlebnispsychologischen Beobachtungen
254
Sachregister
"Erlebnispsychologie 132ff., 250, 292, 328, 330. 342"
Zusammenfassung Erleben in der Sprachtheorie 1934 : Fundstellen: erleben 5 (9 mit 4 Pseudos), erlebt(e,n) 14. In keiner der 5 Textstellen (S. 41, 53f, 68f, 135, 374f) wird erleben erklärt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis.