(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=07.08.2008 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 21.06.18
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Wirtschaftsstatistik Einkommen, Löhne und Gehälter,
Gagen der etilE
und Hartz IV
siehe bitte auch Überblick
wichtige Wirtschaftsdaten Zeitreihen 1991-aktuell (7, 8, 14)
Billig Lohn,
Niedriglohn, Mindestlohn, Leiharbeit 2010. Dokumente und Materialien
der vielen Gesichter der Ausbeutung und Lohnsklaverei.
von Rudolf Sponsel, Erlangen
Editorial * Armut/Reichtum: Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung * Einkommen * Gagen der etilE * Grundsicherung * Hartz-IV. * Löhne und Gehälter * Öffentliches Finanzvermögen * Reiche, Millionäre und Milliardäre * Vermögensverteilung * Querverweise *
Editorial:
In Wirtschaftssystemen, in denen 2/3 oder mehr der Bruttoinlandsprodukts auf Konsumausgaben beruhen, z.B. USA mit rund 70%, ist es von grundlegender, existenzsicherender Bedeutung, dass die Menschen über genügend Einkommen haben, um entsprechende Konsumausgaben machen zu können. Damit kommt natürlich der Einkommens- und damit zusammenhängend der Arbeitsmarksituation eine ganz zentrale Bedeutung in der Wirtschaftsstiatistik zu.
Grundsätzliche Möglichkeiten des Gelderwerbs, Querverweise zum Geldproblem.
Armut/Reichtum
Einkommensmillionaere 2014
- 1600 mehr als im Vorjahr 2013
"Pressemitteilung Nr. 224 vom 21.06.2018: 19 000 Einkommensmillionäre
im Jahr 2014 in Deutschland"
WIESBADEN – Im Jahr 2014 hatten 19 000 von allen in Deutschland erfassten
Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen Einkünfte von mindestens einer
Million Euro – das waren knapp 1 600 Steuerpflichtige mehr als 2013. Wie
das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, betrug das Durchschnittseinkommen
dieser Gruppe 2,7 Millionen Euro.
Insgesamt erzielten die 40,2 Millionen Steuerpflichtigen
im Jahr 2014 Einkünfte in Höhe von 1,5 Billionen Euro, das waren
64 Milliarden Euro mehr als 2013. Die von den Arbeitgebern einbehaltene
Lohnsteuer summierte sich zusammen mit der von den Finanzbehörden
festgesetzten Einkommensteuer für 2014 auf 260 Milliarden Euro. Gegenüber
2013 bedeutete dies eine Steigerung um 13 Milliarden Euro.
In Deutschland wird ein progressiver Steuersatz
angewendet, damit steigt der Steuersatz mit zunehmendem Einkommen an. Dadurch
werden die Steuerpflichtigen unterschiedlich stark belastet. 2014 wurden
Einkommen ab 250 731 Euro (beziehungsweise ab 501 462 Euro bei gemeinsam
veranlagten Personen) mit 45 % besteuert. Dieser sogenannte Reichensteuersatz
kam bei 87 000 Steuerpflichtigen zum Tragen. Auf sie entfielen 5,9 % der
gesamten Einkünfte und 11,8 % der Steuersumme.
Das sind Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik
2014. Diese Statistik ist aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung
erst etwa dreieinhalb Jahre nach Ende des Veranlagungsjahres verfügbar."
Der erste Armutsatlas für Regionen in Deutschland: DPGV-Online. (PDF).
Das
Suchprogramm der Bundesregierung kennt den Begriff der Armut nicht (Suchabruf
19.5.9):
Armut: "Leider konnte kein Diokument gefunden werden. Bitte überprüfen
Sie Ihre Angaben."
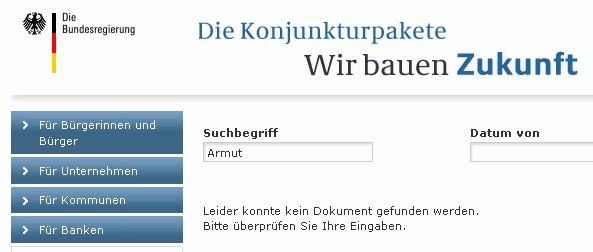
Armuts-
und Reichtumsberichte der Bundesregierung
"Mit Beschluss vom 27. Januar 2000 hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung
aufgefordert, regelmäßig einen Armuts- und Reichtumsbericht
zu erstatten. Am 25. April 2001 hat die Bundesregierung den ersten Armuts-
und Reichtumsbericht vorgelegt [Erster,
Anlagen].
Der Bericht und die zeitgleiche Vorlage des "Nationalen Aktionsplanes zur
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 2001-2003" (NAP-incl)
bei der EU-Kommission waren der Beginn einer kontinuierlichen Berichterstattung
über Fragen der sozialen Integration und der Wohlstandsverteilung
in Deutschland. Die Armuts- und Reichtumsberichterstattung basiert auf
dem Leitgedanken, dass eine detaillierte Analyse der sozialen Lage die
notwendige Basis für eine Politik zur Stärkung sozialer Gerechtigkeit
und zur Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe ist. Am 19. Oktober 2001
hat der Deutsche Bundestag die Verstetigung der Armuts- und Reichtumsberichterstattung
beschlossen und die Bundesregierung aufgefordert, jeweils zur Mitte einer
Wahlperiode einen entsprechenden Bericht vorzulegen. Dem kommt die Bundesregierung
mit der Vorlage des Berichts "Lebenslagen in Deutschland - Der 2. Armuts-
und Reichtumsbericht der Bundesregierung" nach. Der Bericht beschreibt
die Lebenslagen der Menschen in Deutschland auf der Basis statistischer
Daten etwa zu Einkommen, Vermögen, Erwerbstätigkeit, Bildungsbeteiligung.
Stand: Februar 2005. PDF-Bericht
(1.79 MB) 370 Seiten., Anhänge."
Einkommen
Gewinneinkommen auf
Rekordhoch
"Die Gewinnquote am Volkseinkommen hat einen neuen Höchststand
erreicht, der Anteil der Arbeitseinkommen sank selbst im Aufschwung. Der
Abschwung löst den Aufschwung abrupt und dramatisch ab. Die Bezieher
verschiedener Einkommensarten gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen
in die wirtschaftlich schwierige Zeit, zeigt der neue Verteilungsbericht
des WSI.* Die Einkommen aus Gewinnen und Vermögen sind brutto wie
netto noch einmal gestiegen und erreichen einen historischen Spitzenwert:
2007 machten sie netto 34 Prozent des privat verfügbaren Volkseinkommens
aus, im ersten Halbjahr 2008 waren es 35,8 Prozent. 1960 hatte diese Einkommensart,
die überwiegend einem relativ kleinen Personenkreis zufließt,
noch einen Anteil von 24,4 Prozent, 1990 waren es 29,8 Prozent. Besonders
stark wuchsen dabei zuletzt die Unternehmensgewinne. ... " [Böckler
Impuls 19/2008]
Gagen der etilE
Grundsicherung
2009: 764
000 Personen erhielten Ende 2009 Grundsicherung
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr.
377 vom 21.10.2010
"WIESBADEN - Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) erhielten am Jahresende 2009 rund 764 000 volljährige Personen
in Deutschland Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII
"Sozialhilfe"). Das waren 1,1% der Bevölkerung ab 18 Jahren. Im Vergleich
zum Vorjahr sank die Zahl der Hilfebezieher um 0,5%.
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
kann bei Bedürftigkeit von 18- bis 64-jährigen Personen, die
dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sowie von Personen im Rentenalter
ab 65 Jahren in Anspruch genommen werden.
Ende 2009 war jeweils rund die Hälfte der Empfänger
von Grundsicherung dauerhaft voll erwerbsgemindert (47,7%) oder im Rentenalter
(52,3%). Damit bezogen 0,7% der 18- bis 64-Jährigen und 2,4% der Bevölkerung
im Rentenalter Leistungen der Grundsicherung.
Die Mehrzahl der Empfänger waren Frauen (54,9%).
Während die Zahl der männlichen Hilfebezieher im Vergleich zum
Vorjahr um 1,8% stieg, sank die Zahl der weiblichen um 2,3%. Deutschlandweit
bezogen 1,2% der volljährigen Frauen und 1,0% der Männer Leistungen
der Grundsicherung.
Rund ein Viertel (23,5%) der Leistungsempfänger
war in stationären Einrichtungen wie Pflege- oder Altenheimen untergebracht,
rund drei Viertel (76,5%) lebten außerhalb solcher Einrichtungen.
Wie in den Vorjahren wurde die Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung auch im Jahr 2009 im früheren Bundesgebiet
(ohne Berlin) häufiger in Anspruch genommen: Hier bezogen 1,1% der
volljährigen Bevölkerung Leistungen der Grundsicherung. In den
neuen Ländern (ohne Berlin) waren es 0,8%. Am häufigsten waren
die Menschen in den Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg auf diese Sozialleistungen
angewiesen (zwischen 1,8% und 2,0% der volljährigen Bevölkerung).
Am seltensten nahm die Bevölkerung in Sachsen und Thüringen diese
Hilfe in Anspruch (je 0,7% der volljährigen Bevölkerung).
Erstmals seit Einführung dieser Leistung ging
die Zahl der Grundsicherungsempfänger 2009 in einigen Bundesländern
im Vergleich zum Vorjahr zurück. Am stärksten sank sie in Baden-Württemberg
(- 4,0%), Sachsen-Anhalt (- 3,2%) sowie in Mecklenburg-Vorpommern (- 2,8%).
Im Jahr 2009 gaben die Kommunen und die überörtlichen
Träger rund 3,9 Milliarden Euro netto für Leistungen der Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung aus. Im Vergleich zu 2008 sind die Ausgaben
für Grundsicherung um 6,7% gestiegen. Seit Einführung der Leistung
haben sie sich nahezu verdreifacht (2003: 1,3 Milliarden Euro).
Basisdaten und lange Zeitreihen zur Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung können auch kostenfrei über
die Tabelle 22151-0001 in der GENESIS-Online Datenbank (www.destatis.de/genesis)
abgerufen werden.
Eine methodische
Kurzbeschreibung sowie eine Tabelle und weitere Informationen zum Thema
bietet die Online-Fassung dieser Pressemitteilung unter www.destatis.de.
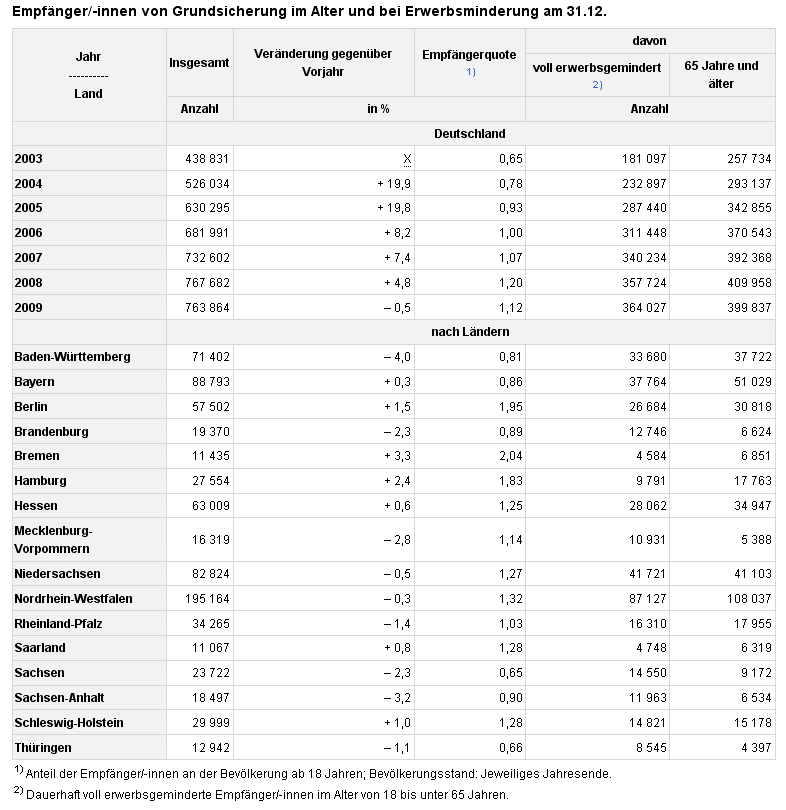
"
Hartz-IV.
Löhne und Gehälter
> Billig Lohn, Niedriglohn, Mindestlohn, Leiharbeit 2010. Dokumente und Materialien der vielen Gesichter der Ausbeutung und Lohnsklaverei.
Statistisches Bundesamt Deutschland: Methodische Kurzbeschreibung.
2017-Reallohnindex im Jahr 2017
um 0,8 % gestiegen
PRESSEMITTEILUNG des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)
Nr. 107 vom 23.03.2018
"WIESBADEN – Der Reallohnindex in Deutschland ist im Jahr 2017 im Vergleich
zum Vorjahr um 0,8 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
nach endgültigen Ergebnissen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung
weiter mitteilt, lagen die Nominallöhne im Jahr 2017 um rund 2,5 %
über dem Vorjahreswert. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im
selben Zeitraum um 1,8%..
Während die Verdienste im früheren Bundesgebiet
im Jahr 2017 nominal um 2,5 % stiegen, hatten Beschäftigte in den
neuen Ländern einen nominalen Lohnzuwachs von 3,0 %. Der durchschnittliche
Bruttomonatsverdienst einschließlich Sonderzahlungen lag bei vollzeitbeschäftigten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Westdeutschland im Jahr 2017 bei
4 293 Euro, ostdeutsche Vollzeitbeschäftigte verdienten im Durchschnitt
monatlich 3 247 Euro. Für Deutschland lag der entsprechende Wert bei
4 149 Euro.
Verglichen mit der Entwicklung in den übrigen
Quartalen des Jahres 2017 schwächte sich in Deutschland sowohl die
nominale als auch reale Verdienstentwicklung im vierten Quartal etwas ab:
Gegenüber dem vierten Quartal 2016 ergab sich für den Reallohnindex
ein Wachstum von 0,5 % bei einem Nominallohnzuwachs von 2,2 % und einem
Anstieg der Verbraucherpreise um 1,7 %.

Tarifrunde zweites Halbjahr 2008: Wenig Neuabschlüsse, viele Stufenerhöhungen
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 068 vom 27. Februar 2009
"WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden im zweiten Halbjahr 2008 in Deutschland nur wenige Tarifverträge neu abgeschlossen. Der Großteil der Tariferhöhungen beruhte auf Stufenerhöhungen aus der Tarifrunde 2007.
In der Metallindustrie vereinbarten Gewerkschaften und Arbeitgeber im November 2008 einen Neuabschluss, der eine Tariferhöhung um insgesamt 4,2% vorsieht (2,1% zum 1. Februar 2009 sowie eine weitere Erhöhung um 2,1% ab 1. Mai 2009). Als Ausgleich für die verzögerte Anpassung der Lohn- und Gehaltserhöhungen erhalten die Beschäftigten eine Pauschalzahlung von 510 Euro für die Monate November 2008 bis Januar 2009. Auch in anderen Branchen wurden Tariferhöhungen von 4% oder mehr neu abgeschlossen, zum Beispiel in der Kies- und Sandindustrie in Bayern (+ 5,0%), in den Erdöl- und Erdgas-, Bohr- und Gewinnungsbetrieben im früheren Bundesgebiet (+ 4,4%) oder in der Nährmittelindustrie in Bayern (+ 4,0%). Hierbei handelt es sich jedoch um Tarifabschlüsse, die vergleichsweise wenig Beschäftigte betreffen.
Wegen länger laufender Abschlüsse aus der Tarifrunde 2007 mit Stufenerhöhungen auch für das Jahr 2008 fanden in vielen Wirtschaftszweigen und Tarifbereichen keine Lohn- und Gehaltsverhandlungen statt. Bei vielen Tarifabschlüssen wurden im zweiten Halbjahr 2008 Stufenerhöhungen wirksam, beispielsweise in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie (+ 2,5% bis + 2,6%), im Groß- und Außenhandel (+ 2,3% bis + 2,5%), in der Druckindustrie (+ 2,1%) und in der Chemischen Industrie der neuen Länder (+ 2,0%). Im Baugewerbe erhielten die Beschäftigten im Mai 2008 deutschlandweit eine Stufenerhöhung um 1,5% und eine weitere im September 2008 um 1,6%.
Im Bankgewerbe sind die Tarifverträge Ende Juni 2008 ausgelaufen. Aufgrund der Finanzkrise haben die Gewerkschaften die Streikmaßnahmen Mitte Oktober ausgesetzt. Ein Abschluss kam bisher nicht zustande.
Detaillierte Angaben zu diesen und weiteren Tarifverträgen, zum Beispiel zur Verdiensthöhe, zur Arbeitszeit und zu den vermögenswirksamen Leistungen, bietet die Fachserie 16, Reihe 4.1 (Tariflöhne) und 4.2 (Tarifgehälter), 2. Halbjahr 2008, die ab sofort im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes unter [Online], Suchwort "Tariflöhne" beziehungsweise "Tarifgehälter", als kostenfreier Download zur Verfügung steht.
Die Ergebnisse der Tarifverdienststatistiken basieren auf Auswertungen ausgewählter Tarifverträge der Wirtschaftsbereiche Produzierendes Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Gebietskörperschaften sowie ausgesuchten Dienstleistungsbereichen."
2008-01 Höchster Anstieg der Tarifverdienste seit zwölf Jahren
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 167 vom 29. April 2008
"WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhten sich die Tarifverdienste der Angestellten und Arbeiter in Deutschland im Januar 2008 um 3,3% gegenüber dem Vorjahresmonat. Das ist der höchste Anstieg für die Angestellten seit April 1996 und für die Arbeiter seit Juli 1996.
Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im Januar 2008 gegenüber Januar 2007 um 2,8%.
Die höchsten durchschnittlichen Tarifsteigerungen gab es im öffentlichen Dienst. Der seit April 2005 erstmalige Anstieg war dabei durch
verschiedene Entwicklungen bedingt: Zum einen erhalten alle Tarifbeschäftigten beim Bund ab dem 1. Januar eine tabellenwirksame
Erhöhung von 50 Euro sowie eine prozentuale Erhöhung von 3,1%. Zum anderen wurden in den neuen Bundesländern die unteren Entgeltgruppen bei Bund, Ländern und Gemeinden auf Westniveau angehoben. Beides führte dazu, dass die unteren Entgeltgruppen höhere prozentuale Steigerungen verzeichnen als die oberen. Hinzu kam eine Erhöhung von 2,9% für die Tarifbeschäftigten der Länder im früheren Bundesgebiet ab Januar 2008. Insgesamt führte dies bei den Angestellten im öffentlichen Dienst zu einer durchschnittlichen Tariferhöhung von 4,4%. Da Arbeiter in den unteren Entgeltgruppen stärker vertreten sind als Angestellte, betrug der Anstieg für diese Beschäftigtengruppe sogar 5,5%.
Im Verarbeitenden Gewerbe stiegen die tariflichen Monatsgehälter der Angestellten im Januar 2008 gegenüber dem Vorjahresmonat
durchschnittlich um 3,7%. Die einzelnen Branchen unterscheiden sich dabei erheblich: Überdurchschnittliche Tariferhöhungen gab es für die
Angestellten unter anderem im Schiffsbau (+ 7,1%) und in der Tabakverarbeitung (+ 4,5%), unterdurchschnittliche dagegen im
Textilgewerbe (+ 2,2%), im Ernährungsgewerbe (+ 2,1%) sowie im Verlagsgewerbe (+ 1,7%).
Die tariflichen Stundenlöhne der Arbeiter verzeichneten im Verarbeitenden Gewerbe überdurchschnittliche Zuwächse unter anderem im
Schiffsbau (+ 6,0%) und im Schienenfahrzeugbau (+ 5,7%), unterdurchschnittliche im Ernährungsgewerbe (+ 2,4). Auch im Baugewerbe
lag der Zuwachs der Tariflöhne mit 2,5% unter der durchschnittlichen Tarifentwicklung.
"
Öffentliches Finanzvermögen
2007:
Öffentliches Finanzvermögen 2007 um 4% gesunken
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr.
476 vom 11. Dezember 2008
WIESBADEN - Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
betrug das Finanzvermögen der öffentlichen Haushalte zum Jahresende
2007 insgesamt 213 Milliarden Euro. Dies entspricht rechnerisch einem Finanzvermögen
von 2 594 Euro je Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr (mit 223 Milliarden
Euro) ist ein Rückgang um 4,4% oder rund 10 Milliarden Euro zu verzeichnen.
Zu den öffentlichen Haushalten zählen Bund, Länder und Gemeinden/Gemeindeverbände
einschließlich ihrer Extrahaushalte. Nicht enthalten ist der Vermögensbestand
an Anteilsrechten, wie Aktien
oder Investmentzertifikaten und sonstigen Beteiligungen.
Das größte Finanzvermögen besaßen
der Bund und seine Extrahaushalte mit 78,0 Milliarden Euro (rechnerisch
ein Wert von 949 Euro je Einwohner).
Die Länder und ihre Extrahaushalte hielten ein Finanzvermögen
von 71,8 Milliarden Euro (oder 873 Euro je Einwohner) und die Gemeinden
beziehungsweise Gemeindeverbände einschließlich ihrer Extrahaushalte
von 63,5 Milliarden Euro (beziehungsweise 831 Euro je Einwohner).
Die Ausleihungen (vergebene Kredite) hatten einen
Anteil von 70,6 Milliarden Euro (- 10,6%) am Finanzvermögen der öffentlichen
Haushalte.
Der Bestand an Bargeld und Einlagen (zum Beispiel Tagesgelder) betrug
57,1 Milliarden Euro (- 7,4%) und an Wertpapieren (ohne Anteilsrechte)
8,7 Milliarden Euro (+ 1,0%). Die sonstigen Forderungen (unter anderem
offene Steuerforderungen, Gebühren, aber auch privatrechtliche
Forderungen) beliefen sich auf 76,9 Milliarden Euro (+ 4,2%).
Methodische
Kurzbeschreibung Statistik über das Finanzvermögen des Staatssektors
Was beschreibt die Statistik über das Finanzvermögen
des Staatssektors?
Die Statistik über das Finanzvermögen des Sektors Staat bildet
das Finanzvermögen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und
Gemeindeverbände sowie ihre jeweiligen Sondervermögen und das
der Zweckverbände ab. Hinzu kommt seit dem Erhebungsjahr 2005 das
Finanzvermögen aller mehrheitlich-öffentlich bestimmten Fonds,
Einrichtungen und Unternehmen des Staates, die außerhalb der öffentlichen
Kernhaushalte mit eigenem – meistens doppischem – Rechnungswesen geführt
werden.
Das Finanzvermögen des Staates wird in dieser
Statistik durch die folgenden Vermögensarten definiert: Bargeld und
Einlagen, Wertpapiere und Finanzderivate, vergebene Kredite, Anteilsrechte
sowie alle sonstigen Forderungen der öffentlichen Haushalte. Sowohl
die Wertpapiere als auch die vergebenen Kredite werden dabei nach ihren
Ursprungslaufzeiten (bis einschließlich 1 Jahr und mehr als 1 Jahr)
und nach Emittenten beziehungsweise Schuldnern nachgewiesen.
Zusammen mit der Schuldenstatistik bildet die Statistik
über das Finanzvermögen die Grundlage für die Stabilitätsberichterstattung
durch die Deutsche Bundesbank an die Europäische Kommission.
Wie werden die Daten der Statistik über
das Finanzvermögen des Staats ermittelt?
Die Statistik über das Finanzvermögen des Staates wird seit
2004 jährlich zum Stichtag 31. Dezember als Totalerhebung durchgeführt.
Als Basis für die Auskunftserteilung dienen vor allem die Ergebnisse
aus den Rechnungsabschlüssen der staatlichen und kommunalen Haushalte
sowie aus den Jahresabschlüssen der mehrheitlich-öffentlich bestimmten
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Sektors Staat. Die Erhebung über
das Finanzvermögen zählt zu den Primärstatistiken.
Die Daten des Bundes (einschließlich seiner
Sondervermögen) und der Länder sowie der Fonds, Einrichtungen
und Unternehmen in mehrheitlichem Bundesbesitz werden zentral vom Statistischen
Bundesamt erhoben, die der übrigen Einheiten dezentral von den jeweiligen
Statistischen Landesämtern (Sitzland).
Rechtsgrundlage für die Erhebung bildet das
Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. Februar 2006 (Bundesgesetzblatt (BGBl) I Seite 438) in Verbindung
mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I Seite
462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September
2007 (BGBl. I Seite 2 246). Es werden die Angaben zu Paragraph 5 Nummer
4 Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) erhoben. Die Berichtskreisabgrenzung
der Fonds, Einrichtungen und Unternehmen erfolgt nach der Verordnung (EG)
Nummer 2 223/96 des Rates vom 25. Juni 1996 zum Europäischen System
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 95) auf nationaler und regionaler
Ebene in der Europäischen Gemeinschaft (Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften Nr. L 310 vom 30. November 1996, Seite 1 und folgende Seiten).
Wann werden die Ergebnisse der Statistik über
das Finanzvermögen des Staatssektors veröffentlicht?
Die vorläufigen Ergebnisse dieser Erhebung werden in einer Pressemitteilung
am Ende des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres veröffentlicht.
Die erste Pressemitteilung zum Themengebiet „Finanzvermögen des Staatssektors“
wurde im März 2007 für das Berichtsjahr 2005 herausgegeben. Eine
ausführliche Darstellung der Ergebnisse ist erstmalig für die
Erhebung vom 31. Dezember 2007 in Form einer Fachserie geplant. Diese wird
im Frühjahr 2009 kostenlos zum Download im Publikationsservice des
Statistischen Bundesamtes zur Verfügung stehen.
Wie genau sind die Ergebnisse der Statistik über
das Finanzvermögen des Staatssektors?
Die Datengenauigkeit der Vermögenstatistik entspricht den Anforderungen
des ESVG 95. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Daten von
Bund, Ländern und Gemeinden aus sehr unterschiedlichen Verwaltungsunterlagen
zusammengeführt werden müssen und daher bei der Zuordnung einzelner
Vermögenspositionen Verfahrensunterschiede vorliegen können.
Im Rahmen regelmäßiger Plausibilitätsprüfungen werden
Zuordnungsfehler und auch Antwortausfälle jedoch auf ein Minimum reduziert.
Der zunehmende Übergang der öffentlichen Haushalte auf ein neues
doppisches Rechnungswesen mit präzisen Vermögensnachweisen wird
hier eine weitere Verbesserung bringen.
___
Reiche, Millionäre und Milliardäre
- Millionäre 2007: "... Dem "World Wealth Report" von Merrill Lynch und Capgemini zufolge gab es in Deutschland 2007 rund 826000 Millionäre. Und die Zahl dürfte in diesem Jahr weiter angestiegen sein. ... " [Welt 14.12.8]
- ManagerInnen Gagen.
- Die Wachstumsrate der Millionäre in Deutschland.
- 2003: Die 250 reichsten Menschen in Deutschland und die Entwicklung ihres Reichtums werden im Manager-Magazin 3/2003 dokumentiert: https://www.manager-magazin.de/koepfe/reichste/0,2828,236831,00.html.
- 2003: Trotz Krise: Immer mehr Millionäre: Die Wirtschaftskrise kann den Reichen und Superreichen nichts anhaben. Einer aktuellen Studie zufolge steigt ihr Vermögen weiter an, immer mehr Menschen dürfen sich Millionär nennen. [Der Spiegel meldet am 11.6.3]
- Warum Arme zahlen – und Milliardäre nicht. Nur bei acht Prozent aller Erben soll der Fiskus künftig Erbschaftsteuer einsammeln. Wen es dabei trifft, ist reine Willkür. [focus 14.11.8]
- "Die reichsten Schweizer haben 70 Milliarden Franken verloren. Was verbindet Roger Federer mit Unternehmer Uli Sigg? Beide haben es dieses Jahr unter die 300 reichsten Menschen der Schweiz geschafft. Sie alle gemeinsam sind dieses Jahr ärmer geworden. ... " [baz 4.12.8]
Vermögensverteilung
Soziale
Polarisierungen in der Einkommens- und Vermögensverteilung [WSI]
"Im Rahmen dieses Projekts wird die Einkommens- und Vermögensverteilung
auf der Ebene der individuellen Erwerbseinkommen, der staatlichen Umverteilung
und der privaten Haushaltslage analysiert, um Veränderungen insbesondere
Ungleichgewichte, schiefe Verteilungen von Steuer- und Abgabelasten, unterschiedliche
Vermögensbildungspotentiale usw. zu identifizieren. Vor allem Armut
und Reichtum in Form von sozialen Polarisierungen belasten viele Politikbereiche
(Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik, soziale Sicherung) und bergen sogar
Sprengkraft für den Sozialstaat. Zu einzelnen Verteilungsaspekten
werden gelegentlich Unterprojekte entwickelt, z.B. zu "Armut in der Arbeit"
oder "Niedriglöhne"/Niedrigproduktivitäten". Projektteam: Dr.
Claus Schäfer, WSI. Vorgehen: Auswertung von amtlichen und nicht-amtlichen
Statistiken, eigene empirische Erhebungen, Literaturrecherche, Transfer
von Forschungserkenntnissen.
Veröffentlichungen zum Projekt:
- Schäfer, C. (2003): Von der falschen Einkommensverteilung zur richtigen Zukunftssicherung - Vortrag auf einer GEW-Konferenz zur Bildungsfinanzierung am 21.2.2003 in Berlin, Tagungsdokumentation erscheint demnächst (als pdf-Datei schon verfügbar auf der hompage www.forum-dl21 auf der Seite "Wirtschaft und Finanzen" vom 14.4.2003)
- Schäfer, Claus (2002), Die ökonomische Effizienz des Sozialen - Zum Armuts- und Reichtumsbericht der deutschen Bundesregierung und seinen bisher nicht gezogenen Konsequenzen, in: Die (österreichische) Armutskonferenz/Attac/BEIGEWUM (Hrsg.), Was Reichtümer vermögen, S. 212-231, Wien
- Schäfer, C. (2002): Ohne gerechte Verteilung kein befriedigendes Wachstum, WSI-Verteilungsbericht 2002, in: WSI Mitteilungen 11/2002, S. 627-641.
- Schäfer, C. (2002): Die Einkommenssituation von erwerbstätigen Frauen, in: Engelbrech, Gerhard (Hrsg), Arbeitsmarktchancen für Frauen, Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Bd. 258, S. 93-124, Nürnberg.
- Schäfer, C. (21001): Sozial und ökonomisch eine fatale Gleichung: niedrigere Löhne - bessere Welten, in: Klaus Kittler/Zepra e.V. (Hrsg.), Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik, Hamburg.
- Schäfer, C. (2001): Ungleichheiten politisch folgenlos? Zur aktuellen Einkommensverteilung, in: WSI-Mitteilungen 11/2001.
- Schäfer, C. (2001): Über die Rastlosen und die Ausgeschlossenen - Armut und Reichtum in der Bundesrepublik, in: Frankfurter Rundschau / Dokumentationsseite vom 25.09.2001.
- Schäfer, C. (2001): Von massiven Verteilungsproblemen heute zu echten Standortproblemen morgen, in: Stadlinger, Jörg (Hrsg.), Reichtum heute - Diskussion eines kontroversen Sachverhalts, Münster.
WSI-Herbstforum. Armut, Reichtum und Sozialstaat. Ist die soziale Spaltung
noch lösbar? 29. November 2007 bis 30. November 2007 [Info]
Literatur (Auswahl)
Links (Auswahl: beachte)
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT = General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
Methodische Kurzbeschreibung Grundsicherung: [Quelle Abruf 21.10.2010]
- Was beschreibt die Grundsicherungsstatistik?
Am 1. Januar 2003 trat das "Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" (GSiG) in Kraft. Dieses Sozialleistungsgesetz sieht für ältere Personen und Personen mit einer dauerhaften Minderung der Erwerbsfähigkeit eine eigenständige soziale Leistung vor, welche den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sollen dazu beitragen, die so genannte "verschämte Armut" einzugrenzen. Vor allem ältere Menschen machen bestehende Sozialhilfeansprüche oftmals nicht geltend, weil sie den Rückgriff auf ihre unterhaltsverpflichteten Kinder fürchten. Deshalb bleiben bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Regelfall Unterhaltsansprüche gegenüber den Kindern und Eltern des Leistungsempfängers unberücksichtigt. Mit dem Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch wurde neben dem Bundessozialhilfegesetz unter anderem auch das Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit Wirkung vom 1. Januar 2005 als 4. Kapitel in das SGB XII "Sozialhilfe" eingeordnet. Mit der Erhebung sollen umfassende und zuverlässige Daten über die sozialen und finanziellen Auswirkungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Daten über den Personenkreis der Leistungsberechtigten bereitgestellt werden. Die Angaben werden ferner für die weitere Planung und Fortentwicklung des SGB XII benötigt.
Wie werden die Daten der Grundsicherungsstatistik ermittelt?
Die Statistik über die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine dezentrale Statistik, d.h. das Statistische Bundesamt bereitet Organisation und Technik vor, die Statistischen Ämter der Länder erheben die Daten und bereiten sie zu statistischen Ergebnissen auf. Es handelt sich um eine Sekundärstatistik, bei der vorliegende Verwaltungsdaten zusätzlich für statistische Zwecke genutzt werden.
Jährlich zum 31. Dezember wird die Erhebung über die Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung als Bestandserhebung (Totalerhebung) durchgeführt. Der Katalog der erfassten Merkmale ist breit: Neben klassischen personenbezogenen oder soziodemographischen Grunddaten (Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit, etc.) werden auch detaillierte Angaben über Höhe und Dauer des Leistungsbezugs erhoben. Darüber hinaus stellt die Statistik Angaben zur Ursache der Leistungsgewährung und zur Art der von den Leistungsberechtigten angerechneten Einkommen bereit. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung bildet § 121 Nr. 1 Buchstabe b des zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2670) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246). Erhoben werden die Angaben zu § 122 Abs. 2 SGB XII. Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus §125 SGB XII in Verbindung mit §15 BStatG. Hiernach sind die zuständigen örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie die kreisangehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, auskunftspflichtig.
Wann werden die Ergebnisse der Grundsicherungsstatistik veröffentlicht?
Eckdaten der Statistik wurden erstmals im Dezember 2004, rund ein Jahr nach der Erhebung, mit einer Pressemitteilung veröffentlicht. Neben Bundesergebnissen sind auch vielfältige Ergebnisse für die Bundesländer verfügbar, die von den jeweiligen Statistischen Ämtern der Länder veröffentlicht werden.
Für Zusatzaufbereitungen des Bundes stellen die Statistischen Ämter der Länder dem Statistischen Bundesamt zusätzlich jährlich Einzelangaben aus der Empfängerstatistik mit einem Auswahlsatz von 25 Prozent zur Verfügung ("25%-Stichprobe"). Diese Datenquelle ermöglicht im direkten Vergleich zu den Standardtabellen eine tiefer gehende Analyse zum Bezug von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Wie genau ist die Grundsicherungsstatistik?
Die Statistik über die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird als Totalerhebung durchgeführt und ist demzufolge von hoher Aussagekraft. Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, finden regelmäßig umfangreiche Plausibilitätsprüfungen statt.
Methodische Kurzbeschreibung Löhne und Gehälter [nach destatis Version 31.8.7]
- "Was beschreibt der Indikator?
Als Lohn- und Gehaltsstatistiken werden detaillierte Informationen über die absolute Höhe, die Entwicklung und die Bestimmungsgründe der effektiven (tatsächlichen) und tariflichen Löhne und Gehälter angeboten. Für verschiedene Arbeitnehmergruppen werden dabei effektive Bruttoverdienste nach Wirtschaftszweigen und Geschlecht in regelmäßigen Zeitabständen erfasst. Für die Arbeiter werden zusätzlich die bezahlten Wochenarbeitsstunden und die Mehrarbeitsstunden nachgewiesen.
Ergänzend dazu geben die Tarifindizes die Entwicklung der tariflichen Lohn- und Gehaltsätze und der tariflichen Arbeitszeit wieder (siehe hierzu: Statistik von A bis Z "Index der Tariflöhne und Gehälter").
Wie wird der Indikator berechnet?
Die effektiven Löhne und Gehälter werden in den laufenden Verdiensterhebungen und in den abwechselnd in vierjährlichen Abständen durchzuführenden Gehalts- und Lohnstruktur- sowie Arbeitskostenerhebungen erfasst:
Zu den Laufenden Verdiensterhebungen gehören die in vierteljährlichen Abständen für Januar, April, Juli und Oktober durchgeführte Verdiensterhebung und die Bruttojahresverdiensterhebung im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe sowie die jährlichen Verdiensterhebungen im Handwerk (für den Berichtsmonat Mai) und in der Landwirtschaft (für den Berichtsmonat September). Alle diese Erhebungen beziehen als Stichproben nur eine ausgewählte Anzahl von Betrieben ein, und zwar die Verdiensterhebungen im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe 33 000 Betriebe, die Verdiensterhebung im Handwerk 27 000 Betriebe und die Verdiensterhebung in der Landwirtschaft 6 500 Betriebe.
In den genannten Lohnstatistiken werden Durchschnittsverdienste berechnet. Um die reine Verdienstentwicklung unabhängig von Veränderungen der Arbeitnehmerstruktur beurteilen zu können, werden für das Produzierende Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe die Bruttoverdienste – und bei den Arbeitern zusätzlich die bezahlten Wochenstunden – auch als Indizes dargestellt.
In der ab 2006 europaweit alle vier Jahre durchzuführenden Gehalts- und Lohnstrukturerhebung – letzte Ergebnisse für Deutschland liegen für 2001 vor – werden ebenfalls Durchschnittsverdienste errechnet, und zwar nach wichtigen verdienstbestimmenden Merkmalen wie Wirtschaftszweig, Unternehmensgrößenklasse, Leistungsgruppe, Beruf, Alter, Geschlecht, Ausbildung und Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, ferner die Streuung der Individualverdienste um diese Durchschnittswerte. Die Erhebung wird ebenfalls als Stichprobe bei 27 000 Betrieben des Produzierenden Gewerbes und ausgewählter Dienstleistungsbereiche mit 10 und mehr Beschäftigten (Auswahlsatz: 8 Prozent aller Unternehmen) durchgeführt und bezieht rund 900 000 Beschäftigte ein.
Aufgabe der – abwechselnd zur Gehalts- und Lohnstrukturerhebung – alle vier Jahre in allen EU-Mitgliedstaaten nach einheitlichem Konzept durchzuführenden Arbeitskostenerhebung ist die Erfassung der gesamten Kosten, die durch die Beschäftigung der Arbeitnehmer entstanden sind. Hierzu zählen neben den Löhnen und Gehältern vor allem die Arbeitgeberpflichtbeiträge zur Sozialversicherung, die freiwilligen betrieblichen Sozialleistungen sowie die Kosten der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Auch diese Erhebung wird als Stichprobe bei rund 29 000 Betrieben von Unternehmen mit 10 und mehr Beschäftigten (Auswahlsatz 16 Prozent) durchgeführt.
Wann wird der Indikator veröffentlicht?
Erste Ergebnisse der laufenden Verdiensterhebung im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe erscheinen etwa 65 Tage nach dem Berichtsmonat. Ausführliche, nach Wirtschaftszweigen und sachlichen Kriterien tief gegliederte Ergebnisse nach Bundesländern werden zusammen mit den Effektivindizes regelmäßig nach rund 90 Tagen veröffentlicht. Die ersten Ergebnisse der Gehalts- und Lohnstrukturerhebung und der Arbeitskostenerhebung erscheinen etwa 20 Monate nach dem Berichtsjahr.
Die Pressemitteilungen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes abrufbar.
Wie genau ist der Indikator?
Für die meisten lohnstatistischen Stichprobenerhebungen werden Fehlerrechnungen durchgeführt. In der vierteljährlichen Verdiensterhebung im Produzierenden Gewerbe, Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe werden die Ergebnisse nur veröffentlicht, wenn der relative Standardfehler kleiner als 10 Prozent ist. Der relative Standardfehler ist ein Maß für den Stichprobenzufallsfehler und dient zur Beurteilung der Präzision von Stichprobenergebnissen. Bei einem relativen Standardfehler zwischen 5 und 10 Prozent werden die Ergebnisse in Klammern gesetzt, um die Nutzer auf die eingeschränkte Aussagefähigkeit hinzuweisen. In den Veröffentlichungen zur Gehalts- und Lohnstrukturerhebung und zur Arbeitskostenerhebung wird der relative Standardfehler in den Tabellen nachgewiesen."
Standort: Wirtschaftsstatistik Löhne.
*
Billig Lohn, Niedriglohn, Mindestlohn, Leiharbeit 2010. Dokumente und Materialien der vielen Gesichter der Ausbeutung und Lohnsklaverei.
* Überblick Wirtschaftsstatistiken * Überblick Statistik * Beweisen in Statistik *
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Gelderwerb Geld site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Psychologie und Psychopathologie des Geldes, 2*Privatverschuldung*Schuldenstatistik*Geldtabu und Geldgeheimnisse*
Querverweis: Macht Geld glücklich? - Die Sicht eines Börsenmaklers.
Arbeitslosen-Typologie aus integrativer Sicht.
Psychologische Materialien zur Arbeitsmotivation 1. Möglichkeiten zum Aufbau einer positiven Arbeits-Einstellung.
*Überblick Staatsverschuldung*
Sinnfragen: Lebenssinn 1 *Lebenssinn 2 (mit 100 Jahre Leben Meditation).
Überblick Programm Politische Psychologie in der IP-GIPT.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Wirtschaftsstatistik Einkommen, Löhne und Gehälter, Gagen der etilE und Hartz IV. Abteilung Wirtschaft und Soziales. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wirtsch/WStat/Einkom/wsEink01.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen, die die Urheberschaft der IP-GIPT nicht jederzeit klar erkennen lassen, ist nicht gestattet. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert:
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik sind willkommen
21.06.18 Einkommenmillionäre um 1600 gestiegen.
05.01.11 Neu organisiert: von PolPsy nach Wirtschaftsstatistik.
21.10.10 Grundsicherung.
21.05.09 Armutsatlas.
19.05.09 Das Suchprogramm der Bundesregierung kennt den Begriff der Armut nicht.
22.02.09 Tarifrunde zweites Halbjahr 2008: Wenig Neuabschlüsse, viele Stufenerhöhungen.
11.12.08 Öffentliche Finanzvermögen 2007.
06.12.08 Reichste Schweizer in der FiKri 70 Mrd. verloren.