(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=30.09.2006 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 15.09.15
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Familien-Statistik_ Überblick_ Rel.Aktuelles_Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service-iec-verlag_ Wichtige Hinweise zu Links_und_Empfehlungen_
Willkommen in unserer Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung
Familien-Statistik
In Memoriam Walter Toman:
von Irmgard Rathsmann-Sponsel und Rudolf Sponsel, Erlangen
_
Editorial Familien-Statistik: Die Familie ist von großer Bedeutung für fast alle Menschen. Schon deshalb, weil die meisten Menschen in sie hineingeboren werden, in Familien aufwachsen und von ihrer Familien und ihren Bezugspersonen dort sehr geprägt oder beeinflusst werden, im Guten wie im weniger Guten. Dessen eingedenk ist natürlich klar, dass auch der Familien-Statistik (Lebensformen und Lebensstile, Eheschliessungen, Scheidungen, Kinder, Wohnformen, Geburtenraten, Sterbealter, Erziehung, Elternschaft, Wanderung und Umzüge u.a.m.) eine wichtige Bedeutung zukommt. Und eine gute Familie ist wie eine gute Partnerbeziehung und gute Freunde ein großes und mächtiges "Lebenskapital" - das leider durch eine verantwortungslose Wirtschaft und ihren GlobalisierungsagentInnen - wozu auch die PolitikerInnen gehören - in den Grundlagen (Mobilitäts- und Flexibilitäts-Forderung) zerstört wurde. Die Zerstörung dieser wichtigsten sozialen Ressource der Einheit der Familie ist nicht nur eine schwere Sünde gegen die Menschlichkeit und Vernunft, sondern auch wirtschaftlich unendlich dumm, weil die Professionalisierung und Ökonomisierung elementarer sozialer Leistungen letztlich unbezahlbar ist - und zudem immer unmenschlicher wird (> homo oeconomicus).
Allgemeines und Sonstiges
Jugend und Familie in
Europa - Neue Publikation des stat. Bundesamtes:
"Bekommen die Deutschen die wenigsten Kinder? Sind skandinavische Schüler
besser gebildet und Osteuropäerinnen stärker berufstätig?
Wann ziehen Jugendliche von zu Hause aus? Teilweise überraschende
Antworten auf diese und weitere Fragen bietet der neue Band aus der Reihe
„Im Blickpunkt“. Er beschäftigt sich mit einem breiten Spektrum an
Themen rund um Jugend und Familie in Europa. Die Inhalte sind nicht nur
für das neue Europaparlament und die nationale Debatte wichtig, sondern
auch für die Bürger." [URL geändert, aber IP-GIPT]
Kinder, Geschwister-, Partner- und Familienkonstellationen
- 2012: Geburtentrends und Familiensituation in Deutschland.
- 2011: In Deutschland lebte 2011 jede fünfte Person allein.
- Mütter mit mehreren Kindern haben mit Familiengründung früher begonnen.
- 2010: In fast jedem dritten Haushalt leben Senioren
- 2009: Jedes vierte minderjährige Kind ist ein Einzelkind.
- 2008: In 221 000 Haushalten leben drei Generationen unter einem Dach.
- 2008: Kinderlosigkeit nimmt zu.
- 2006 Jedes dritte Kind wird außerhalb einer Ehe geboren.
- 2006 Jede zehnte Frau zwischen 25 und 54 bleibt wegen Familie zu Hause.
- Frauen werden heute im Durchschnitt mit 26 Jahren Mutter.
- 2006: Familienformen in Deutschland.
- Bei mehr als der Hälfte der Paare mit Kindern arbeiten beide Partner.
- Zwei von drei Kindern werden mit Geschwistern groß.
2012: Geburtentrends und Familiensituation in Deutschland.
"Einleitung
Das Geburtenniveau in Deutschland gehört
seit Jahrzehnten zu den niedrigsten der Welt. Der Wunsch nach einem absehbaren
Ende der Geburtenflaute ist deshalb verständlich. Ein genauer Blick
auf die Indikatoren der Geburtenentwicklung stimmt allerdings eher nachdenklich.
In den letzten Jahren konnten zwar leichte positive Effekte sowohl im Geburtenverhalten
der Frauen im Alter von Mitte 30 als auch zum Beispiel bei den Akademikerinnen
beobachtet werden. Es ist jedoch fraglich, ob diese zur Erholung der endgültigen
Kinderzahl nachhaltig beitragen können. Vielmehr wird diese künftig
– nach einem geringfügigen Anstieg – auf niedrigem Niveau stagnieren.
Für Nutzer, die sich über die Entwicklung
de r Geburten und über die Situation der Familien informieren möchten,
bietet der vorliegende Bericht das notwendige Hintergrundwissen. Die wichtigsten
Indikatoren, Ergebnisse und Literaturquellen der amtlichen Statistik sind
hier zusammengestellt. Die Datenquellen des Berichts sind die Geburtenstatistik
sowie der Mikrozensus. Bei der Geburtenstatistik handelt es sich um Daten,
die in den Standesämtern nach der Geburt eines Kindes aufgenommen
werden. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung
in Deutschland und Europa. Sowohl in der Geburtenstatistik als auch im
Mikrozensus werden seit der Novellierung ihrer Rechtsgrundlagen im Jahr
2007 (Gesetz zur Änderung des Mikrozensusgesetzes 2005 und des
Bevölkerungsstatistikgesetzes vom 30. Oktober 2007, BGBl., Jahrgang
2007, Teil I Nr. 55) neue Informationen gewonnen. Dazu gehört unter
anderem das durchschnittliche Alter der Mütter bei der Geburt des
ersten, zweiten oder weiteren Kindes. Davor bezog sich das Gebäralter
lediglich auf die Geburtenfolge der Frau in bestehender Ehe. Der Mikrozensus
liefert seit 2008 im vierjährlichen Rhythmus Angaben über Frauen
nach der Zahl ihrer leiblichen Kinder. Damit ist eine statistisch fundierte
Aussage zur Kinderlosigkeit in Deutschland überhaupt erst möglich
geworden. In diesem Bericht werden die Angaben der Geburtenstatistik bis
zum Jahr 2012 und der zweiten Mikrozensus-Befragung im Jahr 2012 zur Anzahl
der geborenen Kinder miteinander verknüpft. Damit wird das Bild über
die Geburtenentwicklung vollständiger. Alle Angaben beziehen sich
hier auf den Bevölkerungsbestand, in dem die Ergebnisse des Zensus
2011 noch nicht berücksichtigt sind. Nach erster Einschätzung
auf Grundlage der zum Veröffentlichungszeitpunkt bekannten Zensusergebnisse
haben die hier dargestellten Trends und Zusammen hänge jedoch weiterhin
Bestand. Die wesentlichen Ergebnisse des Berichts sind in einer Kurzfassung
im Anschluss an die Einleitung dargestellt.
Im Kapitel 1 „Geburtenentwicklung“
werden die wesentlichen Geburtentrends in Deutschland dargestellt. Insbesondere
werden dabei – häufig im Hinblick auf das Geburtenverhalten von Frauenjahrgängen
(Kohorten) – folgende Fragestellungen untersucht: Wie haben sich die Geburtenzahl,
die jährliche Geburtenrate sowie die endgültige Kinderzahl der
Frauen entwickelt? Wie verändert sich der Zeitpunkt der Familiengründung?
Werden Akademikerinnen später Mütter? Wie groß sind die
Abstände zwischen den Geburten einer Mutter und wie viele Kinder haben
die Mütter geboren? Wie unterscheiden sich die Kinderzahl und der
Zeitpunkt der Familiengründung nach dem Bildungsstand der Mütter?
Im zweiten Kapitel
richtet sich der Blick auf die Kinderlosigkeit von Frauen. Insbesondere
werden dabei die Kinderlosenquoten der Frauen und die Veränderungen
zwischen den Mikrozensus-Befragungen 2012 und 2008 dargestellt. Ferner
steht das Thema Kinderlosigkeit und Bildungsstand und dabei vor allem die
Kinderlosenquote der Akademikerinnen im Blickpunkt der Betrachtung. [<6]
Im dritten Kapitel
steht die Situation der Familien im Vordergrund, also der Eltern-Kind-Gemeinschaften,
bei denen mindestens ein minderjähriges Kind im Haushalt lebt. Hierbei
wird der Fokus gezielt auf zwei wichtige Aspekte des Familienlebens gerichtet,
die kurz mit den Schlagworten „Erwerbsbeteiligung“ und „kinderreiche Familien“
umrissen werden können. Im Abschnitt zur Erwerbsbeteiligung geht es
vor allem darum, ob und wenn ja in welchem Umfang Mütter und Väter
mit kleinen Kindern (unter drei Jahren) berufstätig sind und wie bei
Paarfamilien mit kleinen Kindern die Erwerbstätigkeit der Partner
konkret ausgestaltet wird. Der Abschnitt „kinderreiche Familien“ schließlich
beleuchtet die Lebenssituation von Familien mit drei oder mehr Kindern
unter verschiedenen Gesichtspunkten – insbesondere auch im Vergleich zu
Familien mit „lediglich“ einem oder zwei Kindern.
Im vierten Kapitel finden
sich „methodische Hinweise“ zu den verwendeten Datenquellen „Geburtenstatistik“
und „Mikrozensus“, zum zugrundeliegenden Bevölkerungsbestand, zum
stichprobenbedingten Zufallsfehler sowie zur Antwortbereitschaft im Mikrozensus.
Dem Kapitel 4 folgen
ein Literaturverzeichnis, das auf weiterführende Publikationen und
Veröffentlichungen zu den dargestellten Themen verweist, sowie ein
Tabellenanhang. Online steht den Nutzern ein umfangreiches Tabellenmaterial
im Excel-Format zur Verfügung. Die Tabellenübersicht dazu befindet
sich in diesem Bericht auf S. 69 f.
Wichtigste Ergebnisse auf einen Blick
Die Anzahl der Geburten wird bei einer relativ konstant en jährlichen Geburtenrate voraussichtlich bis zum Jahr 2020 stabil bleiben. Danach wird die Geburtenzahl kontinuierlich abnehmen. Der Grund für diese Entwicklung ist der absehbare Rückgang der Zahl der potenziellen Mütter im Alter von Mitte 20 bis Mitte 30. Eine stabile Geburtenzahl würde dann eine höhere jährliche Geburtenrate voraussetzen.
Die jährliche zusammengefasste Geburtenziffer ist in Deutschland seit über drei Jahrzehnten relativ konstant. Diese Konstanz ergibt sich dadurch, dass die rückläufige Geburtenhäufigkeit der Frauen im jüngeren gebärfähigen Alter durch die zunehmende Fertilität der Frauen im Alter von über 30 Jahren kompensiert wird.
Im Lebenslauf eines Geburtsjahrgangs werden dagegen nicht alle im jüngeren Alter aufgeschobenen Geburten zu einem später en Zeitpunkt realisiert. Deshalb sinkt die endgültige durchschnittliche Kinderzahl der Frauenjahrgänge bisher kontinuierlich. Bei den Geburtsjahrgängen der frühen 1970er Jahre wird sie sich leicht erholen. Für eine weiterhin stabile endgültige Kinderzahl wäre allerdings erforderlich, dass die Frauen im höheren gebärfähigen Alter viel mehr Geburten „nachholen“ als es bisher der Fall war beziehungsweise dass nicht noch mehr junge Frauen die Familiengründung auf später aufschieben.
Die Mütter bekommen in Deutschland im Laufe ihres Lebens durchschnittlich zwei Kinder. Die Verteilung der Mütter nach Zahl der Kinder ist seit den 1940er Jahrgängen sehr stabil. Im Jahr 2012 haben die 45 bis 49 Jahre alten Mütter zu 31 % „nur“ ein Kind, zu 48 % zwei Kinder, zu 15 % drei Kinder und zu 6 % vier oder mehr Kinder geboren. In den neuen Ländern war der Anteil der Mütter mit mehr als zwei Kindern deutlich geringer als im früheren Bundesgebiet: 14 % gegenüber 23 %.
Das durchschnittliche Alter der Frauen bei der ersten Geburt nimmt beständig zu. Im Jahr 2012 betrug es 29 Jahre. Dies bedeutet , dass der Anteil der Frauen, die im Alter unter 30 Jahren eine Familie gründen, imme r kleiner wird. Diese Frauen bilden aber bisher die Gruppe der potenziellen Mütter mit mehreren Kindern. Damit der Anteil der Mütter mit mehr als zwei Kindern künftig nicht sinkt, wäre angesichts des steigenden Alters der Erstgebärenden erforderlich, dass sich die aktuell noch stabilen mehrjährigen Abstände zwischen den einzelnen Geburten verringern. 2009 bis 2012 betrug der mediane Abstand zwischen der ersten und dritten Geburt der Mutter konstant gut sieben Jahre.
Die Relation zwischen Frauen ohne Kind und Müttern im gebärfähigen Alter (temporäre Kinderlosigkeit) hat sich seit 2008 je nach Alter der Frauen unterschiedlich stark verändert. Besonders deutlich sank der Anteil der Kinderlosen bei den Frauen im Alter von 25 bis 33 Jahren. Dies betrifft die Geburtsjahrgänge 1979 bis 1983. Innerhalb von vier Jahren verringerte sich die Kinderlosenquote in diesen Jahrgängen um bis zu 20 Prozentpunkte. Ab dem Alter von 39 Jahren sank sie dagegen nur noch ganz geringfügig. Ab dem Alter von 41 Jahren kann die Kinderlosen quote statistisch als endgültig betrachtet werden.
Die Kinderlosenquote bei den 40- bis 44-jährigen Frauen betrug im Jahr 2012 22 %. Im früheren Bundesgebiet war sie mit 23 % deutlich höher als in den neuen Ländern (15 %). Im Vergleich zu 2008 ist die Kinderlosenquote vor allem in den neuen Ländern gestiegen (15 % gegenüber 10 %). Im früheren Bundesgebiet betrug die Zunahme dagegen lediglich ein Prozentpunkt. Besonders ausgeprägt ist die Kinderlosigkeit in den Stadtstaaten. In Hamburg ist der Anteil der Frauen ohne Kind mit 32 % am höchsten. Deutschlandweit die geringsten Kinderlosenquoten hatten Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit jeweils 14 %. Unter den westlichen Flächenländern war der Anteil im Saarland (20 %) und in Baden-Württemberg (21 %) am niedrigsten. Statistisches Bundesamt, Geburtentrends und Familiensituation in Deutschland, 2013 [<8]
Drei von zehn westdeutschen Akademikerinnen
im Alter zwischen 45 und 49 Jahren haben kein Kind geboren. Im Hinblick
auf die weitere Entwicklung ist allerdings zu erwarten, dass Akademikerinnen
der etwa s jüngeren Jahrgänge (1968 bis 1972) zu weniger als
30 % kinderlos bleiben werden. Sie hatten die 30 %-Marke bereits im Jahr
2012 erreicht. Bei gleichem Geburtenverhalten wie bei den fünf Jahre
älteren
Frauen würde ihre Kinderlosenquote in den nächsten Jahren voraussichtlich
noch um weitere zwei Prozentpunkte sinken.
Bei den Frauen ohne einen
akademischen Bildungsabschluss , die rund 80 % eines Jahrgangs stellen,
ist dagegen mit einem weiteren Anstieg des Anteils der Frauen ohne Kind
zu rechnen. Dies gilt auch für die Frauen in den neuen Ländern.
Auch heutzutage gehen Mütter deutlich seltener einer Erwerbstätigkeit nach als Väter: 2012 waren sechs von zehn Frauen mit minderjährigen Kindern (60 %) in Deutschland aktiv erwerbstätig. Für Männer ist eine Familiengründung dagegen kaum mit einer beruflichen Veränderung verbunden. Von den Vätern mit minderjährigen Kindern waren 84 % erwerbstätig.
Je jünger die Kinder sind, desto seltener sind die Mütter berufstätig: 2012 war knapp ein Drittel (32 %) der Mütter mit jüngstem Kind im Krippenalter von unter drei Jahren aktiv erwerbstätig. Von den Müttern mit jüngstem Kind im Kindergartenalter (3 bis 5 Jahre) waren es 62 %. Kommen die Kinder ins Grundschulalter (6 bis 9 Jahre), waren 68 % der Mütter berufstätig, bei den Müttern mit jüngstem Kind zwischen 10 und 14 Jahren liegt der Anteil bei 72 %.
Bei Müttern mit jüngstem Kind im Säuglingsalter (bis unter einem Jahr) liegt die Erwerbstätigenquote erwartungsgemäß besonders niedrig; im Jahr 2012 waren rund 9 % dieser Mütter aktiv erwerbstätig.
Von allen aktiv erwerbstätigen Müttern mit jüngstem Kind unter drei Jahren waren im Jahr 2012 rund 70 % in Teilzeit tätig, die übrigen 30 % in Vollzeit. Ostdeutsche Mütter (zu 53 %) sind dabei wesentlich häufiger auf Vollzeitbasis tätig als die Mütter im Westen Deutschlands, wo die Vollzeitquote mit 22 % deutlich niedriger liegt.
Jede zehnte erwerbstätige Mutter mit jüngstem Kind unter drei Jahren hatte 2012 ein wöchentliches Arbeitszeitvolumen von unter 10 Stunden. Weitere 21 % dieser Mütter arbeiteten 10 bis 19 Stunden wöchentlich. Insgesamt übte somit knapp ein Drittel (31 %) der erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter drei Jahren die berufliche Tätigkeit mit weniger als 20 Wochenstunden aus.
Bei mehr als der Hälfte der Paare mit Kindern im Alter von unter drei Jahren (53 %) war im Jahr 2012 der Vater – als Alleinverdiener der Familie – aktiv erwerbstätig. Bei 29 % dieser Paare gingen sowohl der Vater als auch die Mutter aktiv einer Erwerbstätigkeit nach. Bei 14 % dieser Paare war keiner der Partner aktiv erwerbstätig, bei 3 % war ausschließlich die Mutter berufstätig.
Bei mehr als zwei Drittel (69 %) der „Doppelverdiener-Paare“ mit Kindern unter drei Jahren war der Vater vollzeittätig, während die Mutter einer Teilzeittätigkeit nachging. Bei 25 % dieser Paare arbeiteten beide Elternteile in Vollzeit.
Im Jahr 2012 gab es in Deutschland knapp 8,1 Millionen Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind. Bei der großen Mehrheit dieser Familien (85 %) lebten ein oder zwei Kinder. In 1,2 Millionen beziehungsweise 15 % dieser Familien wohnten drei oder mehr Kinder im Haushalt. Somit war lediglich rund jede siebte Familie „kinderreich“.
Eltern in Familien mit drei oder mehr Kind ern leben in Deutschland in aller Regel als verheiratetes Paar zusammen: Bei 83 % der kinderreichen Familien waren 2012 die [<10] Eltern verheiratet. Bei knapp 5 % lebten die Eltern in einer (nichtehelichen oder gleichgeschlechtlichen) Lebensgemeinschaft , bei gut 12 % der kinderreichen Familien war die Mutter oder der Vater alleinerziehend.
Auf Länderebene wies im Jahr 2012 Baden-Württemberg den höchsten Anteil an kinderreichen Familien auf (18 % aller Familien mit minderjährigen Kindern). Die niedrigsten Anteile an kinderreichen Familien verzeichneten Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit jeweils rund 9 %.
Paare mit mindestens drei Kindern leben wesentlich häufiger mit einer „traditionellen Rollenverteilung“ – das heißt der Vater ist Alleinverdiener – als Paare mit einem oder zwei Kindern: Bei 37 % dieser Paargemeinschaften war im Jahr 2012 der Vater der Alleinverdiener; bei Paaren mit einem oder zwei Kindern lag dieser Wert bei knapp 28 %. Auch bei kinderreichen Paaren war jedoch das „Doppelverdiener-Modell“ mit 44 % am häufigsten verbreitet (bei Paaren mit einem oder zwei Kindern 57 %).
Familien mit drei oder mehr Kindern haben ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko. So betrug die Armutsgefährdungsquote von Familien mit zwei Erwachsenen und drei oder mehr Kindern 2012 im Bundes durchschnitt 24,1 %. Die Quote lag damit deutlich über der für die Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern (10,7 %) sowie der Quote für Familien mit zwei Erwachsenen und einem Kind (9,8 %). Im Ländervergleich gibt es bei der Armutsgefährdung erhebliche Unterschiede.
Für 13 % der Familien mit drei oder mehr Kind ern stellten im Jahr 2012 Transferzahlungen („Hartz-IV-Leistungen“, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld I) die Haupteinkommensquelle dar. Bei den Familien mit einem Kind (9 %) beziehungsweise mit zwei Kindern (7 %) lag dieser Anteil etwas niedriger.
2011:
In Deutschland lebte 2011 jede fünfte Person allein
Pressemitteilung Nr. 242 vom 11.07.2012
"WIESBADEN – Im Jahr 2011 gab es in Deutschland
rund 15,9 Millionen Alleinlebende. Bezogen auf alle Personen in Privathaushalten
(am Hauptwohnsitz) waren das 20 % der Bevölkerung. „Jede fünfte
Person lebte 2011 allein. Die Zahl der Alleinlebenden ist damit seit 1991
deutlich gestiegen“, sagte Roderich Egeler, Präsident des Statistischen
Bundesamtes, heute bei der Vorstellung der Ergebnisse des Mikrozensus 2011
zur Situation Alleinlebender in Deutschland auf einer Pressekonferenz in
Berlin. Vor 20 Jahren gab es 11,4 Millionen Alleinlebende – damals lag
die Alleinlebendenquote bei 14 %.
Weitere zentrale Ergebnisse
waren:
- Der Anteil alleinlebender Männer ist gestiegen: Zwischen 1991 und 2011 erhöhte sich die Alleinlebendenquote der Männer von 11 % auf 19 %. Vergleichsweise moderat stieg dagegen der Anteil der alleinlebenden Frauen von 18 % auf 21 %.
- Die Alleinlebendenquote nimmt mit der Größe der Städte zu: In Großstädten mit mindestens 500 000 Einwohnern lebten im Jahr 2011 knapp 29 % der Bevölkerung allein. In kleinen Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern waren es nur 14 %. Im Vergleich der Bundesländer wies Berlin mit 31 % die höchste Alleinlebendenquote auf, Rheinland-Pfalz die niedrigste (16 %).
- Während im jungen und mittleren Alter Männer häufiger als Frauen einen Einpersonenhaushalt führen, sind es im höheren Alter eher die Frauen: Bei jungen Männern von 18 bis 34 Jahren betrug die Alleinlebendenquote 2011 rund 27 %, bei Frauen waren es 20 %. Auch im mittleren Alter von 35 bis 64 Jahren lag der Anteil der alleinlebenden Männer (22 %) über dem entsprechenden Anteil bei den Frauen (15 %). Dagegen lebten im höheren Alter ab 65 Jahren rund 45 % der Frauen, aber lediglich 19 % der Männer allein.
- 2011 waren 60 % der alleinlebenden Männer im Alter von 35 bis 64 Jahren echte „Junggesellen“, die noch nie verheiratet waren. Bei den alleinlebenden Frauen in der entsprechenden Altersgruppe war der Anteil der Ledigen mit 42 % deutlich niedriger.
- Bei der Erwerbsbeteiligung zeigen sich vor allem Unterschiede zwischen alleinlebenden und nicht alleinlebenden Männern: 2011 gingen von den alleinlebenden Männern von 35 bis 64 Jahren 74 % einer Erwerbstätigkeit nach. Damit lag ihre Erwerbsbeteiligung deutlich unter der Erwerbstätigenquote der nicht alleinlebenden Männer dieser Altersgruppe (85 %). Die alleinlebenden Frauen im mittleren Alter waren hingegen genauso häufig berufstätig wie die nicht alleinlebenden Frauen (jeweils 71 %).
- Alleinlebende Frauen sind häufiger in Führungspositionen als nicht alleinlebende Frauen: Von allen abhängig beschäftigten Frauen im mittleren Alter (von 35 bis 64 Jahren), die in einem Einpersonenhaushalt lebten, hatten 2011 gut 17 % eine Führungsposition inne. Der Anteil der Führungskräfte unter den Nicht-Alleinlebenden war mit 13 % geringer. Umgekehrt verhält es sich bei den Männern: Hier waren 21 % der alleinlebenden Männer mittleren Alters in einer Führungsposition. Bei Männern, die mit anderen Personen in einem Haushalt zusammen wohnten, lag der Anteil höher, und zwar bei 26 %.
- Mehr als zwei Drittel (68 %) der Alleinlebenden im Alter von 35 bis 64 Jahren finanzierten sich 2011 überwiegend aus eigener Erwerbstätigkeit. Für 17 % waren Transferzahlungen, also Hartz IV-Leistungen, Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe, die Haupteinkommensquelle. Über Renten- oder Pensionszahlungen finanzierten sich 13 %. Sonstige Einkunftsarten wie Einkünfte von Angehörigen gaben nur 3 % der Alleinlebenden mittleren Alters an."
Mütter
mit mehreren Kindern haben mit Familiengründung früher begonnen.
destatis Pressemitteilung Nr. 179 vom 24.05.2012
"WIESBADEN – Mütter, die mehr als zwei Kinder geboren haben, haben
mit der Familiengründung früher begonnen: Sie waren nach Mitteilung
des Statistischen Bundesamtes (Destatis) bei ihrer ersten Geburt durchschnittlich
26 Jahre alt und damit drei Jahre jünger als Mütter von Einzelkindern
(29 Jahre). Dieser Befund bezieht sich auf Mütter der Jahrgänge
1959 bis 1968, die zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 40 und 49 Jahre
alt waren. Die Zahl ihrer leiblichen Kinder kann als nahezu endgültig
betrachtet werden.
Mütter der Geburtsjahrgänge 1959 bis 1968
haben durchschnittlich zwei Kinder zur Welt gebracht. Etwa jede dritte
Mutter hat nur ein Kind (31 %), jede zweite zwei Kinder (48 %) und jede
fünfte drei oder mehr Kinder (21 %).
Der Zusammenhang zwischen dem Alter bei der ersten
Geburt und der Zahl der Kinder gilt für Mütter mit unterschiedlichem
Bildungsstand. Mütter mit einem akademischen Abschluss bekamen zwar
ihr erstes Kind im Durchschnitt später als Mütter, die eine Lehre
oder Anlernausbildung abgeschlossen haben (31 Jahre gegenüber 28 Jahre).
Aber auch Akademikerinnen mit drei oder mehr Kindern waren bei der ersten
Geburt mit 29 Jahren deutlich jünger als die gleich qualifizierten
Mütter mit nur einem Kind (33 Jahre).
Methodischer Hinweis: Die hier erstmalig veröffentlichten
Angaben zum Alter der Mutter bei ihrer ersten Geburt im Zusammenhang mit
der Gesamtzahl ihrer Kinder beruhen auf einer Sonderauswertung des Mikrozensus
2008. Die Mikrozensuserhebung 2008 enthält die Angaben zur Zahl der
Kinder und zu sozioökonomischen Merkmalen einer Frau. Die Geburtsdaten
der leiblichen Kinder der Mutter wurden allerdings nicht direkt erfragt.
Für diese Auswertung wurden deshalb nur solche Fälle herangezogen,
bei denen die Zahl der leiblichen Kinder der Mutter mit der Zahl der Kinder
in der Familie oder Lebensgemeinschaft übereinstimmte. Zugleich gaben
die Kinder an, dass die betroffene Person ihre Mutter ist."
2010:
In fast jedem dritten Haushalt leben Senioren
Pressemitteilung des Statistischen
Bundesamtes Nr. 366 vom 30. September 2011
"WIESBADEN -Im Jahr 2010 lebte in 30 % der 40,3
Millionen Privathaushalte in Deutschland nach aktuellen Ergebnissen des
Mikrozensus mindestens eine Person im Seniorenalter ab 65 Jahren. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag der älteren
Menschen am 1. Oktober 2011 weiter mitteilt, betrug der Anteil der Seniorenhaushalte
vor rund 20 Jahren (1991) lediglich 26 %.
Rund 81 % der insgesamt 12,1
Millionen Seniorenhaushalte im Jahr 2010 waren "reine" Seniorenhaushalte
(knapp 9,8 Millionen), das heißt Haushalte, in denen ausschließlich
Personen ab 65 Jahren wohnten. In weiteren knapp 2,4 Millionen Haushalten
lebten sowohl Personen im Seniorenalter als auch Jüngere unter einem
Dach zusammen.
Die Haushalte mit älteren
Menschen sind im Durchschnitt kleiner als die Haushalte, in denen keine
Senioren leben. So lebten 2010 in einem reinen Seniorenhaushalt durchschnittlich
1,44 Personen, dagegen wohnten in den Haushalten ohne Senioren im Schnitt
2,20 Personen. Die durchschnittliche Haushaltsgröße aller 40,3
Millionen Privathaushalte in Deutschland betrug 2,03 Personen.
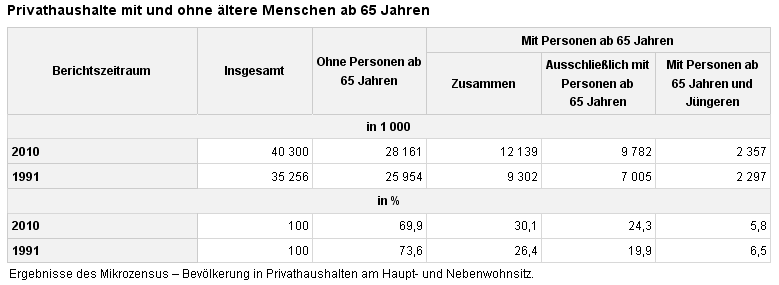
Ältere Menschen in Deutschland und in der
EU: PDF."
2009:
Jedes vierte minderjährige Kind ist ein Einzelkind
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 329
vom 20.09.2010
"WIESBADEN - Im Jahr 2009 lebten 25% der 13,3 Millionen minderjährigen
Kinder in Deutschland ohne Geschwister in einem Haushalt. Das teilt das
Statistische Bundesamt (Destatis) zum Weltkindertag am 20. September mit.
Knapp die Hälfte der minderjährigen Kinder (47%) wuchs mit einem
weiteren Geschwisterkind im Haushalt auf. 28% hatten zwei oder mehr Geschwister.
Das zeigen die aktuellen Ergebnisse des Mikrozensus, der größten
jährlichen Haushaltsbefragung in Europa. Zu den Kindern zählen
neben leiblichen auch Stief-, Pflege- und Adoptivkinder.
In Ostdeutschland lebten minderjährige Kinder
deutlich häufiger als einziges Kind im Haushalt der Eltern. 2009 waren
dort 35% Einzelkinder, in Westdeutschland waren es hingegen 23%. 44% der
ostdeutschen Minderjährigen (Westdeutschland: 48%) wurden mit einem
Geschwisterkind und 21% (Westdeutschland: 29%) mit zwei oder mehr Geschwistern
groß. Insgesamt lebten in den neuen Ländern 2,1 Millionen minderjährige
Kinder, in den alten Ländern waren es 11,2 Millionen Kinder.
Auch in den deutschen Großstädten ist
das Leben als Einzelkind weiter verbreitet als in kleineren Städten
oder Gemeinden. 29% der minderjährigen Kinder, die in einer Stadt
mit mehr als 500 000 Einwohnern lebten, wuchsen 2009 als Einzelkinder auf.
In Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern waren 23% der Minderjährigen
Einzelkinder.
Basisdaten und lange Zeitreihen zum Mikrozensus
können auch kostenfrei in der GENESIS-Online Datenbank (www.destatis.de/genesis)
über die Tabelle 12211-0104 abgerufen werden."
2008: In 221
000 Haushalten leben drei Generationen unter einem Dach
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 50
vom 15.12.2009
"Im Jahr 2008 gab es rund 221 000 Haushalte in Deutschland, in denen
Großeltern, Eltern und Enkel sowie eventuell Urenkel gemeinsam lebten.
Der Anteil dieser Haushalte mit drei und mehr Generationen an allen 40,1
Millionen Haushalten betrug damit nach Angaben des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) 0,6%. Das zeigen die Ergebnisse des Mikrozensus, der größten
jährlichen Haushaltsbefragung in Europa.
Im April 1991 gab es in Deutschland noch fast doppelt
so viele Haushalte mit drei und mehr Generationen (429 000 Haushalte oder
1,2%). Mit einem Rückgang des Anteils der Mehrgenerationenhaushalte
an allen Haushalten von 1,1% im April 1991 auf 0,4% im Jahr 2008 war die
rückläufige Entwicklung in den neuen Ländern und Berlin
etwas stärker ausgeprägt als im früheren Bundesgebiet (ohne
Berlin-West). Dort ging der Anteil dieser Haushalte von 1,2% im April 1991
auf 0,6% im Jahr 2008 zurück.
2008: Kinderlosigkeit
nimmt zu
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 283
vom 29.07.2009
"Wiesbaden - In Deutschland bleiben immer mehr Frauen ohne Kinder.
2008 hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 21% der
40- bis 44-jährigen Frauen keine Kinder zur Welt gebracht. Dagegen
waren unter den zehn Jahre älteren Frauen (Jahrgänge 1954 bis
1958) 16% und unter den zwanzig Jahre älteren (Jahrgänge 1944
bis 1948) nur 12% kinderlos. Von den Frauen zwischen 35 und 39 Jahren hatten
2008 26% noch keine Kinder, allerdings wird sich in dieser Altersgruppe
der Anteil der kinderlosen Frauen noch vermindern.
Diese und weitere zentrale Ergebnisse des Mikrozensus
2008 zur Kinderlosigkeit und zu Geburten in Deutschland hat Roderich Egeler,
Präsident des Statistischen Bundesamtes, heute auf einer Pressekonferenz
in Berlin vorgestellt.
Im Osten Deutschlands gibt es deutlich weniger kinderlose
Frauen als im Westen. Während von den 40- bis 75-jährigen Frauen
in den alten Ländern 16% keine Kinder haben, sind es in den neuen
nur 8%. Auch bei den jüngeren Frauen bestehen deutliche Unterschiede.
Von den 35- bis 39-Jährigen (Jahrgänge 1969 bis 1973) in den
alten Ländern haben bisher 28% keine Kinder, in den neuen Ländern
sind lediglich 16% kinderlos.
Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus Zusammenhänge
zwischen Bildungsstand und Kinderlosigkeit. Für Westdeutschland gilt:
je höher der Bildungsstand, desto häufiger ist eine Frau kinderlos.
Betrachtet man Frauen ab 40 Jahre, die ihre Familienplanung größtenteils
abgeschlossen haben, hatten 26% der Frauen mit hoher Bildung keine Kinder.
Dieser Anteil ist deutlich höher als bei den Frauen mit mittlerer
Bildung (16%) und mehr als doppelt so hoch wie bei den Frauen mit niedriger
Bildung (11%). Für Ostdeutschland trifft dieser Zusammenhang dagegen
nicht zu.
Vor allem Akademikerinnen aus dem Westen Deutschlands
sind überdurchschnittlich häufig kinderlos. 2008 hatten 28% der
westdeutschen Akademikerinnen im Alter von 40 bis 75 Jahren keine Kinder.
Bei den ostdeutschen Frauen mit akademischem Grad betrug dieser Anteil
lediglich 11%. Akademikerinnen aus dem Westen Deutschlands waren damit
nicht nur häufiger kinderlos als im Osten, sie hatten auch deutlich
häufiger keine Kinder als der Durchschnitt aller Frauen zwischen 40
und 75 Jahren. Zu den Akademikerinnen zählen Frauen mit Abschluss
einer Hochschule, einer Fachhochschule und einer Verwaltungsfachhochschule
sowie Frauen mit Promotion.
Die im Ausland geborenen und nach Deutschland zugewanderten
Frauen sind seltener kinderlos als die hier geborenen Frauen. So haben
von den 35- bis 44-jährigen Zuwanderinnen (Jahrgänge 1964 bis
1973) 13% keine Kinder, bei den in Deutschland geborenen Frauen sind es
25%. Unter den 25- bis 34-Jährigen haben 39% der Frauen mit Migrationserfahrung
bisher noch keine Kinder, bei den Frauen ohne Migrationserfahrung sind
es mit 61% erheblich mehr. Bei diesen jüngeren Frauen wird der Anteil
der Kinderlosen noch sinken.
Diese und weitere Angaben zur Kinderlosigkeit und
zu Geburten konnten erstmals aus dem Mikrozensus gewonnen werden. Grundlage
dafür war, dass im Jahr 2008 zum ersten Mal alle Frauen zwischen 15
und 75 Jahren gefragt wurden, ob sie Kinder geboren haben und wenn ja,
wie viele. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung
in Europa.
Detaillierte Ergebnisse zu diesen Sachverhalten
enthalten die Unterlagen zur Pressekonferenz sowie ergänzende Tabellen
unter www.destatis.de -> Presse -> Pressekonferenzen."
Querverweis: Warum sinken die Geburtenraten in Wohlstandsgesellschaften?
2007: 1,61
minderjährige Kinder je Familie
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 120
vom 26.03.2009
"Wiesbaden - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, gab
es im Jahr 2007 in Deutschland 8,6 Millionen Familien mit minderjährigen
Kindern. In diesen Familien lebten insgesamt 13,8 Millionen Kinder unter
18 Jahren, im Durchschnitt also 1,61 Kinder je Familie. Zehn Jahre zuvor
(April 1997) waren es durchschnittlich noch 1,65 Kinder. Das zeigen die
Ergebnisse des Mikrozensus, der größten jährlichen Haushaltsbefragung
in Europa.
Familien sind hier ausschließlich Eltern-Kind-Gemeinschaften
mit mindestens einem minderjährigen Kind im Haushalt. Als Kinder gelten
dabei - neben leiblichen Kindern - auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder.
Ein Vergleich zeigt deutliche Unterschiede zwischen
dem früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) und den neuen Ländern
(einschließlich Berlin). 2007 versorgte eine westdeutsche Familie
mit minderjährigen Kindern durchschnittlich 1,64 Kinder unter 18 Jahren,
eine ostdeutsche Familie 1,46. Der Rückgang der durchschnittlichen
Kinderzahl je Familie
gegenüber 1997 fiel in Ostdeutschland stärker aus als in
Westdeutschland: Im April 1997 zog eine westdeutsche Familie mit Kindern
unter 18 Jahren durchschnittlich 1,69 minderjährige Kinder groß,
eine entsprechende ostdeutsche Familie im Durchschnitt 1,53.
Hinter dieser Entwicklung steht im Westen und insbesondere
im Osten Deutschlands ein Rückgang sowohl der Zahl der Familien mit
Kindern unter 18 Jahren als auch der durchschnittlichen Zahl der in diesen
Familien aufwachsenden minderjährigen Kinder. In den neuen Ländern
sank die Zahl der entsprechenden Familien seit 1997 um fast 31% und die
Zahl der von diesen Familien betreuten minderjährigen Kinder um rund
34%. Im früheren Bundesgebiet war der Rückgang im Vergleichszeitraum
weniger stark ausgeprägt. Die Zahl der Familien mit minderjährigen
Kindern ging hier um fast 3% zurück, die Zahl der in diesen Familien
lebenden Kinder sank um gut 5%.
Detaillierte Ergebnisse des Mikrozensus 2007 zu
weiteren Themenfeldern wie zum Beispiel Haushaltsstrukturen und Lebensformen
enthält die Fachserie 1, Reihe 3, die im Publikationsservice von Destatis
unter [Online], Suchbegriff:
"Haushalte und Familien", zum kostenlosen Download bereit steht."
2006
Jedes dritte Kind wird außerhalb einer Ehe geboren
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Zahl der
Woche vom 13.05.2008
"Wiesbaden - Während die Geburtenzahl insgesamt zurückgeht,
steigt die Anzahl der Kinder an, deren Eltern zum Zeitpunkt ihrer Geburt
nicht miteinander verheiratet waren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, wurden 2006 knapp 202 000 Kinder außerhalb einer Ehe geboren,
das waren 30% aller geborenen Kinder. 1998, als mit der Reform des Kindschaftsrechts
die Rechtsstellung nichtehelicher Kinder verbessert wurde, waren es 157
000 (20%) und 1993 118 000 Kinder (15%).
Innerhalb Deutschlands bestehen erhebliche Unterschiede:
Im Norden und Osten haben mehr Kinder Eltern, die zum Zeitpunkt ihrer Geburt
nicht miteinander verheiratet waren, als im Süden und Westen. Die
höchsten Anteile an unehelichen Geburten gab es 2006 in Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen-Anhalt mit je 63%, die niedrigsten in Baden-Württemberg
mit 20% und Hessen mit 22%."
2006
Jede zehnte Frau zwischen 25 und 54 bleibt wegen Familie zu Hause
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes ZAHL DER
WOCHE Nr. 17 vom 29. April 2008
"WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war
2006 in Deutschland jede zehnte Frau (9,9%) zwischen 25 und 54 Jahren aufgrund
familiärer Verpflichtungen nicht erwerbsaktiv - war also weder erwerbstätig
noch erwerbslos. Zu den familiären Verpflichtungen zählen unter
anderem Schwangerschaft, Kinderbetreuung sowie die Pflegebedürftigkeit
eines Familienangehörigen.
Die Quote der Frauen, die aus familiären Gründen
dem Arbeitsmarkt fern bleiben, variiert innerhalb der Europäischen
Union stark. Während das Vereinigte Königreich (1,9%), Schweden
(2,1%) und Dänemark (2,3%) sehr niedrige Quoten verzeichneten, erreichte
Malta mit 45,9% den höchsten Anteil. Auch in Irland (23,1%) und Luxemburg
(21,7%) stand mehr als jede fünfte Frau dem Arbeitsmarkt aus familiären
Gründen nicht zur Verfügung. Diese Daten veröffentlichte
Eurostat, das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, auf
Basis der von den nationalen Statistikämtern nach dem Labour-Force-Konzept
der International Labour Organization (ILO) ermittelten Daten. Dieses ermöglicht
internationale Vergleiche von Arbeitsmärkten. Als erwerbslos gilt
dabei im Sinne der durch die EU konkretisierten ILO-Abgrenzung jede Person
im Alter von 15 bis 74 Jahren, die nicht erwerbstätig war, aber in
den letzten vier Wochen vor der Befragung aktiv nach einer Tätigkeit
gesucht hat und diese innerhalb von zwei Wochen aufnehmen könnte.
Auf den zeitlichen Umfang der gesuchten Tätigkeit kommt es nicht an."
Frauen
werden heute im Durchschnitt mit 26 Jahren Mutter
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 511
vom 18. Dezember 2007
"WIESBADEN - Das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt
ihrer Kinder hat sich in Deutschland in den 1960er Jahren zunächst
verringert und ist danach angestiegen. Die heute 30- bis 44-jährigen
Frauen bekamen ihr erstes Kind im Durchschnitt mit 26 Jahren und waren
damit etwa drei Jahre älter als die Mütter mit ersten Kindern
in den 1960er Jahren. Mit dem Anstieg des Alters der Mütter bei der
ersten Geburt ging in Deutschland bisher der Rückgang der Kinderzahl
einher, die eine Frau im Laufe des Lebens bekommt. Der Anstieg des durchschnittlichen
Alters der Frauen bei der ersten Geburt hat sich zuletzt nicht mehr fortgesetzt,
wobei diese Entwicklung durch die alten Bundesländer geprägt
wurde.
Diese Ergebnisse stammen aus einer Sondererhebung
zu Geburten und Kinderlosigkeit, die Dr. Sabine Bechtold, Abteilungsleiterin
im Statistischen Bundesamt, heute in Berlin vorgestellt hat. Mit der Erhebung
werden die Informationen zu den Geburten, die laufend aus der Geburtenstatistik
und dem Mikrozensus gewonnen werden, ergänzt. Die freiwillige Erhebung
wurde im Herbst 2006 durchgeführt. Dazu gaben etwa 12 500 Frauen zwischen
16 und 75 Jahren Auskunft. Die Sondererhebung bietet repräsentative
Ergebnisse für Deutschland sowie die alten und die neuen Länder.
Die Entwicklung des Durchschnittsalters der Mütter
bei ihrem ersten Kind verlief in Deutschland lange parallel zum Heiratsalter.
Die Frauen der Jahrgänge 1931 bis 1936 waren bei der Geburt des ersten
Kindes im Durchschnitt etwa 25 Jahre alt gewesen. Die etwa zehn Jahre jüngeren
Frauen (Jahrgänge 1942 bis 1946) bekamen ihr erstes Kind bereits mit
durchschnittlich 23 Jahren; diese Kinder gehörten zu den geburtenstarken
Jahrgängen der 1960er Jahre. Bei den jüngeren Frauenjahrgängen
(1947 bis 1966) stieg das Durchschnittsalter beim ersten Kind dann wieder
an, bei den 1962 bis 1976 geborenen Müttern beträgt es 26 Jahre.
Diese Zunahme des Durchschnittsalters bei der ersten Geburt war vor
allem in den alten Bundesländern (ohne Berlin) zu beobachten. Zuletzt
stagnierte diese Kennziffer hier allerdings. Bei den Frauen der Jahrgänge
1967 bis 1971 blieb sie bei 27 Jahren und damit genauso hoch wie bei den
fünf Jahre älteren Frauen (Jahrgänge 1962 bis 1966). In
den neuen Ländern gab es zunächst längere Zeit keinen solchen
Anstieg. Dementsprechend waren die Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes
deutlich jünger als in den alten Ländern. Erst bei den Frauen,
die Mitte der 1960er Jahre geboren wurden, nahm das Alter bei der Geburt
des ersten Kindes zu. Für die 1967 bis 1971 geborenen Frauen beträgt
es 24 Jahre. Bei den fünf Jahre jüngeren Frauen steigt es weiter
an. Hier dürften die Veränderungen der Lebensverhältnisse
seit der Wiedervereinigung eine Rolle gespielt haben.
Mit dieser Sondererhebung legt die amtliche Statistik
erstmals auch umfassende Angaben zur Kinderlosigkeit vor. Ein gewisses
Maß an Kinderlosigkeit ist in Deutschland nichts Neues. In den letzten
etwa 20 Jahren ist sie allerdings deutlich angestiegen. Von den Frauen,
die 1957 bis 1966 geboren wurden und die zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen
40 und 49 Jahre alt waren, hatten 21% keine Kinder. Daran wird sich voraussichtlich
nichts wesentliches mehr ändern, da nur noch wenige Frauen in diesem
Alter erstmals Mutter werden. Unter den zehn Jahre älteren Frauen
(Jahrgänge 1947 bis 1956) hatten 16% keine Kinder. In den alten Bundesländern
ist der Anteil der kinderlosen Frauen bisher deutlich höher gewesen
als in den neuen Ländern. Unter den Frauen der Jahrgänge 1957
bis 1966 haben in den alten Ländern 23% keine Kinder, in den neuen
Ländern sind nicht einmal halb so viele kinderlos.
Die Kinderlosigkeit steigt mit dem Bildungsstand
an. In Deutschland hat unter den 40 bis 75 Jahre alten Frauen (Geburtsjahrgänge
1931 bis 1966) jede siebte mit niedrigem (weder Abitur oder Fachabitur,
noch berufliche Ausbildung), aber jede fünfte Frau mit hohem Bildungsstand
(Fachschul-, Fachhochschul- oder Hochschulabschluss) keine Kinder. Dieser
Zusammenhang ist charakteristisch für die alten Bundesländer.
Hier hat jede vierte Frau dieses Alters mit hoher Bildung keine Kinder,
bei den Frauen mit niedriger Bildung ist es nur jede achte. In den neuen
Ländern ist dagegen der Anteil der Kinderlosen insgesamt erheblich
niedriger und nimmt mit dem Bildungsstand nicht zu.
Zum Hintergrund der Befragung
Mit der Sondererhebung zu Geburten und Kinderlosigkeit wurden Fragestellungen
untersucht, zu denen aus den laufenden Statistiken bisher keine oder nur
unvollständige Angaben vorlagen. So werden in der Geburtenstatistik
zwar alle in Deutschland geborenen Kinder nachgewiesen, unabhängig
davon, ob die Eltern verheiratet sind oder nicht oder um das wievielte
Kind es sich handelt. Wie viele Kinder die Mutter zuvor geboren hatte,
wurde bisher allerdings bei einer Geburt nicht vollständig festgestellt,
vielmehr wurden bei dieser Frage nur in der aktuellen Ehe geborene Kinder
"mitgezählt". Die bisher ermittelten Angaben zum Durchschnittsalter
beim ersten Kind bezogen sich daher stets nur auf das erste Kind der aktuellen
Ehe. Aus dem Mikrozensus liegen Angaben zum Zusammenleben von Eltern und
Kindern und eine Reihe von Informationen zur sozialen und ökonomischen
Lage der Familien vor. Kinder, die den elterlichen Haushalt verlassen haben,
werden dabei nicht berücksichtigt. Damit konnten bisher keine Aussagen
zur tatsächlichen Kinderlosigkeit der Frauen getroffen werden.
Wegen der Bedeutung dieser demografischen Angaben
werden ab 2008 der Mikrozensus um die Frage nach der Zahl der von einer
Frau geborenen Kinder und die Geburtenstatistik um die Feststellung der
Geburtenfolge für alle Kinder - also das Miteinrechnen sämtlicher
zuvor geborener Kinder bei der Zählung - erweitert.
Weitere Informationen und die Infobroschüre
"Geburten in Deutschland" mit Ergebnissen der Geburtenstatistik und der
Sondererhebung stehen im Internet unter http://www.destatis.de, Pfad: Presse
-> Pressekonferenzen zur Verfügung."
2006: Familienformen in Deutschland
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 481 vom 28. November 2007
"Im Osten ist der Anteil alternativer Familienformen höher als
im Westen
WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben 2006 in
den neuen Ländern alternative Familienformen einen Anteil von 42%
an den Familien insgesamt erreicht. Zu den alternativen Familienformen
zählen Alleinerziehende und Lebensgemeinschaften mit Kindern. Im früheren
Bundesgebiet lag deren Anteil nur bei 22%, bundesweit betrug er 26%.
Nach Ländern betrachtet machten alternative
Familienformen 2006 fast die Hälfte (47%) aller 330 000 Berliner Familien
aus. Den niedrigsten Anteil verzeichnete Baden-Württemberg. Dort gehörte
von den 1,2 Millionen Familien nur jede fünfte (20%) zu diesen Formen.
Dies sind einige der aktuellen Ergebnisse des Mikrozensus 2006, die Walter
Radermacher, Präsident des Statistischen Bundesamtes, heute in Berlin
vorgestellt hat.
Im Jahr 2006 lebten in Deutschland insgesamt 8,8
Millionen Familien. 1996 waren es noch 9,4 Millionen (- 7%). Während
im gleichen Zeitraum die Zahl alternativer Familienformen um 30% auf 2,3
Millionen in 2006 anstieg, ging die Zahl der Ehepaare mit Kindern um 16%
auf 6,5 Millionen zurück. Trotz wachsender Bedeutung der alternativen
Familienformen machten Ehepaare mit Kindern 2006 jedoch immer noch knapp
drei Viertel (74%) der Familien in Deutschland aus. Ihr Anteil an allen
Familien variierte in den Ländern von 53% in Berlin bis 80% in Baden-Württemberg.
Der Mikrozensus ist die größte jährliche
Haushaltsbefragung in Europa. Als Familien werden hier ausschließlich
Eltern-Kind-Gemeinschaften mit mindestens einem minderjährigen und
gegebenenfalls weiteren minder- oder volljährigen Kindern im Haushalt
verstanden. Detaillierte Ergebnisse des Mikrozensus 2006
zu diesem Sachverhalt enthalten die ergänzenden Tabellen zur Pressekonferenz,
die im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de
(Pfad: Presse/Pressekonferenzen) kostenlos abrufbar sind.
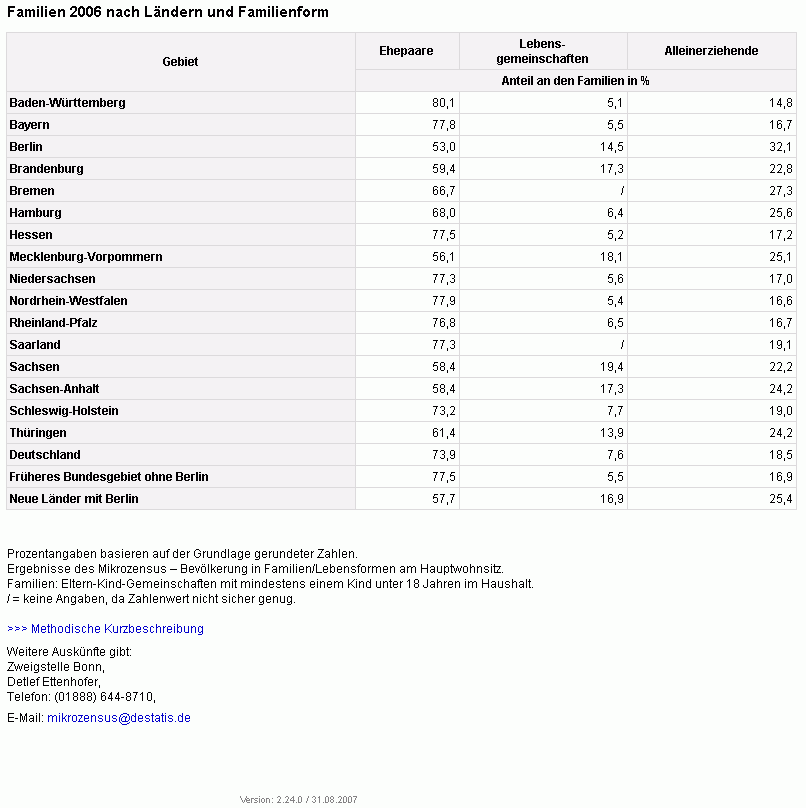
"
2006:
Alleinstehende Frauen sind oft älter als 65, alleinstehende Männer
seltener
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes ZAHL DER
WOCHE 10 vom 11. März 2008.
"WIESBADEN - Alleinstehende Frauen und Männer in Deutschland unterscheiden
sich in ihrer Altersstruktur und nach ihrem Familienstand grundlegend:
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, handelt es sich bei
alleinstehenden Frauen zum Großteil um Frauen im Seniorenalter, während
nur ein kleiner Teil der alleinstehenden Männer Senioren sind. Im
Jahr 2006 waren 50% der knapp 9,0 Millionen alleinstehenden Frauen 65 Jahre
und älter, während der Anteil der Senioren an den rund 7,5 Millionen
alleinstehenden Männern lediglich bei 17% lag.
Die unterschiedliche Struktur der Alleinstehenden
in Deutschland zeigen die Ergebnisse des Mikrozensus, der größten
jährlichen Haushaltsbefragung in Europa. Demnach unterscheiden sich
alleinstehende Frauen und Männer auch nach dem Familienstand. So waren
alleinstehende Frauen im Jahr 2006 am häufigsten verwitwet (45%),
während bei alleinstehenden Männern der Anteil der Ledigen (63%)
am höchsten lag. Die Mehrzahl der alleinstehenden Frauen lebte überwiegend
von Rente oder Pension (56%), während alleinstehende Männer ihren
überwiegenden Lebensunterhalt mehrheitlich durch Erwerbstätigkeit
(55%) bestritten.
Zu den Alleinstehenden zählen im Mikrozensus
alle Personen, die ohne Ehe-/Lebenspartner(in) und ohne Kinder leben."
Bei mehr als der Hälfte der Paare mit Kindern arbeiten beide Partner
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 199 vom 14.05.2007
"WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt zum Internationalen Tag der Familie am 15. Mai 2007 mitteilt, arbeiteten im Jahr 2005 von den Paaren mit Kindern in Deutschland bei mehr als der Hälfte beide Partner. Bei 51% der Ehepaare mit Kindern übten Mutter und Vater eine Erwerbstätigkeit aus. Bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften waren es mit 54% noch etwas mehr. Das zeigen die aktuellen Ergebnisse des Mikrozensus, der größten jährlichen Haushaltsbefragung in Europa. Betrachtet wurden 5,5 Millionen Ehepaare und 605.000 nichteheliche Lebensgemeinschaften, bei denen beide Partner im erwerbsfähigen Alter sind und mindestens ein Kind unter 15 Jahren lebt. Zu den Kindern zählen dabei - neben leiblichen Kindern - auch Stief-, Pflege- und Adoptivkinder.
Die Ergebnisse des Mikrozensus zeigen weiter, dass bei 37% der Ehepaare ausschließlich der Vater erwerbstätig war. Bei 7% der Ehepaare übte keiner der Partner eine Erwerbstätigkeit aus (einschließlich vorübergehend Beurlaubte) und bei 5% war ausschließlich die Mutter erwerbstätig. Deutlich niedriger als bei Ehepaaren lag bei Lebensgemeinschaften mit 26% der Anteil der Paare, bei denen ausschließlich der Vater Erwerbstätiger war. Gleichzeitig war der Anteil der Paare, bei denen keiner der Partner eine Erwerbstätigkeit ausübte, bei Lebensgemeinschaften mit 13% nahezu doppelt so hoch wie bei Ehepaaren. Bei 7% der Lebensgemeinschaften ging ausschließlich die Mutter einer Erwerbstätigkeit nach.
Der Zeitumfang der Erwerbsbeteiligung von Ehepaaren und Lebensgemeinschaften mit Kindern und mit zwei erwerbstätigen Partnern unterscheidet sich deutlich. Bei 73% der betrachteten Ehepaare stufte sich der Vater bei der Befragung als vollzeit- und die Mutter als teilzeiterwerbstätig ein. Auch die Paare, die in Lebensgemeinschaft lebten, gingen mit 53% dieser Arbeitszeitkombination nach. Bei 23% der Ehepaare übten beide Elternteile einer Vollzeittätigkeit aus, bei den Lebensgemeinschaften betrug dieser Anteil mit 41% fast das Doppelte. Andere mögliche Arbeitszeitaufteilungen spielten im Jahr 2005 eine eher untergeordnete Rolle.
Diese und viele weitere aktuelle Mikrozensusergebnisse zur Erwerbsbeteiligung von Müttern und Vätern enthält das Sonderheft 2 "Vereinbarkeit von Familie und Beruf", welches neben textlichen Analysen und zahlreichen Schaubildern einen ausführlichen Tabellenanhang enthält.
Zwei von drei Kindern werden mit Geschwistern groß
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 388 vom 19. September 2006
"WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt zum Weltkindertag am 20.
September mitteilt, haben im Jahr 2005 rund zwei Drittel (69%) der 20,7
Millionen Kinder in Deutschland mit mindestens einem minder- oder volljährigen
Geschwisterkind gemeinsam in einem Haushalt gelebt. Rund jedes dritte Kind
(31%) wuchs dementsprechend ohne Geschwister im Haushalt auf. Das zeigen
die aktuellen Ergebnisse des Mikrozensus, der größten jährlichen
Haushaltsbefragung in Europa.
Zu den Kindern zählen im Mikrozensus alle minder-
und volljährigen ledigen Personen, die ohne Lebenspartner(in) und
ohne eigene Kinder mit mindestens einem Elternteil im Haushalt zusammen
leben. Als Kinder gelten dabei - neben leiblichen Kindern - auch Stief-,
Adoptiv- und Pflegekinder.
Die Ergebnisse des Mikrozensus zeigen weiter, dass
von den 14,4 Millionen minderjährigen Kindern im Jahr 2005 ein Viertel
(25%) ohne weitere Geschwister im Haushalt groß wurde. Fast die Hälfte
der minderjährigen Kinder (48%) wuchs gemeinsam mit einem minder-
oder volljährigen Geschwisterkind heran. Dabei hatte rund jedes fünfte
minderjährige Kind (19%) zwei Geschwister, knapp jedes zehnte Kind
(8%) teilte den Haushalt mit mindestens drei Geschwistern.
Von den 6,3 Millionen volljährigen Kindern,
die im Jahr 2005 noch im elterlichen Haushalt wohnten, lebten 45% ohne
Schwester und Bruder. 38% der volljährigen Kinder teilten den Haushalt
mit einem minder- oder volljährigen Geschwisterkind, 12% mit zwei
Geschwistern und 5% mit drei Geschwistern und mehr.
Weitere Ergebnisse des Mikrozensus 2005 zu den Lebensformen
der Bevölkerung, zu Haushaltsstrukturen oder zur Gesundheitssituation
der Bevölkerung und vielen anderen Themen enthält die Pressebroschüre
"Leben in Deutschland - Haushalte, Familien und Gesundheit", die zusammen
mit einem umfangreichen Tabellenanhang im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes zum kostenlosen Download bereit steht."
Arbeitszeiten von Eltern
Arbeitszeiten von
Eltern 2000-2007
8.4.11 Institut Arbeit und Qualifikation (Uni Duisburg): "Untersuchung
der Arbeitszeiten von Eltern
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird viel
diskutiert. Ehe und Kinder bestimmen aber nach wie vor, ob und in welchem
Umfang eine Frau berufstätig sein kann. Mütter arbeiten heute
zwar etwas häufiger, investieren aber deutlich weniger Stunden pro
Woche als noch im Jahr 2001. Das zeigen aktuelle Untersuchungen aus dem
Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen.
Durchschnittlich haben westdeutsche Frauen je nach Alter ihrer (minderjährigen)
Kinder ein Wochenpensum zwischen 6,3 und 19,1 Arbeitsstunden. Das hat die
IAQ-Arbeitsmarktforscherin Christine Franz aus Mikrozensus-Daten berechnet.
Selbst die Mütter der 15- bis 17-Jährigen stehen damit dem Arbeitsmarkt
nur mit halber Kraft zur Verfügung. In Ostdeutschland arbeiten schon
die Mütter von 3- bis 5-Jährigen durchschnittlich 20 Wochenstunden,
allerdings steigt auch hier der Wert nur auf 25 Stunden bei Frauen mit
fast volljährigen Kindern. „Der Vergleich von 2000 zu 2007 zeigt,
dass die Arbeitsvolumina in fast allen Altersgruppen gesunken sind“, so
die Wissenschaftlerin.
Vor allem der Anteil der vollzeitbeschäftigen
Mütter ist zurückgegangen, stellt Christine Franz fest. Selbst
bei schon 15-jährigen und älteren Kindern arbeitet nur rund jede
vierte Vollzeit. In Ostdeutschland liegen die Müttererwerbstätigkeit
und auch der Vollzeitanteil höher. Jedoch sind hier die Erwerbstätigenquoten
bei den Frauen mit Schulkindern (jüngstes Kind zwischen 6 und 17 Jahren)
teilweise deutlich gesunken.
Die hohe Erwerbsbeteiligung der Väter – im
Westen noch höher als im Osten – bleibt demgegenüber weitgehend
unabhängig vom Alter der Kinder, wie der Geschlechtervergleich für
das Jahr 2007 belegt. Ebenso der Umfang: Nur ca. 3 bis 4 Prozent der westdeutschen
Väter arbeiten Teilzeit. Zwar liegt der Anteil in Ostdeutschland etwas
höher, jedoch muss davon ausgegangen werden, dass die Teilzeitbeschäftigung
hier (wie auch bei ostdeutschen Frauen) häufig nicht freiwillig gewählt
wird. Lediglich bei einem kleinen Teil der Väter mit Kindern unter
2 Jahren sieht Christine Franz Indizien für eine familiär bedingte
Arbeitszeitreduzierung. Das Erwerbsverhalten von Männern insgesamt
scheine bisher nicht familienfreundlicher geworden zu sein."
Frauen
2013 Erwerbstätige Mütter sind im Schnitt 27 Stunden pro Woche berufstätig.
1998-2008: Mütter arbeiten immer häufiger in Teilzeit.
2008: Frauen in den Parlamenten weltweit unterrepräsentiert.
2013 Erwerbstaetige Muetter
sind im Schnitt 27 Stunden pro Woche berufstaetig
Pressemitteilung Nr. 171 vom 12.05.2015:
"WIESBADEN – Im Jahr 2013 betrug die durchschnittliche Arbeitszeit
von erwerbstätigen Müttern im Alter von 25 bis 49 Jahren rund
27 Stunden pro Woche. Gleichaltrige Frauen ohne im Haushalt lebendes Kind
waren durchschnittlich gut 37 Stunden wöchentlich berufstätig
und somit rund 10 Stunden mehr als Frauen mit Kindern. Das teilt das Statistische
Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen Familientages
am 15. Mai auf Basis der Ergebnisse des Mikrozensus, der größten
jährlichen Haushaltsbefragung in Deutschland, mit.
Bei den 25- bis 49-jährigen erwerbstätigen
Vätern betrug die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
knapp 42 Stunden. Bei den Männern ohne Kind lag sie mit 41 Stunden
um 1 Stunde darunter.
Ostdeutsche Mütter arbeiten mit 33 Stunden
im Durchschnitt nur knapp 4 Stunden weniger als ostdeutsche Frauen ohne
Kind (37 Stunden). In Westdeutschland ist die wöchentliche Arbeitszeit
von Müttern mit 25 Stunden knapp 12 Stunden niedriger als bei den
Frauen ohne Kind (37 Stunden). Bei der wöchentlichen Arbeitszeit der
Männer zeigen sich nur geringfügige Ost-West-Unterschiede.
Im Vergleich zu 2003 hat sich die wöchentliche
Arbeitszeit deutschlandweit leicht erhöht. Den größten
Anstieg gab es bei westdeutschen Frauen ohne Kind (+ 1 Stunde). Rückläufig
war die wöchentliche Arbeitszeit dagegen bei den ostdeutschen Müttern.
Sie übten ihren Beruf gut 1 Stunde pro Woche weniger aus als noch
vor 10 Jahren. Auch ostdeutsche Männer ohne Kind arbeiteten geringfügig
kürzer als 2003.
Methodische Hinweise
Betrachtet werden hier erwerbstätige Frauen und Männer im
Alter von 25 bis 49 Jahren. Dazu zählen Ehefrauen und Ehemänner
mit und ohne Kinder, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner mit und ohne
Kinder, Alleinstehende ohne Kind sowie Alleinerziehende mit Kindern. Die
wöchentliche Arbeitszeit bezieht sich auf die normalerweise geleisteten
Wochenarbeitsstunden."
1998-2008:
Mütter arbeiten immer häufiger in Teilzeit
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 391
vom 14. Oktober 2009
"WIESBADEN - In den vergangenen zehn Jahren ist
nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) der Anteil teilzeitbeschäftigter
Mütter in Deutschland stark angestiegen. Im Jahr 2008 gingen 69% der
erwerbstätigen Mütter, die minderjährige Kinder im Haushalt
betreuten, einer Teilzeittätigkeit nach. 1998 war es erst gut die
Hälfte (53%). Die Teilzeitquote erhöhte sich somit in diesem
Zeitraum um 16 Prozentpunkte. Das zeigen die Ergebnisse des Mikrozensus,
der größten jährlichen Haushaltsbefragung in Europa.
Väter arbeiten deutlich seltener in Teilzeit
als Mütter. Im Jahr 2008 übten nur 5% der erwerbstätigen
Väter mit minderjährigen Kindern eine Beschäftigung in Teilzeit
aus. Die Teilzeitquote der Mütter von 69% war somit mehr als zehn
Mal so hoch wie bei den Vätern. Gegenüber 1998 ist bei den Vätern
der Anteil Teilzeitbeschäftigter ebenfalls angestiegen (+ 3 Prozentpunkte).
Ihre Teilzeitquote betrug damals 2%.
Auch ohne Kinderbetreuung im eigenen Haushalt hat
die Teilzeitbeschäftigung zugenommen - allerdings nicht so stark wie
bei den Müttern: Bei den Frauen ohne minderjährige Kinder erhöhte
sich die Teilzeitquote im betrachteten Zeitraum um 6 Prozentpunkte auf
36% im Jahr 2008. Bei den Männern stieg sie um 4 Prozentpunkte auf
9%. Sowohl bei den Frauen als auch den Männern handelt es sich dabei
um Personen, bei denen keine oder ausschließlich volljährige
Kinder im Haushalt lebten.
Detaillierte Informationen zur Erwerbsbeteiligung
von Müttern und Vätern können auch kostenfrei über
die Tabelle 12211-0606 in der GENESIS-Online Datenbank über www.destatis.de/genesis
abgerufen werden.
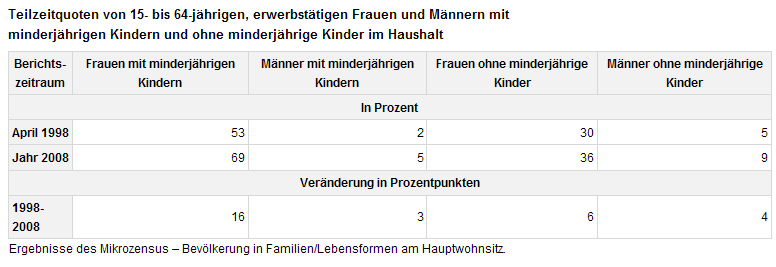
"
2008: Frauen
in den Parlamenten weltweit unterrepräsentiert
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 097
vom 06.03.2008
"Wiesbaden - Weltweit sind Frauen in den Parlamenten entsprechend ihrem
Bevölkerungsanteil unterrepräsentiert. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) in Wiesbaden zum Internationalen Frauentag am 8. März mitteilt,
entfielen im Deutschen Bundestag im Februar 2008 rund 32% oder 197 der
612 Sitze auf Frauen. Bei der letzten Bundestagswahl 2005 waren ursprünglich
614 Abgeordnete, darunter 195 Frauen, gewählt worden. Veränderungen
während der Legislaturperiode ergeben sich unter anderem durch Mandatsverzichte
oder
Sterbefälle und das damit verbundene Nachfolgen von Abgeordneten;
Überhangmandate werden nicht neu besetzt.
Im Vergleich mit den anderen EU-Ländern lag
Deutschland mit dieser Frauenquote im oberen Drittel. Von allen 27 EU-Ländern
kam Schweden einer paritätischen Verteilung im Parlament am nächsten.
Ende 2007 entfielen dort 47% der Mandate auf Frauen. Es folgten Finnland
(42%), die Niederlande (39%) sowie Dänemark (38%). Außerhalb
der EU wiesen 2007 Ruanda (49%), Argentinien (40%) und Costa Rica (37%)
die höchsten Frauenanteile auf. Weitaus geringer war der Frauenanteil
zum Beispiel in China (21%), den Vereinigten Staaten (17%), der Russischen
Föderation (14%) und Japan (9%). Diese Daten wurden von der Interparlamentarischen
Union (IPU) erhoben. Für die Studie wurden Angaben von 188 Staaten
berücksichtigt."
- 2009-2Q: 5,3% weniger Schwangerschaftsabbrüche im zweiten Quartal 2009.
- 2008-1Q 2,5% weniger Schwangerschaftsabbrüche im ersten Quartal 2008.
- 2007: 2,4% weniger Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2007.
- 2007: 28 100 Schwangerschaftsabbrüche im dritten Quartal 2007.
2009-2Q: 5,3% weniger Schwangerschaftsabbrüche im zweiten Quartal 2009
Pressemitteilung Nr. 338 vom 10.09.2009 des Statistischen Bundesamtes
"WIESBADEN - Im zweiten Quartal 2009 wurden dem Statistischen Bundesamt (Destatis) rund 27 800 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland gemeldet und damit fast 1 600 Abbrüche weniger als im zweiten Quartal 2008 (- 5,3%).
Knapp drei Viertel (73%) der Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt, 15% zwischen 35 und 39 Jahren. Fast 8% der Frauen waren 40 Jahre und älter. Bei den unter 18-Jährigen (Anteil von knapp 5%) ging die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche um 12% (- 164) im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal zurück. 40% der Schwangeren aller Altersgruppen hatten vor dem Eingriff noch keine Lebendgeburt.
97% der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Medizinische und kriminologische Indikationen waren in rund 3% der Fälle die Begründung für den Abbruch. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (73%) wurden mit der Absaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt. Bei 14% der Schwangerschaftsabbrüche wurde das Mittel Mifegyne® verwendet.
Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant (97%), und zwar zu 79% in gynäkologischen Praxen und zu 18% ambulant im Krankenhaus. Rund 6% der Frauen ließen den Eingriff in einem Bundesland vornehmen, in dem sie nicht wohnten.
Um Aussagen über die längerfristige Entwicklung der Schwangerschaftsabbrüche zu treffen, sind die vorhandenen Jahresergebnisse besser geeignet, da man diese üblicherweise in Beziehung zur Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter und der Geborenen setzt.
2008-1Q
2,5% weniger Schwangerschaftsabbrüche im ersten Quartal 2008
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 213
vom 11. Juni 2008
"WIESBADEN - Im ersten Quartal 2008 wurden dem Statistischen Bundesamt
(Destatis) rund 30 600 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland gemeldet
und damit 2,5% (- 800) weniger als im ersten Quartal 2007.
Knapp drei Viertel (72%) der Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche
durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt, 15%
zwischen 35 und 39 Jahren. Fast 8% der Frauen waren 40 Jahre und älter.
Bei den unter 18-Jährigen (Anteil von knapp 5%) ging die Anzahl um
rund 14% (- 233) im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal zurück.
41% der betreffenden Schwangeren aller Altersgruppen hatten vor dem Eingriff
noch keine Lebendgeburt.
Fast 98% der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche
wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Medizinische und kriminologische
Indikationen waren in gut 2% der Fälle die Begründung für
den Abbruch. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (76%) wurden mit
der Absaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt. Bei 11% der Schwangerschaftsabbrüche
wurde das Mittel Mifegyne verwendet.
Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant
(97%), und zwar zu 78% in gynäkologischen Praxen und 19% ambulant
im Krankenhaus. 5% der Frauen ließen den Eingriff in einem Bundesland
vornehmen, in dem sie nicht wohnten.
2007:
2,4% weniger Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2007
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 093
vom 5. März 2008
"WIESBADEN - Im Jahr 2007 wurden dem Statistischen Bundesamt (Destatis)
rund 117 000 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland gemeldet und
damit 2,4% oder 2 800 weniger als 2006.
Knapp drei Viertel (72%) der Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche
durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt, 16%
zwischen 35 und 39 Jahren. Fast 8% der Frauen waren 40 Jahre und älter.
Die unter 18-Jährigen hatten einen Anteil von 5%. Ihre Anzahl ging
im Vergleich zum Jahr 2006 um 400 auf rund 6 200 zurück. 41% der Schwangeren
hatten vor dem Eingriff noch keine Lebendgeburt.
Über 97% der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche
wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Medizinische und kriminologische
Indikationen waren in weniger als 3% der Fälle die Begründung
für den Abbruch. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (76%) wurden
mit der Absaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt. Bei 10% der
Schwangerschaftsabbrüche wurde das Mittel Mifegyne® verwendet.
Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant
(98%), und zwar zu 79% in gynäkologischen Praxen und 19% ambulant
im Krankenhaus. 5% der Frauen ließen den Eingriff in einem Bundesland
vornehmen, in dem sie nicht wohnten.
Im vierten Quartal 2007 wurden rund 28 500 Schwangerschaftsabbrüche
gemeldet, das sind fast 2% mehr als im vierten Quartal 2006.
Ergebnisse nach Bundesländern sind im Internet
unter www.destatis.de, Pfad: Weitere Themen --> Gesundheit --> Schwangerschaftsabbrüche
abrufbar. Viele weitere gesundheitsbezogene Daten finden sich auch unter
der Adresse www.gbe-bund.de."
2007:
28 100 Schwangerschaftsabbrüche im dritten Quartal 2007
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 491
vom 5. Dezember 2007
"WIESBADEN - Im dritten Quartal 2007 wurden dem Statistischen Bundesamt
rund 28 100 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland gemeldet und damit
2,3% (? 700) weniger als im dritten Quartal 2006.
Knapp drei Viertel (72%) der Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche
durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt, 15%
zwischen 35 und 39 Jahren. 8% der Frauen waren 40 Jahre und älter.
Bei den unter 18-Jährigen (Anteil von gut 5%) ging die Anzahl um rund
10% (? 166) im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal zurück.
41% der Schwangeren hatten vor dem Eingriff noch keine Lebendgeburt.
Fast 98% der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche
wurden nach der Beratungsregelung vorgenommen. Medizinische und kriminologische
Indikationen waren in gut 2% der Fälle die Begründung für
den Abbruch. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (76%) wurden mit
der Absaugmethode (Vakuumaspiration) durchgeführt. Bei 10% der Schwangerschaftsabbrüche
wurde das Mittel Mifegyne® verwendet.
Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant
(97%), und zwar zu 78% in gynäkologischen Praxen und 19% ambulant
im Krankenhaus. 5% der Frauen ließen den Eingriff in einem Bundesland
vornehmen, in dem sie nicht wohnten."
Gleichberechtigung
2007:
Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen im Westen höher
als im Osten
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 427
vom 14. November 2008
"WIESBADEN - Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) lag der Abstand der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste
von Männern und Frauen im Jahr 2007 im früheren Bundesgebiet
mit 24% wesentlich höher als in den neuen Bundesländern mit 6%.
Die regionalen Differenzen lassen sich auf deutlich höhere Verdienste
der Männer in den alten Bundesländern im Vergleich zu den neuen
Ländern zurückführen. So lag der Bruttostundenverdienst
von Männern im früheren Bundesgebiet um 45% über dem der
Männer in den neuen Bundesländern. Bei den Frauen betrug dieser
Unterschied lediglich 17%.
Bundesweit wurde für das Jahr 2007 ein Verdienstunterschied
zwischen den Geschlechtern in Höhe von 23% ermittelt. In den Wirtschaftszweigen,
in denen viele Frauen tätig sind, fällt der geschlechterspezifische
Verdienstabstand überdurchschnittlich hoch aus. Dies gilt insbesondere
für die Wirtschaftszweige Unternehmensnahe Dienstleistungen (30%),
Verarbeitendes Gewerbe (29%), Handel (25%) sowie Gesundheits-, Veterinär-
und Sozialwesen (24%).
Insgesamt ergeben sich für 2007 im Vergleich
zum Vorjahr kaum Veränderungen der Verdienstunterschiede zwischen
Frauen und Männern.
Zur Ermittlung des geschlechterspezifischen Verdienstabstandes für
das Jahr 2007 wurden die Ergebnisse der Verdienststrukturerhebung 2006
mit Zahlen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung fortgeschätzt.
Dieses Vorgehen ist notwendig, da die Verdienststrukturerhebung nur alle
4 Jahre durchgeführt wird.
Mit dieser Pressemitteilung korrigiert Destatis
auch Angaben in der Pressemitteilung 310/08 vom 26.08.2008 zum Verdienstabstand
zwischen Frauen und Männern im Jahr 2006 für Deutschland insgesamt,
das frühere Bundesgebiet und den Wirtschaftszweig Gesundheits-, Veterinär-
und Sozialwesen um jeweils einen Prozentpunkt nach unten.
"
Männer
2007:
Wie leben Männer in Deutschland ?
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 409
vom 31. Oktober 2008
WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
zum Welttag des Mannes mitteilt, lebten 2007 bundesweit 40 Millionen Jungen
und Männer in Privathaushalten. Davon waren 11,0 Millionen ledige
Söhne, die im elterlichen Haushalt wohnten. Von den 29 Millionen Männern
waren knapp zwei Drittel (64%) Ehemänner, 26% Alleinstehende, 9% Partner
in einer Lebensgemeinschaft und knapp 1% alleinerziehende Väter. Das
zeigen die aktuellen Ergebnisse des Mikrozensus, der größten
jährlichen Haushaltsbefragung in Europa.
Ehemänner waren 2007 im Durchschnitt 54,9 Jahre
alt und somit rund zwei Jahre älter als alleinerziehende Väter
mit einem durchschnittlichen Alter von 52,6 Jahren. Alleinstehende Männer
hatten ein Durchschnittsalter von 45,8 Jahren. Mit 40,4 Jahren gut fünf
Jahre jünger waren Lebenspartner.
Sechs von zehn Männern (60%) gaben an, ihren
Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbs- oder Berufstätigkeit
zu finanzieren. Rund drei von zehn Männern (29%) bestritten ihren
überwiegenden Lebensunterhalt durch Rente oder Pension. Etwa jeder
zehnte Mann (11%) hatte andere Quellen des überwiegenden Lebensunterhalts,
zum Beispiel Arbeitslosengeld, Leistungen durch Hartz IV, Unterhalt durch
Angehörige oder das eigene Vermögen.
Zwei Drittel (66%) der Männer betreuten keine
Kinder im Haushalt. Hierzu zählen auch Männer, deren Kinder bereits
aus dem Haushalt ausgezogen sind. 25% der Männer zogen in einer Ehe,
einer Lebensgemeinschaft oder als allein erziehender Vater mindestens ein
Kind unter 18 Jahren groß. Bei 8% der Männer waren alle im Haushalt
lebenden Kinder bereits volljährig.
Detaillierte Ergebnisse des Mikrozensus 2007 zu
Männern und Frauen, Haushalten, Familien und Lebensformen der Bevölkerung
enthält die Fachserie 1, Reihe 3, die im Publikationsservice unter
www.destatis.de/shop zum kostenlosen Download bereit steht.
Homosexuelle Eltern (Frauen, Männer).
Bamberger Studie. [bmj 23.7.9]
"Familie ist dort, wo Kinder sind - Zypries stellt Forschungsprojekt
vor.
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hat heute gemeinsam mit der
stellvertretenden Leiterin des Instituts für Familienforschung an
der Universität Bamberg, Dr. Marina Rupp, eine Studie zur Situation
von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften vorgestellt.
Gegenstand der Untersuchung war die Frage, wie Kinder in so genannten Regenbogenfamilien
aufwachsen und ob das Kindeswohl in diesen Lebensgemeinschaften gleichermaßen
gewahrt ist wie bei heterosexuellen Eltern.
"Heute ist ein guter Tag für alle, die auf
Fakten statt auf Vorurteile setzen - gerade bei weltanschaulich besetzten
Themen. Die Untersuchung hat bestätigt: Dort, wo Kinder geliebt werden,
wachsen sie auch gut auf. Entscheidend ist eine gute Beziehung zwischen
Kind und Eltern und nicht deren sexuelle Orientierung. Nach den Ergebnissen
der Studie ist das Kindeswohl in Regenbogenfamilien genauso gewahrt wie
in anderen Lebensgemeinschaften. Homosexuelle Paare sind keine schlechteren
Eltern, Kinder entwickeln sich bei zwei Müttern oder zwei Vätern
genauso gut wie in anderen Familienformen. Die Studie ist außerordentlich
belastbar und repräsentativ. Sie belegt auf wissenschaftlich fundierter
Grundlage, dass Familie dort ist, wo Kinder sind. Die Ergebnisse der Untersuchung
sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur vollen gesellschaftlichen und
rechtlichen Anerkennung homosexueller Paare. Lebenspartner sind danach
unter den gleichen Voraussetzungen wie alle anderen als Adoptiveltern geeignet.
Wir sollten daher nicht auf halbem Wege stehen bleiben und jetzt die gesetzlichen
Voraussetzungen für eine gemeinsame Adoption durch Lebenspartner schaffen",
forderte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.
Das vom Bundesministerium der Justiz beauftragte
Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg
hat in Kooperation mit dem Staatsinstitut für Frühpädagogik
in München die erste aussagekräftige Forschung über Kinder
in Regenbogenfamilien in Deutschland vorgelegt. Der plural zusammengesetzte,
begleitende Forschungsbeirat bezeichnet die Ergebnisse als international
einzigartig.
Die Studie mit dem Schwerpunkt auf Kindern in Lebenspartnerschaften
ist überdurchschnittlich repräsentativ: In Deutschland wachsen
rund 2.200 Kinder in einer Lebenspartnerschaft auf. Die Situation von 693
dieser Kinder (32 %) wurde durch Befragung der Eltern analysiert, und 95
Kinder (5 %) wurden zusätzlich persönlich befragt. Zum Vergleich:
Bereits eine Befragung von 1 % der Zielgruppe gilt gemeinhin als repräsentativ.
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:
- Das Kindeswohl ist in Regenbogenfamilien genauso gewahrt wie in anderen Familienformen. Nach den Ergebnissen der Untersuchung sind "Regenbogeneltern" gleichermaßen gute Eltern wie andere an ihren Kindern interessierte Eltern. Persönlichkeitsentwicklung, schulische und berufliche Entwicklung der betroffenen Kinder verlaufen positiv. Sie entwickeln sich genauso gut wie Kinder aus heterosexuellen Beziehungen. Auch finden sich keine Anhaltspunkte für eine erhöhte Neigung zu Depressionen. Aus der Studie folgt: Für das Kindeswohl ist es nicht erforderlich, dass die Erziehung nach dem klassischen Rollen-Modell von verschiedenen Geschlechtern gleichermaßen übernommen wird. Maßgeblicher Einflussfaktor ist vielmehr eine gute Eltern-Kind-Beziehung unabhängig vom Geschlecht der Eltern.
- Eine Mehrheit der Kinder verfügt über keine Diskriminierungserfahrungen wegen der sexuellen Orientierung im Elternhaus (63 % aus Sicht der Eltern, 53 % aus der Perspektive der Kinder). Soweit solche Erfahrungen vorliegen, handelt es sich überwiegend um Hänseleien und Beschimpfungen. Die Erlebnisse werden in der Regel von den Betroffenen gut verarbeitet, da sie vor allem durch die elterliche Zuwendung und Erziehung aufgefangen werden.
- Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das so genannte kleine Sorgerecht (Mitentscheidung des Lebenspartners in Angelegenheiten des täglichen Lebens) in der Praxis gut angenommen wird. 75 % der Partner(innen) engagieren sich in der Erziehung eines Kindes, das ihre Partnerin/ihr Partner aus einer früheren Ehe oder Partnerschaft hat. Bei Familien mit Kindern, die z.B. nach künstlicher Insemination in eine aktuelle Beziehung hineingeboren wurden, ist der Anteil noch höher. In diesen Fällen kommt der Stiefkindadoption große Bedeutung zu. Etwa die Hälfte dieser Kinder wurde bereits durch den jeweiligen Partner "stiefkindadoptiert". Die große Mehrheit der übrigen dieser Paare plant diesen Schritt.
Schlussfolgerungen für den Gesetzgeber
- Das Lebenspartnerschaftsgesetz und die Stiefkindadoption haben sich bewährt. Das Angebot für diejenigen, die als gleichgeschlechtliches Paar füreinander und für ihre Kinder Verantwortung übernehmen, wird wahrgenommen.
- Die Studie hat bestätigt, dass in allen Familienformen die Beziehungsqualität in der Familie der bedeutsame Einflussfaktor für die kindliche Entwicklung ist. Dies gilt auch für Kinder in Lebenspartnerschaften. Sie wachsen dort genauso gut auf wie bei heterosexuellen Eltern. Lebenspartner sind deshalb unter den gleichen Voraussetzungen wie Ehepaare als Adoptiveltern geeignet.
- Beispiel: Die Lebenspartnerinnen
Sabine und Karla ziehen seit 5 Jahren als Pflegeeltern gemeinsam Sebastian
groß. Er besucht die 8. Klasse eines Gymnasiums und ist gut in die
Pflegefamilie integriert. Da seine drogenkranke Mutter gestorben und sein
Vater unbekannt ist, wollen Sabine und Karla ihn adoptieren. Eine gemeinsame
Adoption ist nach deutschem Recht derzeit nicht möglich. Man muss
sich behelfen: Nur ein Pflegeelternteil adoptiert; der andere Elternteil
hat lediglich ein "kleines Sorgerecht". Diese Lösung dient nicht dem
Kindeswohl.
Nach den Ergebnissen der Untersuchung besteht für den Gesetzgeber kein Grund, die gemeinsame Adoption für Lebenspartner nicht zuzulassen und damit Lebenspartner und heterosexuelle Beziehungen unterschiedlich zu behandeln. Voraussetzung für eine gemeinsame Adoption ist, dass Deutschland das geänderte Europäische Adoptionsübereinkommen zeichnet und in Kraft setzt. Es lässt im Unterschied zur Fassung von 1967 die gemeinsame Adoption auch durch Lebenspartner zu.
- Partner in Regenbogenfamilien übernehmen in aller Regel Verantwortung füreinander und gemeinsam für die Kinder, die bei ihnen leben. Lebenspartner haben nach geltendem Recht die gleichen Pflichten, aber nicht die gleichen Rechte. Zur vollständigen Gleichstellung müssen Ungleichbehandlungen von Lebenspartner und Eheleuten vor allem im Steuer- und Beamtenrecht abgeschafft werden."
Familienrecht: Sorge, Umgang, Pflege, Heime ...
- 2013 Jugendämter führten rund 116 000 Gefährdungseinschätzungen für Kinder durch.
- 2011: Zahl der Ehescheidungen im Jahr 2011 geringfügig angestiegen.
- Scheidungsstatistik 1985-2011.
- 2008: Adoptionen.
- 2008: 12250 Sorgerechtsentzüge.
- 2008: Zahl der Ehescheidungen stieg 2008 wieder an.
- Ehescheidungen und Anzahl betroffener Kinder 1985-2006.
- 2007: Zahl der Sorgerechtsentzüge 2007 um 13% gestiegen.
- 2006 Zahl der Sorgerechtsentzüge steigt um 10%.
2013 Jugendämter führten rund 116 000 Gefährdungseinschätzungen für Kinder durch.
Pressemitteilung Nr. 288 vom 14.08.2014
"WIESBADEN – Die Jugendämter in Deutschland führten im Jahr 2013 knapp 116 000 Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls durch. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 8,5 % mehr als bei der im Jahr 2012 erstmals durchgeführten Erhebung über Verfahren gemäß Paragraf 8a Absatz 1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung).
Eine Gefährdungseinschätzung wird vorgenommen, wenn dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines/einer Minderjährigen bekannt werden und es sich daraufhin zur Bewertung der Gefährdungslage einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind beziehungsweise Jugendlichen sowie seiner Lebenssituation macht.
Von allen Verfahren bewerteten die Jugendämter 17 000 eindeutig als Kindeswohlgefährdungen („akute Kindeswohlgefährdung“). Bei 21 000 Verfahren konnte eine Gefährdung des Kindes nicht ausgeschlossen werden („latente Kindeswohlgefährdung“). Beide Werte sind beinahe unverändert gegenüber dem Vorjahr. In 77 000 Fällen kamen die Fachkräfte zu dem Ergebnis, dass keine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Dabei wurde jedoch in nahezu jedem zweiten Verfahren ein Hilfe- oder Unterstützungsbedarf durch das Jugendamt festgestellt. Der Anstieg bei den Gefährdungseinschätzungen geht auf diese Fälle zurück, die von 68 000 im Jahr 2012 auf 77 000 im Jahr 2013 zugenommen haben.
Knapp zwei von drei Kindern (65 %), bei denen eine akute oder latente Kindeswohlgefährdung vorlag, wiesen Anzeichen von Vernachlässigung auf. In 26 % der Fälle wurden Anzeichen für psychische Misshandlung festgestellt. Ähnlich häufig, nämlich mit einem Anteil von 23 %, wiesen die Kinder Anzeichen für körperliche Misshandlung auf. Anzeichen für sexuelle Gewalt wurden in 5 % der Verfahren festgestellt. Mehrfachnennungen waren möglich.
Verfahren zur Bestimmung von Gefährdungslagen wurden in etwa gleich häufig für Jungen (51 %) und Mädchen (49 %) durchgeführt. Dies gilt auch für Verfahren mit dem Ergebnis einer akuten oder latenten Kindeswohlgefährdung.
Jedes vierte Kind (25 %), für das ein Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls durchgeführt wurde, hatte das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet. Drei- bis fünfjährige Kinder waren von 20 % der Verfahren betroffen. Mit 22 % waren Kinder im Grundschulalter (6 bis 9 Jahre) beteiligt und mit 18 % Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren. Für Jugendliche (14 bis 17 Jahre) betrug der Anteil an allen Verfahren 15 %.
Am häufigsten, nämlich bei 22 500 Verfahren (19 %), machten Polizei, Gericht oder Staatsanwaltschaft das Jugendamt auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung aufmerksam. Bei gut 16 000 Verfahren (14 %) gingen Jugendämter Hinweisen durch Bekannte oder Nachbarn nach, in 14 000 Fällen (12 %) denen von Schulen oder Kindertageseinrichtungen. Gut jeden zehnten Hinweis (11 %) erhielten die Jugendämter anonym.
Hinweise
Die Abschätzung des Gefährdungsrisikos erfolgt bei Jugendämtern in Zusammenwirkung mehrerer Fachkräfte. Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes/Jugendlichen bereits eingetreten ist oder mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist und diese Situation von den Sorgeberechtigten nicht abgewendet wird oder werden kann. Das Jugendamt hat den Personensorgeberechtigten zur Abwendung der Gefährdung geeignete und notwendige Hilfen anzubieten.
Aus Hamburg wurde für 2013 nur ein Teil der durchgeführten Gefährdungseinschätzungen gemeldet. Für das Jahr 2012 hatte Hamburg keine Daten zur Statistik gemeldet."
2011: Zahl der Ehescheidungen im Jahr 2011 geringfügig angestiegen
Pressemitteilung Nr. 241 vom 11.07.2012
"WIESBADEN – Im Jahr 2011 wurden in Deutschland rund 187 600 Ehen geschieden, das waren 0,3 % mehr als im Jahr 2010. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden damit elf von 1 000 bestehenden Ehen geschieden. Zum Vergleich: Im Jahr 1992 endeten von 1 000 bestehenden Ehen sieben Ehen vor dem Scheidungsrichter.
Bei den im Jahr 2011 geschiedenen Ehen wurde der Scheidungsantrag meist von der Frau gestellt, und zwar in 52,8 % der Fälle. 39,4 % der Anträge reichte der Mann ein. In den übrigen Fällen beantragten beide Ehegatten die Scheidung gemeinsam.
Bei der Mehrzahl aller Scheidungen waren die Ehepartner bereits seit einem Jahr getrennt: 153 700 Ehen wurden 2011 nach einjähriger Trennung geschieden. Bei 2 600 Scheidungen waren die Partner noch kein Jahr getrennt. Die Zahl der Scheidungen nach dreijähriger Trennung lag bei 29 900. In den verbleibenden 1 400 Fällen erfolgte die Scheidung aufgrund anderer Regelungen, wie beispielsweise nach ausländischem Recht.
Die durchschnittliche Dauer der im Jahr 2011 geschiedenen Ehen betrug 14 Jahre und 6 Monate. Damit setzte sich 2011 der Trend der vergangenen Jahre fort, dass sich Paare erst nach einer längeren Ehedauer scheiden lassen. Im Jahr 1992 waren es noch 11 Jahre und 6 Monate gewesen.
Fast die Hälfte der Ehepaare, die sich 2011 scheiden ließen, hatte Kinder unter 18 Jahren. Insgesamt waren 2011 rund 148 200 minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen, 2,1 % mehr als im Vorjahr."
Scheidungsstatistik 1985-2011

2008: Adoptionen:
4 201 Adoptionen 2008
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 274
vom 22. Juli 2009
"WIESBADEN - 2008 wurden in Deutschland 4 201 Kinder und Jugendliche
adoptiert. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Die Zahl
der Adoptionen lag damit um 7% niedriger als im Vorjahr; 2007 waren von
den Adoptionsvermittlungsstellen 4 509 Adoptionen gemeldet worden.
Beinahe die Hälfte der Adoptionen (2 056; 49%)
waren Stiefelternadoptionen. Bei einer Stiefelternadoption wird der oder
die Minderjährige durch einen neuen Partner des leiblichen Elternteils
adoptiert.
30% der adoptierten Kinder waren unter 3 Jahre alt,
bei den Altersgruppen 3 bis 5 Jahre, 6 bis 8 Jahre und 9 bis 11 Jahre lag
der Anteil bei jeweils 15% und bei den 12- bis 17-Jährigen bei 25%.
Für eine Adoption vorgemerkt waren 2008 insgesamt
774 Kinder und Jugendliche und damit knapp 13% weniger als ein Jahr zuvor.
Die Zahl der Adoptionsbewerbungen hat sich gegenüber 2007 um 12% vermindert;
in den Adoptionsvermittlungsstellen lagen 7 841 Adoptionsbewerbungen vor.
Damit belief sich das Verhältnis von Adoptionsbewerbungen zur Zahl
der zur Adoption vorgemerkten Minderjährigen rein rechnerisch auf
10 zu 1.
Weitere kostenlose Informationen gibt es im Publikationsservice
des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/publikationen unter
dem Suchwort "Adoptionen".
2008: 12250 Sorgerechtsentzüge
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 269
vom 17. Juli 2009
"WIESBADEN - Weil eine Gefährdung des Kindeswohls anders nicht
abzuwenden war, haben die Gerichte in Deutschland im Jahr 2008 in 12 250
Fällen den vollständigen oder teilweisen Entzug der elterlichen
Sorge angeordnet. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit.
Rechtsgrundlage für diese Maßnahme ist § 1666 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB). In 9 100 Fällen übertrugen die Gerichte das
Sorgerecht ganz oder teilweise auf die Jugendämter, in den übrigen
Fällen einer Einzelperson oder einem Verein.
Bei einem teilweisen Entzug der elterlichen Sorge
wird zum Beispiel das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder die Vermögenssorge
entzogen. Bei der Übertragung des teilweisen Sorgerechts an ein Jugendamt
wurde in 2 350 Fällen (26%) nur das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen.
Mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht ist die Befugnis verbunden, Entscheidungen
des alltäglichen Lebens zu treffen.
Die Zahl der gerichtlichen Maßnahmen zum Sorgerechtsentzug
hat sich deutschlandweit (ohne Berlin, wo für 2007 eine deutliche
Untererfassung festgestellt wurde) gegenüber 2007 um circa 8% erhöht.
Weitere Informationen werden voraussichtlich ab
Montag, den 20. Juli 2009 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes
unter www.destatis.de/publikationen unter dem Suchwort "Sorgerecht" kostenlos
zur Verfügung stehen.
"
2008:
Zahl der Ehescheidungen stieg 2008 wieder an
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 251
vom 08.07.2009
"Wiesbaden - Im Jahr 2008 ist die Zahl der Ehescheidungen um 3% gegenüber
dem Vorjahr angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
wurden 2008 in Deutschland etwa 191 900 Ehen geschieden; 2007 waren rund
187 100 Ehescheidungen registriert worden. Damit wurden 2008 von 1 000
bestehenden Ehen 11 geschieden, im Jahr 1993 waren es dagegen nur 8 von
1 000 Ehen gewesen.
Von 1992 bis 2003 war die Zahl der Ehescheidungen
mit Ausnahme des Jahres 1999 beständig von 135 000 auf 214 000 angestiegen,
wobei in den neuen Ländern in den Jahren 1992 bis 1996 vorübergehend
sehr wenige Ehen geschieden wurden. Nachdem die Ehescheidungen in Deutschland
von 2004 bis 2007 abgenommen hatten, ist für das Jahr 2008 wieder
ein Anstieg zu verzeichnen.
Bei den im Jahr 2008 geschiedenen Ehen wurde der
Scheidungsantrag in 104 000 Fällen von der Frau (54,2%) und in 71
500 Fällen (37,2%) vom Mann gestellt. In den übrigen Fällen
beantragten beide Ehegatten die Scheidung. Gegenüber 2007 ist die
Zahl der nur vom Mann beantragten Ehescheidungen um 5,1% angestiegen, nur
von der Frau gestellte Scheidungsanträge stiegen leicht um 0,8% an.
Bei der Mehrzahl aller Ehescheidungen sind die Ehepartner
zumindest ein Jahr getrennt. 162 500 Ehen (84,6%) wurden im Jahr 2008 nach
einjähriger Trennung geschieden, dies waren 4 900 Ehen oder 3,1% mehr
als 2007. Bei 3 100 Scheidungen waren die Partner noch kein Jahr getrennt
gewesen (+ 2,8% gegenüber dem Vorjahr). Die Zahl der Scheidungen nach
dreijähriger Trennung ist mit 25 200 leicht zurückgegangen (-
1,5%).
2008 betrug die durchschnittliche Ehedauer bei der
Scheidung 14,1 Jahre. 2007 waren die Partner in Durchschnitt 13,9 Jahre
verheiratet gewesen und 1990 11,5 Jahre. Somit setzt sich die Tendenz
der vergangenen Jahre zu einer längeren Ehedauer bis zur Scheidung
fort.
Von den im Jahr 2008 geschiedenen Ehepaaren hatten
knapp die Hälfte Kinder unter 18 Jahren. Gegenüber 2007 hat die
Zahl der von der Scheidung ihrer Eltern betroffenen minderjährigen
Kinder von 145 000 auf 150 200 und damit um 3,6% zugenommen.
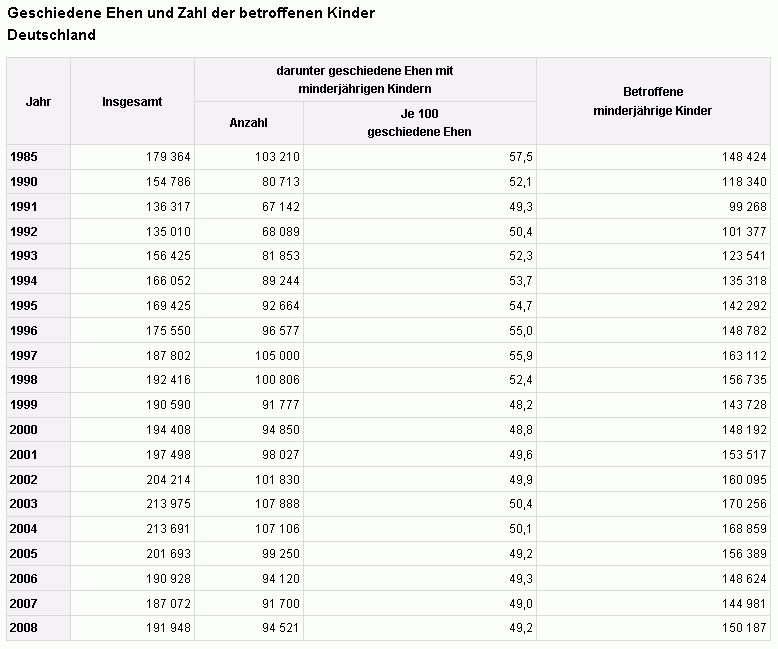
"
Ehescheidungen
und Anzahl betroffener Kinder 1985-2006
Gut 5% weniger Ehescheidungen im Jahr 2006
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 442
vom 7. November 2007
"WIESBADEN - Die Zahl der Ehescheidungen ist im Jahr 2006 um 5,3% gegenüber
dem Vorjahr gesunken. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, wurden
2006 gut 190 900 Ehen geschieden; 2005 waren 201 700 Ehescheidungen registriert
worden. Damit wurden 2006 von 1 000 bestehenden Ehen zehn geschieden, 1992
waren es sieben und in den Jahren 2002 bis 2005 elf Ehen gewesen.
Von 1992 bis 2003 war die Zahl der Ehescheidungen mit Ausnahme des
Jahres 1999 beständig von 135 000 - damals wurden in den neuen Ländern
vorübergehend sehr wenige Ehen geschieden - auf 214 000 angestiegen,
seit 2004 ist eine Abnahme zu verzeichnen.
Bei den im Jahr 2006 geschiedenen Ehen wurde
der Scheidungsantrag in 106 600 Fällen von der Frau (55,8%) und in
69 200 Fällen (36,2%) vom Mann gestellt. In den übrigen Fällen
beantragten beide Ehegatten die Scheidung. Gegenüber 2005 ist die
Zahl der nur vom Mann beantragten Ehescheidungen um 6,1% gesunken; nur
von der Frau gestellte Scheidungsanträge gingen um 5,1% zurück.
Bei der Mehrzahl aller Ehescheidungen sind die Parteien
zumindest ein Jahr getrennt. 161 500 Ehen (84,6%) wurden im Jahr 2006 nach
einjähriger Trennung geschieden, dies waren 10 800 Ehen oder 6,2%
weniger als 2005. Auch wurden mit 3 300 Scheidungen 17,5% weniger Ehen
gelöst, bei denen die Partner noch kein Jahr getrennt gewesen waren.
Die Zahl der Scheidungen nach dreijähriger Trennung hat mit 25 100
leicht zugenommen (+ 3% gegenüber 2005).
Von den im Jahr 2006 geschiedenen Ehepaaren hatte
knapp die Hälfte Kinder unter 18 Jahren. Gegenüber 2005 hat die
Zahl der von der Scheidung ihrer Eltern betroffenen minderjährigen
Kinder von 156 400 auf 148 600 und damit um 5% abgenommen.

"
2007:
Zahl der Sorgerechtsentzüge 2007 um 13% gestiegen
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 261
vom 18. Juli 2008
"WIESBADEN - Im Jahr 2007 haben die Gerichte in Deutschland in rund
10 800 Fällen den vollständigen oder teilweisen Entzug der elterlichen
Sorge angeordnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, bedeutet
dies gegenüber 2006 eine Steigerung um 12,5% oder 1 200 Fälle.
Gegenüber 2005 betrug der Anstieg der Sorgerechtsentzüge sogar
knapp 23%.
Mehr als verdoppelt hat sich die Zahl der Sorgerechtsentzüge
in Bremen, von 56 Fällen im Jahr 2006 auf 126 Fälle im Jahr 2007.
Es folgen Niedersachsen mit + 31% und Thüringen mit + 30%. Dagegen
sank die Zahl der Sorgerechtsentzüge in Schleswig-Holstein um 18%,
in Berlin um 15% und in Sachsen-Anhalt um 14%.
Die Jugendämter haben im Jahr 2007 knapp 12
800 Anzeigen zum vollständigen oder teilweisen Entzug der elterlichen
Sorge an die Gerichte gestellt. Dies bedeutet eine Steigerung um 18,5%
oder 2 000 Fälle gegenüber 2006 und um 30% gegenüber 2005.
Weitere kostenlose Informationen gibt es im Publikationsservice
des Statistischen Bundesamtes unter dem Suchwort "Sorgerecht".
2006
Zahl der Sorgerechtsentzüge steigt um 10%
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 27.
Mai 2008
"WIESBADEN - Im Jahr 2006 haben die Gerichte in Deutschland in rund
9 600 Fällen den vollständigen oder teilweisen Entzug der elterlichen
Sorge angeordnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, bedeutet
dies gegenüber 2005 eine Steigerung um 10,2% oder 900 Fälle.
Gegenüber 2004 betrug der Anstieg der Sorgerechtsentzüge sogar
knapp 19%.
Die Jugendämter haben im Jahr 2006 knapp 10
800 Anzeigen zum vollständigen oder teilweisen Entzug der elterlichen
Sorge an die Gerichte gestellt. Dies bedeutet eine Steigerung um 10,7%
oder 1 000 Fälle gegenüber 2005 und um 22% gegenüber 2004.
Zwischen 2001 und 2004 waren die Zahlen der Sorgerechtsentzüge
demgegenüber nahezu unverändert geblieben."
Familienhilfe und Unterstützung (> Sozialhilfe)
- 2010 Öffentliche Hand gab 2010 rund 28,9 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhilfe aus.
- 2010: Betreuungsquote bei einjährigen Kindern in vielen ostdeutschen Kreisen über 50%.
- 2008: Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe weiter stark gefragt.
- 2008-03 Kreise in Sachsen-Anhalt sind Spitzenreiter bei Betreuung unter Dreijähriger.
- 2007 Inobhutnahmen: Tag für Tag nehmen Jugendämter 77 Kinder in Obhut.
- Elterngeld für 2007 geborene Kinder.
- 2007 Große regionale Unterschiede bei Ganztagsbetreuung von Kindern 2007.
- 2007: Elterngeld für Väter in bayerischen Kreisen besonders attraktiv.
- 2007: Elterngeld bei Vätern weiter hoch im Kurs.
- 2007: 16% aller Kinder unter 6 Jahren werden ganztags betreut.
- 1991-2006: 79% mehr erzieherische Hilfen von 1991 bis 2006.
- 2006: Zahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe steigt.
- 2007: Mehr Kinder unter 3 Jahren in Tagesbetreuung.
- 2006: Ausgaben für Tagesbetreuung von Kindern.
- Elterngeld 01-09.2007.
- 2006: Ausgaben für Jugendhilfe.
- Große regionale Unterschiede bei der Kindertagesbetreuung 2006.
- Erziehungsberatung half 178 000 Schulkindern 2006. [> 2001]
2010 Öffentliche Hand gab 2010 rund 28,9 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhilfe aus
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 22 vom 18. Januar 2012
"WIESBADEN -Bund, Länder und Gemeinden haben im Jahr 2010 insgesamt rund 28,9 Milliarden Euro für Leistungen und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sind die Ausgaben damit gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % gestiegen. Nach Abzug der Einnahmen in Höhe von etwa 2,6 Milliarden Euro - unter anderem aus Gebühren und Teilnahmebeiträgen - wendete die öffentliche Hand netto rund 26,3 Milliarden Euro auf. Gegenüber 2009 entspricht das einer Steigerung um 8,2 %.
Der größte Teil der Bruttoausgaben (62 %) entfiel mit rund 17,8 Milliarden Euro auf die Kindertagesbetreuung, 9,9 % mehr als 2009. Nach Abzug der Einnahmen in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro wurden netto 16,2 Milliarden Euro für Kindertagesbetreuung ausgegeben. Das waren 11,0 % mehr als im Vorjahr.
Gut ein Viertel der Bruttoausgaben (26 %) - insgesamt mehr als 7,5 Milliarden Euro - wendeten die öffentlichen Träger für Hilfen zur Erziehung auf. Davon entfielen etwa 4,1 Milliarden Euro auf die Unterbringung junger Menschen außerhalb des Elternhauses in Vollzeitpflege, Heimerziehung oder in anderer betreuter Wohnform. Die Ausgaben für sozialpädagogische Familienhilfe lagen bei 729 Millionen Euro und damit um 7,3 % höher als im Vorjahr.
Weitere gut 5 % der Gesamtausgaben wurden in Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendarbeit investiert, zum Beispiel in außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung oder in Jugendzentren. Bund, Länder und Gemeinden wendeten dafür rund 1,6 Milliarden Euro auf. Die Ausgaben für vorläufige Schutzmaßnahmen, zu denen insbesondere die Inobhutnahme bei Gefährdung des Kindeswohls gehört, stiegen von rund 145 Millionen Euro im Jahr 2009 auf rund 165 Millionen Euro 2010 (+ 13,5 %).
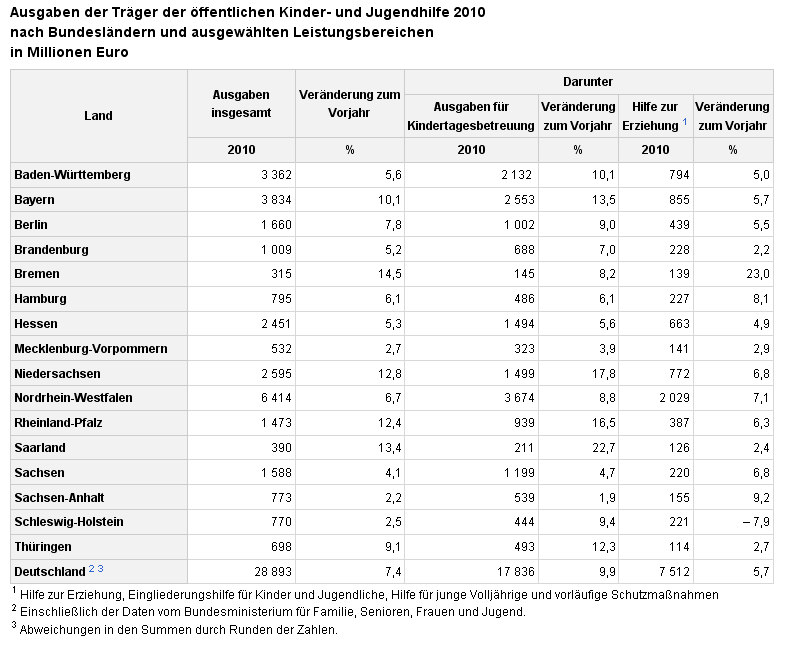
"
2010:
Betreuungsquote bei einjährigen Kindern in vielen ostdeutschen Kreisen
über 50%.
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 018
vom 17. Januar 2011
"WIESBADEN - In den ostdeutschen Landkreisen und kreisfreien Städten
nehmen Eltern deutlich früher ein Angebot zur Kindertagesbetreuung
in Anspruch als in Westdeutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, lag die Betreuungsquote - das heißt der Anteil der Kinder
in Kindertagesbetreuung an allen Kindern in diesem Alter - im März
2010 bei den einjährigen Kindern in 64 der insgesamt 86 ostdeutschen
Kreise bei mindestens 50%. In Westdeutschland dagegen lag die Betreuungsquote
bei den Einjährigen in 212 der 325 Kreise unter 15%. In Berlin betrug
die Quote 46,8%.
Die höchsten Betreuungsquoten gab es am 1.
März 2010 in drei Landkreisen in Sachsen-Anhalt: Der Kreis Jerichower-Land
hatte die bundesweit höchste Betreuungsquote (80,6%), gefolgt vom
Landkreis Wittenberg (78,8%) und dem Salzlandkreis (78,4%). In Sachsen-Anhalt
besteht bereits ab Geburt ein Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung.
Bundesweit besteht dieser Rechtsanspruch ab Vollendung des dritten Lebensjahres.
Mit Beginn des Kindergartenjahrs 2013/2014 wird dieser Rechtsanspruch ab
Vollendung des ersten Lebensjahres gelten. In den westdeutschen Bundesländern
gab es die höchsten Betreuungsquoten bei den einjährigen Kindern
in den Städten Heidelberg (40,6%) und Hamburg (32,6%).
Bei Kindern im Alter von zwei Jahren lag die Betreuungsquote
in allen ostdeutschen Landkreisen und kreisfreien Städten über
50%. In Westdeutschland war dies in 32 der insgesamt 325 Kreise der Fall.
Die höchste Betreuungsquote in einem ostdeutschen Kreis wies im März
2010 die Stadt Brandenburg an der Havel mit 96,9% auf, in Westdeutschland
war dies der Landkreis Südwestpfalz (Rheinland-Pfalz) mit 75,9%.
Diese und weitere Informationen zur Kindertagesbetreuung
gehen aus der gemeinsamen Veröffentlichung der Statistischen Ämter
des Bundes und der Länder "Kindertagesbetreuung regional 2010" hervor,
die Daten zur Situation der Kindertagesbetreuung in allen 412 Stadt- und
Landkreisen in Deutschland enthält. Sie stellt neben den Betreuungsquoten
der Kinder unter drei Jahren auch Ergebnisse zur Kindertagesbetreuung der
Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren zur Verfügung. Weiter
werden Daten zu Kindern bis fünf Jahre in Ganztagsbetreuung, das sind
Kinder mit Betreuungszeiten von mehr als sieben Stunden pro Tag, dargestellt.
Darüber hinaus enthält die Veröffentlichung Angaben zu Kindern
in Kindertagesbetreuung, die einen Migrationshintergrund haben, bei denen
also mindestens ein Elternteil aus dem Ausland stammt. Die Publikation
ist kostenlos im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes unter
www.destatis.de/publikationen (Suchbegriff: Kindertagesbetreuung regional)
erhältlich."
_
2008:
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe weiter stark gefragt
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 401
vom 22. Oktober 2009
"WIESBADEN - Im Jahr 2008 hat für mehr als eine halbe Million
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland eine erzieherische
Hilfe begonnen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben
damit rund 3% der jungen Menschen unter 21 Jahren eine erzieherische Hilfe
durch das Jugendamt oder in einer Erziehungsberatungsstelle neu in Anspruch
genommen. Eine Eingliederungshilfe bei (drohender) seelischer Behinderung
haben 16 000 junge Menschen begonnen.
Unter den erzieherischen Hilfen wurde im Jahr 2008
am häufigsten Erziehungsberatung mit 307 000 begonnenen Hilfen in
Anspruch genommen. Dies entspricht gut zwei Dritteln aller begonnenen erzieherischen
Hilfen. Familienorientierte Hilfen, darunter die Sozialpädagogische
Familienhilfe, haben in 51 000 Familien begonnen. Mit diesen Hilfen wurden
99 000 Kinder und Jugendliche und damit durchschnittlich zwei Kinder pro
Familie erreicht.
An dritter Stelle folgen die stationären Hilfen
mit 47 000 im Jahr 2008 begonnenen Hilfen. Somit war für etwa jeden
zehnten jungen Menschen die erzieherische Hilfe mit einer Unterbringung
außerhalb des Elternhauses verbunden. Zu den stationären Hilfen
zählen Vollzeitpflege in einer anderen Familie, Heimerziehung und
sonstige betreute Wohnformen.
Bei nahezu einem Viertel aller neu gewährten
Hilfen zur Erziehung und damit als häufigster Hauptgrund für
die Hilfegewährung wurde die Belastung des jungen Menschen durch familiäre
Konflikte genannt. Bei 15% der begonnenen Hilfen wurde als Hauptgrund die
eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern beziehungsweise der
Personensorgeberechtigten angegeben.
Weitere kostenlose Ergebnisse gibt es im Publikationsservice
des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/publikationen, Suchbegriff:
"Erzieherische Hilfe".
2008-03
Kreise in Sachsen-Anhalt sind Spitzenreiter bei Betreuung unter Dreijähriger
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 164
vom 29. April 2009
WIESBADEN - Die Landkreise und kreisfreien Städte
in Sachsen-Anhalt liegen bei der Tagesbetreuung von Kindern unter drei
Jahren bundesweit vorn. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
werden dort landesweit mehr als die Hälfte der Kinder unter drei Jahren
(53%) als Ergänzung zur Erziehung und Betreuung durch ihre Eltern
in Kindertageseinrichtungen oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege
betreut. Bundesweit liegt die Betreuungsquote bei 18%.
Die höchste Betreuungsquote weist zum Stichtag
15. März 2008 der Kreis Jerichower-Land (59%) auf, gefolgt vom Landkreis
Wittenberg (58%) und dem Salzlandkreis (57%; alle Sachsen-Anhalt). Die
niedrigsten Betreuungsquoten finden sich im Kreis Olpe (Nordrhein-Westfalen)
mit 3% sowie in den Kreisen Cloppenburg und Leer (Niedersachsen) mit jeweils
4%.
Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2013
die Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren auf bundesweit 35%
zu erhöhen. In gut einem Fünftel aller Kreise in Deutschland
wurde diese Zielmarke bislang erreicht. Hierzu zählen Berlin (40%),
88 ostdeutsche Kreise sowie in Westdeutschland einzig die Stadt Heidelberg
mit 35%.
Diese und weitere Informationen zur Kindertagesbetreuung
gehen aus der gemeinsamen Veröffentlichung der Statistischen Ämter
des Bundes und der Länder "Kindertagesbetreuung regional 2008" hervor,
die Daten zur Situation der Kindertagesbetreuung in allen 429 Stadt- und
Landkreisen in Deutschland enthält. Sie stellt neben den Betreuungsquoten
der Kinder unter drei Jahren auch Daten zur Tagesbetreuung der Kinder im
Alter von drei bis fünf Jahre sowie zur Ganztagsbetreuung von Kindern
bis zu fünf Jahren zur Verfügung. Die Publikation ist kostenlos
im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/publikationen
(Suchbegriff: Kindertagesbetreuung regional) erhältlich. Dort finden
Sie auch entsprechende Kreiskarten zum kostenlosen Download.
2007
Inobhutnahmen: Tag für Tag nehmen Jugendämter 77 Kinder in Obhut
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 254
vom 15.07.2008
Wiesbaden - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden
im Jahr 2007 in Deutschland 28 200 Kinder und Jugendliche von Jugendämtern
in Obhut genommen. Dies waren rund 2 200 (+ 8,4%) mehr als 2006. Damit
leisteten die Jugendämter rein rechnerisch jeden Tag für 77 Kinder
und Jugendliche "erste Hilfe" in für sie gefährlichen Situationen;
im Vorjahr waren es pro Tag rechnerisch 71 Kinder und Jugendliche gewesen.
435 dieser Inobhutnahmen waren sogenannte Herausnahmen, das heißt,
die Kinder wurden gegen den erklärten Willen der Sorgeberechtigten
in Obhut genommen. Im Jahr 2006 hatte es 151 Herausnahmen gegeben.
Eine Inobhutnahme ist eine kurzfristige Maßnahme
der Jugendämter zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, wenn sie
sich in einer akuten, sie gefährdenden Situation befinden. Jugendämter
nehmen Minderjährige auf deren eigenen Wunsch oder auf Initiative
Anderer (etwa der Polizei oder Erzieher) in Obhut und bringen sie - meist
für Stunden oder einige Tage - in einer geeigneten Einrichtung unter,
etwa in einem Heim.
7 000 Kinder und Jugendliche (25%) wurden 2007 auf
eigenen Wunsch in Obhut genommen, bei den Übrigen veranlassten andere
Personen oder Stellen die Inobhutnahme.
16 500 (58%) der in Obhut genommenen Kinder und
Jugendlichen waren älter als 14 Jahre. Mit einem Anteil von 55% (15
400) aller in Obhut Genommenen waren Mädchen wie in den Vorjahren
in der Überzahl.
An einem jugendgefährdenden Ort, zum Beispiel
in Straßen mit Bordellbetrieb oder an Treffpunkten von Drogenhändlern,
wurden rund 11% (3 000) der in Obhut Genommenen aufgegriffen.
Der mit Abstand meistgenannte Anlass für die
Inobhutnahme war in 44% der Fälle die Überforderung der Eltern.
Bei 6 500 der Kinder und Jugendlichen (23%) waren Vernachlässigung
beziehungsweise Anzeichen für Misshandlung oder für sexuellen
Missbrauch festgestellt worden.
Elterngeld für
2007 geborene Kinder
Mehr als die Hälfte der Mütter mit Elterngeld war zuvor
erwerbstätig
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 214
vom 11. Juni 2008
"WIESBADEN - Mehr als die Hälfte der Mütter (52,5%), denen
für ihr 2007 geborenes Kind Elterngeld bewilligt wurde, war vor der
Geburt erwerbstätig; bei den Vätern waren es 77%. Dies geht aus
neuesten Ergebnissen der Elterngeldstatistik hervor, die das Statistische
Bundesamt (Destatis) heute veröffentlicht hat. Diese Ergebnisse enthalten
jetzt die im ersten Quartal 2008 bewilligten Anträge auf Elterngeld
für Eltern, deren Kind 2007 geboren wurde. Bei diesen Anträgen
handelt es sich um "Überhänge" aus dem Vorjahr und um Anträge
von Vätern und Müttern, die erst zu einem späteren Zeitpunkt
während der ersten 14 Lebensmonate ihres Kindes Elterngeld beantragt
haben.
Während von den vor der Geburt des Kindes erwerbstätigen
Müttern 85% für ein Jahr Elterngeld beziehen, bevorzugen von
den vor der Geburt des Kindes erwerbstätigen Vätern zwei Drittel
eine "Babyzeit" von zwei Monaten. Jeder zehnte erwerbstätige Vater
nimmt sich ein Jahr Zeit für seinen Nachwuchs. 89% der nicht erwerbstätigen
Mütter beziehen 12 Monate Elterngeld. Von den nicht erwerbstätigen
Vätern erhält jeder zweite für zwei Monate Elterngeld und
30% beziehen diese Leistung über zwölf Monate.
Insgesamt wurden von Januar 2007 bis März 2008
knapp 720 000 Anträge auf Elterngeld für 2007 geborene Kinder
bewilligt. Die Zahl der Väter, die für ihr 2007 geborenes Kind
Elterngeld bewilligt bekamen, hat sich inzwischen auf 87 400 erhöht.
Damit ist der Anteil der für Väter bewilligten Anträge auf
12,1% angestiegen. In Ostdeutschland übertrifft der Wert mit 12,6%
den in Westdeutschland (11,9%). Im ersten Quartal 2008 ist der Anteil der
bewilligten Anträge für Männer, die 2007 Vater geworden
sind, in einigen Ländern auf über 20% angestiegen. Dies hängt
zunächst mit der Zunahme der absoluten Zahl der Anträge von Vätern
zusammen. Weiter trägt aber dazu bei, dass die absolute Zahl der Anträge
von Müttern für 2007 geborene Kinder rückläufig ist,
da diese Mütter häufig bereits zu einem früheren Zeitpunkt
ihren Antrag auf Elterngeld gestellt haben.
Zwischen Januar und März 2008 haben rund 169
000 Eltern den Bezug von Elterngeld beendet. Dies betraf 144 000 Mütter
und 25 000 Väter. Dies sind die ersten Ergebnisse nach der Erweiterung
der Elterngeldstatistik um Angaben zu beendeten Leistungsbezügen ab
Januar 2008.
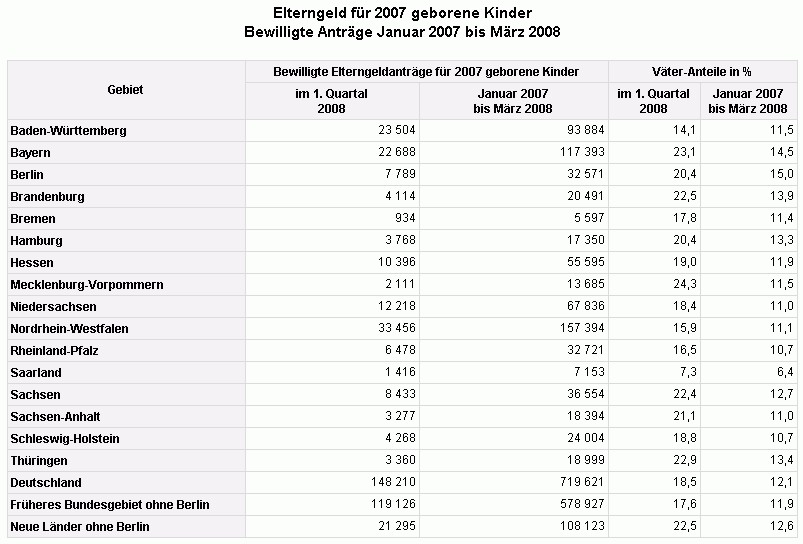
"
2007 Große
regionale Unterschiede bei Ganztagsbetreuung von Kindern 2007
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 175
vom 8.05.2008
"Wiesbaden - In den ostdeutschen Landkreisen und kreisfreien Städten
haben die Eltern von Kindern bis fünf Jahren im Jahr 2007 Angebote
der Ganztagsbetreuung verhältnismäßig stärker in Anspruch
genommen als in den westdeutschen Kreisen. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, findet sich der größte Anteil ganztägig
betreuter Kinder unter drei Jahren (an allen Kindern dieser Altersgruppen)
in der thüringischen Stadt Jena (46%) und im Kreis Weimarer Land (41%).
Im Vergleich dazu liegt in vielen westdeutschen Kreisen der Anteil der
ganztags betreuten Kinder (Ganztagsbetreuungsquote) unter einem Prozent.
Ein ähnliches Bild ergibt sich für die
Kinder in der Altersgruppe von drei bis fünf Jahren. Die zehn Kreise
mit der niedrigsten Inanspruchnahme von Ganztagsbetreuung sind in den süd-
und norddeutschen Bundesländern (Baden-Württemberg, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein) zu finden, während die zehn Kreise mit den
höchsten Quoten fast ausnahmslos in Thüringen liegen.
Als Ganztagsbetreuung wird gerechnet, wenn die Eltern
eine Betreuungszeit von mehr als sieben Stunden pro Tag in einer Tageseinrichtung
oder bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater vereinbart haben.
Diese und weitere Informationen zur Kindertagesbetreuung
in allen Stadt- und Landkreisen enthält die gemeinsame Veröffentlichung
der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder "Kindertagesbetreuung
regional 2007". Die Publikation ist kostenlos im Publikationsservice des
Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/publikationen (Suchbegriffe:
Kindertagesbetreuung regional) erhältlich. Dort erhalten Sie auch
kostenlos entsprechende Kreiskarten."
2007:
Elterngeld für Väter in bayerischen Kreisen besonders attraktiv
Pressemitteilung des Statistischen
Bundesamtes Nr. 107 vom 12. März 2008
"WIESBADEN - Nach Mitteilung des Statistischen
Bundesamtes (Destatis) nehmen Väter in bayerischen Kreisen besonders
oft Elterngeld in Anspruch: In den Monaten Januar bis Dezember 2007 lag
der Anteil der Männer in 83 von 96 bayerischen Kreisen über dem
bundesweiten Durchschnitt von 10,5%.
Die höchsten Männeranteile
an den bewilligten Elterngeldanträgen gab es jedoch in den baden-württembergischen
Universitätsstädten Freiburg im Breisgau (17,8%) und Heidelberg
(16,9%). Würzburg folgt als erste bayerische Stadt mit einem Männeranteil
von 16,4%. Unter den ersten zehn Städten beziehungsweise Landkreisen
befinden sich fünf weitere bayerische Kreise sowie die brandenburgische
Landeshauptstadt Potsdam (15,8%) und die Stadt Weimar (15,9%).
Die Stadt Hoyerswerda (2,4%),
der Landkreis Nienburg an der Weser (4,4%) sowie die Stadt Emden (4,6%)
weisen als einzige Kreise bundesweit einen Männeranteil an den bewilligten
Elterngeldanträgen von weniger als 5% auf.
Die entsprechenden Ergebnisse
zu allen 439 Kreisen in Deutschland der Elterngeldstatistik für 2007
sowie eine dazugehörige Kreiskarte sind kostenlos abrufbar im Publikationsservice
von Destatis unter www.destatis.de/publikationen (Suchbegriff: "Elterngeld
regional")."
_
2007:
Elterngeld bei Vätern weiter hoch im Kurs
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 087
vom 29. Februar 2008
"WIESBADEN - Im vierten Quartal 2007 wurden bundesweit knapp 23 000
Anträge von Vätern auf Elterngeld bewilligt. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden weiter mitteilt, entfiel damit bei einer
Gesamtzahl von 184 500 bewilligten Anträgen im gleichen Zeitraum jeder
achte Antrag (12,4%) auf Elterngeld auf einen Vater.
Während im ersten Quartal 2007 erst 6,9% der
Anträge für Väter waren, belief sich deren Anteil im dritten
Quartal bereits auf 10,7%. Eine mögliche Ursache für den weiteren
Anstieg auf 12,4% im vierten Quartal liegt darin, dass Väter nun verstärkt
Anträge für die Partnermonate stellen.
Im vierten Quartal 2007 lag der Anteil der für
Väter bewilligten Anträge in Bayern mit 15,1% und in Berlin mit
15,0% am höchsten. Am geringsten war der Väter-Anteil wie bereits
in den Vorquartalen im Saarland mit 7,1%.
Über das gesamte Jahr 2007 gesehen wurden insgesamt
571 000 Anträge auf Elterngeld bewilligt. 60 000 oder 10,5% davon
waren von Vätern gestellt worden. Beim früheren Erziehungsgeld,
das an Einkommensgrenzen gekoppelt war, lag der Anteil der Anträge
von Vätern in den Vorjahren bei etwa 3,3%. Die Zahl der Elterngeldanträge
für im Jahr 2007 geborene Kinder wird noch weiter ansteigen. Viele
Eltern, deren Kind im letzten Quartal 2007 zur Welt kam, werden erst Anfang
2008 einen Antrag auf Elterngeld stellen und auch zahlreiche Väter
von Kindern, die im Jahr 2007 geboren wurden, können noch immer Elterngeld
für Partnermonate beantragen.
Mehr als die Hälfte der Väter (60%), die
Elterngeld in Anspruch nahmen, beantragte es 2007 für zwei Monate,
18% nahmen eine "Babyzeit" von zwölf Monaten. Bei den Müttern
ergibt sich ein anderes Bild: 87% von ihnen beanspruchten Elterngeld für
zwölf Monate, weniger als ein Prozent für zwei Monate.
Das Elterngeld beträgt für erwerbstätige
Mütter und Väter 67% des wegfallenden Nettogehalts, wenn die
Arbeitszeit vollständig oder teilweise reduziert wird, mindestens
300 Euro und höchstens 1 800 Euro monatlich. Nicht Erwerbstätige
erhalten einen Mindestbetrag von 300 Euro. Je nach Familiensituation erhöht
sich der Betrag um einen Geschwisterbonus und/oder einen Mehrlingszuschlag.
Mehr als jede zweite Mutter (52%) mit bewilligtem
Antrag erhielt 2007 Elterngeld auf Basis des Mindestbetrags, häufig
in Verbindung mit Geschwisterbonus und/oder Mehrlingszuschlag. Bei den
Vätern traf dies bei 28% zu.
Differenzierte Ergebnisse der Elterngeldstatistik
für 2007 sind abrufbar im Publikationsservice des Statistischen
Bundesamtes unter http://www.destatis.de/publikationen (Suchbegriff: "Elterngeld").
"
2007:
16% aller Kinder unter 6 Jahren werden ganztags betreut
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 070
vom 22. Februar 2007
"WIESBADEN - Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
haben im Jahr 2007 bundesweit Eltern von rund 681 000 Kindern unter sechs
Jahren Angebote der ganztägigen Erziehung, Bildung und Betreuung als
Ergänzung zur eigenen Kindererziehung in Anspruch genommen. Das waren
rund 49 000 oder 8% mehr als im Jahr zuvor. Bezogen auf alle Kinder in
dieser Altersgruppe lag die Ganztagsquote bei 16%, gegenüber 14,5%
im Jahr 2006. Als Ganztagsbetreuung wird gerechnet, wenn die Eltern eine
Betreuungszeit von mehr als sieben Stunden pro Tag in einer Tageseinrichtung
oder bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater vereinbart haben.
Bei der Teilgruppe der unter 3-Jährigen haben
Eltern von rund 151 500 Kindern Angebote der Ganztagsbetreuung ergänzend
in Anspruch genommen, rund 11% mehr als im Jahr 2006. Der Anteil der Kinder
in Tagesbetreuung an allen Kindern dieser Altersgruppe ("Ganztagsquote")
belief sich bundesweit auf 7,3%. Deutliche Unterschiede zeigen sich im
Vergleich der neuen Länder und des früheren Bundesgebietes (jeweils
ohne Berlin) bei der Inanspruchnahme von Ganztagsbetreuung. Während
in Ostdeutschland für mehr als ein Viertel (26,8%) aller unter 3-Jährigen
von den Eltern Ganztagsbetreuung in Anspruch genommen wurde, betrug für
diese Altersgruppe in Westdeutschland die Quote lediglich 3,2%. Die niedrigste
Quote findet sich in Niedersachsen mit 1,9%, die höchste Quote gab
es in Thüringen (31,0%).
Für die Altersgruppe der Kinder von 3 bis unter
6 Jahren belief sich die Ganztagsquote bundesweit auf 24,3%, das waren
529 000 Kinder (2006: 22,1%, 495 000 Kinder). Auch hier lag die Ganztagsquote
im Westen mit 17,3% deutlich unter der im Osten (60,0%). Wie schon bei
den unter 3-Jährigen wies auch hier Thüringen mit 84,5% die höchste
Ganztagsquote auf, Baden-Württemberg mit 8% die niedrigste.
Detaillierte Ergebnisse finden Sie in unserem Publikationsservice
unter www.destatis.de/publikationen, Suchbegriffe "Tageseinrichtungen"
beziehungsweise "Tagespflege".
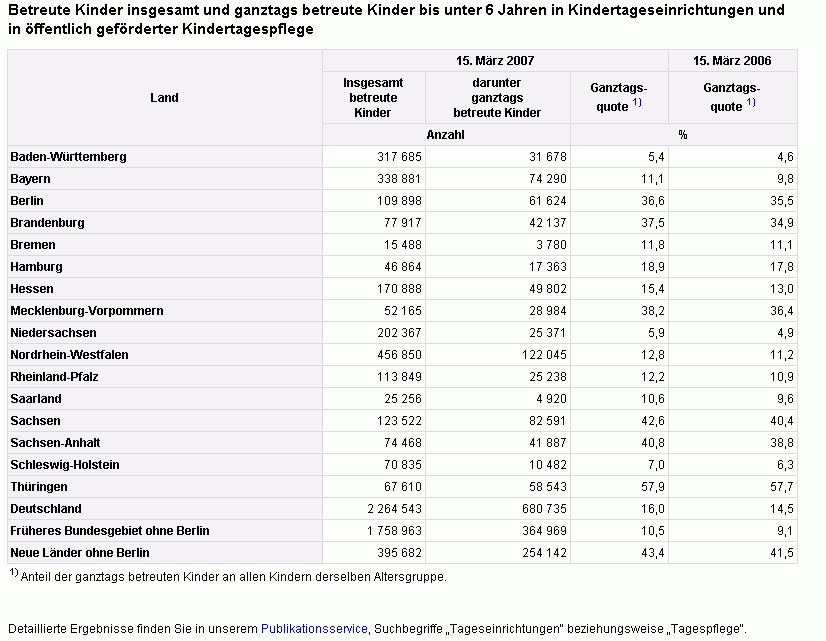
"
1991-2006:
79% mehr erzieherische Hilfen von 1991 bis 2006
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 038
vom 30. Januar 2008
"WIESBADEN - Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
haben im Jahr 2006 in Deutschland mehr als 651 000 junge Menschen im Alter
bis zu 26 Jahren erzieherische Hilfe in Anspruch genommen. Das waren 11%
oder 66 000 mehr als 2001 und 79% oder 288 000 mehr als 1991, dem Jahr,
in dem das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz in Kraft getreten ist.
Unter dem Stichwort "erzieherische Hilfe" erhalten
junge Menschen und Familien bei persönlichen Schwierigkeiten und Konflikten
im sozialen Umfeld verschiedene pädagogische Hilfen und Förderungen.
Das Spektrum der Unterstützung reicht von Erziehungsberatung über
Erziehungsbeistände und soziale Gruppenarbeit, sozialpädagogische
Familienhilfe und Tagesgruppenerziehung bis zur Vollzeitpflege in einer
anderen Familie und Heimerziehung. 28 von 1 000 jungen Menschen dieser
Altersgruppe nahmen im Jahr 2006 eines dieser Hilfeangebote wahr, mehr
als doppelt so viele wie 1991 (13 von 1 000).
Ziel der Kinder- und Jugendhilfe ist es, den jungen
Menschen einen Verbleib in der Familie zu ermöglichen. So wurden 2006
fast drei Viertel der Hilfen innerhalb der Familie (ambulant) durchgeführt,
4% teilstationär und 23% stationär. Der Anteil der ambulanten
Hilfen stieg gegenüber 1991 um 17 Prozentpunkte an, während der
Anteil der stationären Hilfen in derselben Größenordnung
abnahm.
Insgesamt nahmen mehr Jungen als Mädchen erzieherische
Hilfen in Anspruch. Die Geschlechterverteilung variierte 2006 zwischen
50:50 bei der Vollzeitpflege in einer anderen Familie und einem Anteil
von 75% männlicher junger Menschen bei der sozialen Gruppenarbeit.
"
2006:
Zahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe steigt
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 031
vom 23. Januar 2008
"WIESBADEN - Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) hat sich die Gesamtzahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
(ohne Einrichtungen der Kindertagesbetreuung) in Deutschland zum Jahresende
2006 gegenüber 2002, dem Zeitpunkt der letzten Erhebung, um rund 4%
erhöht. Insgesamt gab es rund 28 200 Einrichtungen unter anderem für
Heimerziehung, Jugendarbeit, Frühförderung sowie Jugendzentren
und Jugendräume, Familienferienstätten und Erziehungs-, Jugend-
und Familienberatungsstellen. Die Zahl der Einrichtungen in öffentlicher
Trägerschaft sank um rund 5%, die freien Träger betrieben dagegen
rund 8% mehr Einrichtungen als vier Jahre zuvor. Zusätzlich gab es
2006 weitere 2 800 Einrichtungen und Geschäftsstellen der Jugendhilfeverwaltung
(- 2,5% gegenüber 2002). In diesen Ergebnissen sind keine Daten für
Berlin berücksichtigt.
Rund drei Viertel der Einrichtungen (76%, ohne Jugendhilfeverwaltungen)
wurden von freien Trägern der Jugendhilfe betrieben.
Auch die Zahl der Beschäftigten in den Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe (ohne Verwaltung) erhöhte sich bundesweit
gegenüber 2002 leicht auf 141 400 Personen (+ 1,5%). Zwischen 1998
und 2002 hatte es einen Personalabbau um 2,7% gegeben. Bei den tätigen
Personen gab es im früheren Bundesgebiet einen Zuwachs von 4%. In
den neuen Ländern hat sich der zwischen 1998 und 2002 vorgenommene
Personalabbau von 19% durch einen weiteren Rückgang um 11% auf 21
100 Beschäftigte fortgesetzt.
Detaillierte Ergebnisse werden in unserem Publikationsservice
www.destatis.de/publikationen unter dem Suchbegriff "Einrichtungen Jugendhilfe"
abrufbar sein, wenn die endgültigen Ergebnisse aus Baden-Württemberg
und Hessen vorliegen."
2007:
Mehr Kinder unter 3 Jahren in Tagesbetreuung
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 515
vom 19. Dezember 2007
"WIESBADEN - Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes
haben im März 2007 die Eltern von rund 321 300 Kindern unter drei
Jahren eine Betreuung in Kindertageseinrichtungen oder in öffentlich
geförderter Kindertagespflege als Ergänzung zur eigenen Kindererziehung
und Betreuung in Anspruch genommen. Dies entspricht einem Anstieg um knapp
34 400 Kinder oder 12% gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der Kinder
in Tagesbetreuung an allen Kindern dieser Altersgruppe (Betreuungsquote)
belief sich damit bundesweit auf rund 15,5% (2006: 13,6%).
Sowohl im früheren Bundesgebiet als auch in
den neuen Ländern (jeweils ohne Berlin) wurden 2007 mehr Kinder unter
drei Jahren ergänzend zur häuslichen Erziehung betreut. Absolut
erhöhte sich die Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren im früheren
Bundesgebiet um rund 28 900 Kinder auf 166 550 (+ 21%) und in den neuen
Ländern um 3 400 auf 120 200 Kinder (+ 3%). In Westdeutschland (ohne
Berlin) stieg die Betreuungsquote damit von 8,0% auf rund 10% und in Ostdeutschland
(ohne Berlin) von 39,7% auf nunmehr 41,0%.
Die größte Veränderung der Betreuungsquote
bei Kindern unter drei Jahren gegenüber 2006 verzeichnete mit einem
Plus von 3,4 Prozentpunkten das Land Hessen, gefolgt von Brandenburg (+
3,0 Prozentpunkte). In Thüringen ist die Betreuungsquote für
Kinder dieser Altersgruppe leicht zurückgegangen (- 0,4 Prozentpunkte).
Hierbei sank die Zahl der betreuten Kinder im Alter von zwei Jahren um
790 Kinder (- 6%).
In Einrichtungen der Kindertagesbetreuung wurden
2007 rund 278 700 Kinder unter drei Jahren gezählt (+ 24 760 Kinder;
+ 10%). Bei Tagesmüttern und Tagesvätern, die eine öffentliche
Förderung erhielten, waren es 42 630 Kinder (+ 9 600 Kinder; + 29%).
Auch bei den Kindern im Kindergartenalter zwischen
drei und fünf Jahren ist zum Stichtag 15. März 2007 nach vorläufigen
Ergebnissen bundesweit ein Anstieg der Betreuungsquote auf etwa 90% festzustellen
(2006: 87%).
Endgültige Ergebnisse mit detaillierten Auswertungen
werden voraussichtlich bis Ende Januar 2008 erstellt, wenn die endgültigen
Daten über Kinder in Kindertageseinrichtungen für das Jahr 2007
aus Niedersachsen vorliegen.
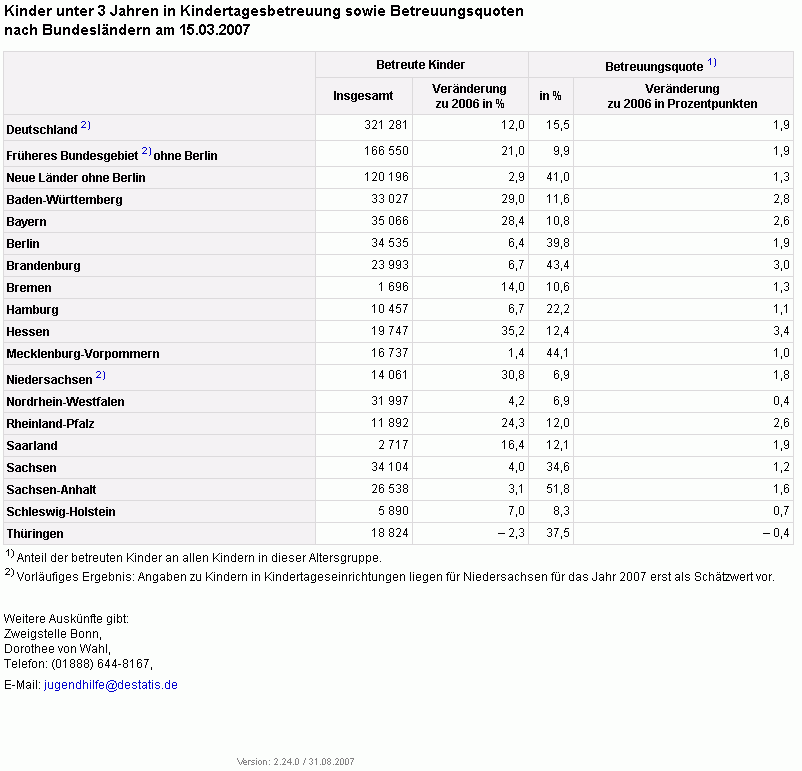
2006: Ausgaben für Tagesbetreuung von Kindern steigen 2006 leicht an
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 484 vom 29. November 2007
"WIESBADEN - Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes haben Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2006 insgesamt 11,8 Milliarden Euro für die Kindertagesbetreuung ausgegeben. Dies waren mehr als die Hälfte (56%) der Gesamtausgaben der öffentlichen Hand für Kinder- und Jugendhilfe von 20,9 Milliarden Euro. Nach Abzug der Einnahmen, unter anderem aus Gebühren und Teilnahmebeiträgen, wurden netto 10,4 Milliarden Euro für Kindertagesbetreuung aufgewendet. Damit sind die reinen Ausgaben in diesem Bereich bundesweit gegenüber dem Vorjahr um 80,4 Millionen Euro oder 0,8% gestiegen.
In Ostdeutschland (ohne Berlin) erhöhten sich die reinen Ausgaben für Kindertagesbetreuung insgesamt um 78,1 Millionen Euro oder 3,8% auf rund 2,1 Milliarden Euro, in Westdeutschland (ohne Berlin) ist ein Anstieg um 4,4 Millionen Euro oder 0,1% auf 7,5 Milliarden Euro zu verzeichnen. In den Ländern verlief die Entwicklung unterschiedlich. Während in zwölf Ländern 2006 zwischen 0,6% (Niedersachsen) und 8,5% (Sachsen) mehr für Kindertagesbetreuung ausgegeben wurde als im Jahr zuvor, sanken in vier Ländern die Ausgaben zwischen 0,3% (Berlin) und 3,1% (Bremen und Nordrhein-Westfalen).
Bei der Bewertung dieser Ausgabenentwicklungen ist zu berücksichtigen, dass neben dem Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren auch Veränderungen bei den Betreuungsangeboten für Schulkinder stattgefunden haben. In einigen Ländern, zum Beispiel in Berlin und Nordrhein-Westfalen, wurde die Betreuung insbesondere von Grundschulkindern an die Schulen verlagert. Mit dieser Verlagerung gingen häufig auch die Trägerschaft und damit die finanzielle Zuordnung der Ausgaben für diese Betreuung in den schulischen Bereich über. Diese Ausgaben fallen daher nicht mehr als Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe an, ohne dass sich das Betreuungsangebot grundlegend geändert haben muss.
Differenzierte Ergebnisse sind abrufbar im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/publikationen (Suchbegriff "Ausgaben Jugendhilfe").
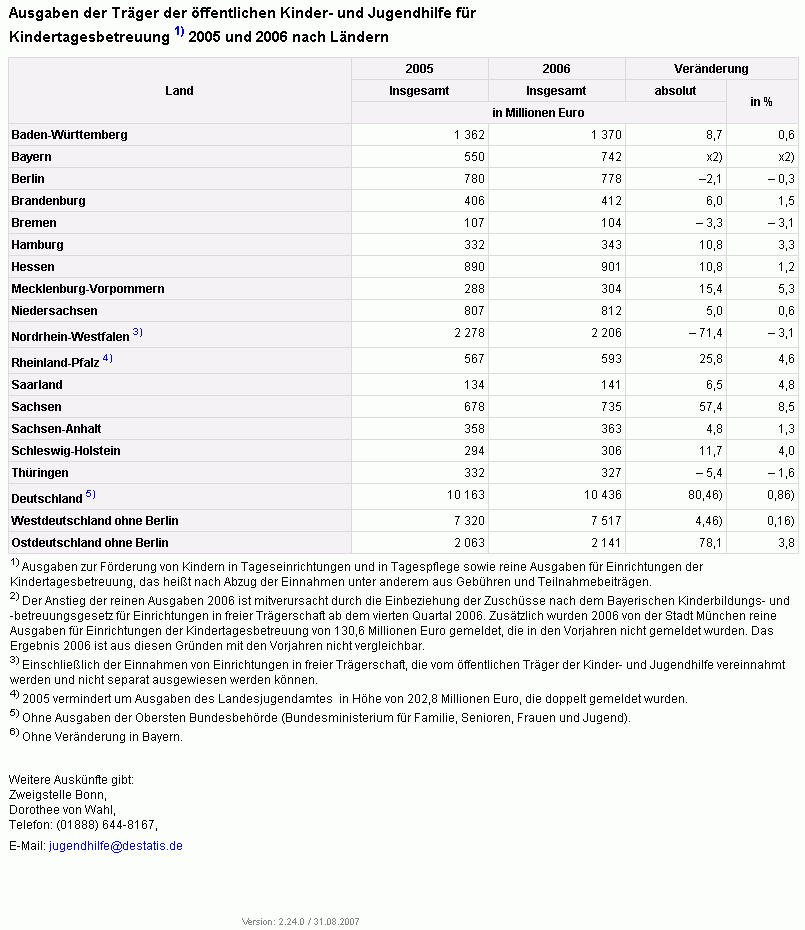
"
01-09.
2007 Elterngeld bei Vätern meistens für 2 Monate bewilligt
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 453
vom 13.11.2007
"Wiesbaden - Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden in den
ersten neun Monaten des Jahres 2007 rund 387 000 Anträge auf Elterngeld
bewilligt. Nachdem im ersten Halbjahr rund 200 000 Anträge genehmigt
wurden, kamen im dritten Quartal weitere 187 000 Bewilligungen hinzu. Von
Januar bis September wurden bundesweit rund 37 000 Anträge von Vätern
auf Elterngeld bewilligt, dies entspricht einem Anteil von 9,6%.
Während im ersten Quartal 2007 6,9% der
Anträge für Väter waren, belief sich der Anteil im dritten
Quartal auf 10,7%. Eine mögliche Ursache für diesen Anstieg liegt
darin, dass Väter nunmehr verstärkt Anträge für die
Partnermonate stellen. Mehr als die Hälfte der Väter (57%) beantragte
in den ersten neun Monaten des Jahres 2007 das Elterngeld für zwei
Monate, 20% nehmen eine "Babyzeit" von zwölf Monaten. Bei den Müttern
ergibt sich ein anderes Bild: 86% von ihnen beanspruchen Elterngeld für
zwölf Monate, ein Prozent für zwei Monate.
36% der Väter, die das Elterngeld für
zwölf Monate in Anspruch nehmen, erhalten ein Elterngeld von 300 Euro
monatlich, 12% erhalten 1 500 Euro oder mehr. Von den Vätern, die
zwei Monate Elterngeld nehmen, erhalten 19% 300 Euro und 22% 1 500 Euro
oder mehr.
Der Anteil der für Väter bewilligten Anträge
lag von Januar bis September mit 12,4% in Berlin am höchsten. Anteile
von 10% oder mehr wurden für Bayern (11,2%), Hamburg (10,8%), Brandenburg
(10,5%) und Thüringen (10,0%) ermittelt. Am geringsten war der Väter-Anteil
in Sachsen-Anhalt (7,6%) und im Saarland (5,8%).
Das Elterngeld beträgt 67% des letzten Nettogehalts,
wenn die Arbeitszeit vollständig oder teilweise reduziert wird, mindestens
300 Euro und höchstens 1 800 Euro monatlich. Nicht Erwerbstätige
erhalten einen Mindestbetrag von 300 Euro. Je nach Familiensituation erhöht
sich der Betrag um einen Geschwisterbonus und/oder einen Mehrlingszuschlag.
Differenzierte Ergebnisse der Elterngeldstatistik
für die ersten neun Monate 2007 sind abrufbar im Publikationsservice
des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/publikationen
(Suchbegriff: "Elterngeld").
Weitere Auskünfte gibt: Zweigstelle Bonn, Dorothee
von Wahl, Telefon: (0611) 75-8167, E-Mail: jugendhilfe@destatis.de"
2006: 20,9 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2006
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 474 vom 23. November 2007
"WIESBADEN - Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes haben Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2006 insgesamt 20,9 Milliarden Euro für Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben. Damit sind die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,3% angestiegen. Nach Abzug der Einnahmen, unter anderem aus Gebühren und Teilnahmebeiträgen, wurden netto rund 18,8 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhilfe aufgewendet (- 0,4% gegenüber 2005).
Mit 11,8 Milliarden Euro wurde mehr als die Hälfte der Bruttoausgaben (56%) für Kindertagesbetreuung geleistet. Nach Abzug der Einnahmen in diesem Bereich verblieben für die öffentliche Hand netto 10,4 Milliarden Euro an Ausgaben.
Mit insgesamt 5,6 Milliarden Euro wendeten die öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe 2006 gut ein Viertel der Bruttoausgaben (27%) für Hilfen zur Erziehung auf. 3,4 Milliarden Euro dieser Ausgaben entfielen auf die Unterbringung junger Menschen außerhalb des Elternhauses in Vollzeitpflege, Heimerziehung oder in anderer betreuter Wohnform. Für sozialpädagogische Familienhilfe erhöhten sich die Ausgaben um 8% auf 393,4 Millionen Euro.
Für Maßnahmen der Jugendarbeit, zum Beispiel außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugenderholung oder internationale
Jugendarbeit, wurden 1,4 Milliarden Euro oder 6,6% der Gesamtausgaben aufgewendet.
Die Ausgaben für vorläufige Schutzmaßnahmen, zu denen insbesondere die Inobhutnahme bei Gefährdung des Kindeswohls gehört, stiegen bundesweit von 76,2 Millionen Euro im Jahr 2005 auf 81,1 Millionen Euro 2006 (+ 6,4%).
Detaillierte Ergebnisse sind ab 29. November 2007 abrufbar im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes unter
http://www.destatis.de/publikationen (Suchbegriff "Ausgaben Jugendhilfe")."
Große regionale Unterschiede bei der Kindertagesbetreuung 2006
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 369 vom 11. September 2007
WIESBADEN - In den ostdeutschen Bundesländern war die Betreuungsquote
für Kinder unter drei Jahren im Jahr 2006 deutlich höher als
in den übrigen Bundesländern. Insgesamt nahmen in Ostdeutschland
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Eltern von fast 117 000
Kindern unter drei Jahren Angebote der Kindertagesbetreuung als Ergänzung
zur eigenen Kindererziehung und Betreuung in Anspruch. Der Anteil der Kinder
in Tagesbetreuung an allen Kindern dieser Altersgruppe (Betreuungsquote)
belief sich somit auf durchschnittlich 39,7%. In den alten Bundesländern
(ohne Berlin) lag die Betreuungsquote hingegen bei 8,0%; in Berlin betrug
die Quote 37,8%.
Die höchsten Betreuungsquoten im Kreisvergleich
finden sich allesamt in den ostdeutschen Bundesländern. Der höchste
Wert ergab sich für den ehemaligen Saalkreis mit 57,7%; gefolgt vom
Kreis Schönebeck (55,8%) und Jerichower Land (55,5%). Die für
das Jahr 2013 angestrebte Betreuungsquote von 35% wurde insgesamt in 84
Kreisen Ostdeutschlands erreicht. In den alten Ländern wiesen die
Universitätsstädte Heidelberg (23,3%) und Freiburg im Breisgau
(22,7%) die höchsten Quoten auf.
Die niedrigsten Betreuungsquoten wiesen zum Erhebungsstichtag
15. März 2006 der Kreis Nienburg/Weser mit 1,0%, gefolgt von Cloppenburg
(1,1%) und dem Ostallgäu sowie Straubing-Bogen (jeweils 1,8%) auf.
Dies geht aus der gemeinsamen Veröffentlichung
"Kindertagesbetreuung regional 2006" der Statistischen Ämter des Bundes
und der Länder hervor, die einen Überblick über die Inanspruchnahme
von Kindertagesbetreuung als Ergänzung zur Erziehung und Betreuung
durch die Eltern gibt. Die Publikation ist kostenlos im Publikationsservice
des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/publikationen
erhältlich. Sie stellt neben den Betreuungsquoten der Kinder unter
drei Jahren auch Daten zur Tagesbetreuung der Kinder im Alter von drei
bis unter sechs Jahren zur Verfügung.
Erziehungsberatung half 178 000 Schulkindern 2006 [> 2001]
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 371 vom 12. September 2007
"WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben im Jahr 2006 insgesamt 311 000 junge Menschen unter 27 Jahren eine erzieherische Beratung wegen individueller oder familienbezogener Probleme beendet. Das waren rund 1 000 Beratungen mehr als im Vorjahr und 30% mehr als 1996. Rund 57% (178 200) dieser jungen Menschen waren im schulpflichtigen Alter von 6 bis 14 Jahren. 21% aller Beratungen (65 000) wurden für 6- bis 8-jährige Grundschüler durchgeführt. 56% oder 173 800 aller beendeten Beratungen richteten sich an männliche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe werden diese Hilfen schwerpunktmäßig als Erziehungs- und Familienberatung, Jugendberatung sowie Suchtberatung angeboten.
Bei zwei Dritteln der Hilfen (206 000) nahm die Mutter Kontakt zur Beratungsstelle auf, 7% der jungen Menschen (20 500) suchten aus eigener Initiative um Rat und Unterstützung. Die übrigen 27% der Hilfen wurden durch beide Eltern gemeinsam, allein durch den Vater, durch soziale Dienste oder andere Stellen angeregt. 195 300 Beratungen (63%) dauerten weniger als sechs Monate.
Beziehungsprobleme standen im letzten Jahr bei 40% der Hilfesuchenden im Vordergrund. Weitere häufig genannte Ursachen waren Entwicklungsauffälligkeiten (25%), Schul- und Ausbildungsprobleme (25%) sowie Trennung oder Scheidung der Eltern (24%). In 14 300 Fällen (5%) wurde um Beratung nachgefragt, weil es Anzeichen für sexuellen Missbrauch und/oder Misshandlung gab (Mehrfachnennungen waren möglich).
Alle Ergebnisse sind abrufbar im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/publikationen (Suchbegriff "Institutionelle Beratung").
Sozialhilfe-Statistik (> Familienhilfe und Unterstützung)
* 2007/08 *
Krankenversicherung > Krankenversicherungsstatistik in der Gesundheitsstatistik.
Leben Verheiratete länger als Unverheiratete ?
[In Vorbereitung]
Literatur (Auswahl)
Literaturliste Walter Toman (Fachbiographie).
Historische Familienstatistik 1815-1990: [Google-Books]
Links (Auswahl: beachte)
- 16 Jahre Kinder- und Jugendhilfegesetz in Deutschland - 1991 - 2006. Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistiken. Erzieherische Hilfen 1991 bis 2006 "Von der Erziehungsberatung bis zur Heimerziehung" Statistiken [URL geändert].
- Destatis: Publikation [URL geändert]."Leben und Arbeiten in Deutschland, Sonderheft 1: Familien und Lebensformen, Ergebnisse des Mikrozensus 1996-2004" (PDF-Dokument, 1,6 MB)
- Information [URL geändert]. "Kinderlosigkeit von Akademikerinnen im Spiegel des Mikrozensus (PDF-Dokument, 0,3 MB)
- Google: <Walter Toman> <Geschwister> <Geschwisterkonstellation> <Familienkonstellation> <Familie>
- Sara Almes & Sanie Asani: Geschwisterbeziehungen zwischen Nähe und Rivalität
- Statistik der Lebenserwartung: destatis.
- Überblick Walter Toman im Internet.
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
In Memoriam Walter Toman: Zum dritten Todestag, 28.9.2006, erinnern wir an Walter Toman mit der Einrichtung der Seite "Familien-Statistik".
___
Bezugspersonen sind Menschen, zu denen man eine Beziehung hat. Der Beziehungsraum eines Menschen besteht aus: sich selbst (jeder hat auch eine Beziehung zu sich selbst > Selbstbild; PartnerIn, Angehörige (Kernfamilie := diejenigen, die in einem Haushalt leben, meist die Eltern und Geschwister, aber auch die Großfamilie mit Großeltern, Tanten, Onkels u.a.), Freunde I. Klasse (helfen in der Not, Persönliches anvertrauen, ein Geheimnis bewahren und sich verlassen können]; Freunde II. Klasse [auch wichtig, helfen beim Umzug, kommen zum Geburtstag u.a.]; Interessenbeziehungen [Sport, Spiel, Vergnügen, Kultur, Politik, Soziales], Nachbarn, ArbeitskollegInnen, manchmal auch Geschäftsbeziehungen. Weniger wichtig sind die Bekannten oder - mit Ausnahme in der heranwachsenden- und Selbstfindungszeit - die Phantasiebeziehungen (Leute, die man aus den Medien "kennt" oder Idole, Vorbilder). Für einige spielen auch metaphysisch-fiktive Beziehungen, wie Gott, Engel oder Schutzpatrone eine Rolle.
Beziehungen zu Institutionen und Einrichtungen markieren den Übergang in die nicht-personifizierte Welt. Den vielerlei Beziehungen hat man auch zur nicht-personifizierten Welt: zur Natur, zum Leben ("Lebenseinstellung", Ideale, Vorbilder und Werte), zur Umgebung, Heimat und Landschaft, zu Tieren und Pflanzen, zu Dingen und Sachen, zu Eigenschaften, Ereignissen und Verhaltensweisen.
___
Lebensformen und Lebensstile. Großbürgerlich, bürgerlich, kleinbürgerlich ("spießig"), proletarisch, prekariär, "bohemien" ("Künstlerart"), obdachlos, adelig, Geldadel, bäuerlich, intellektuell, snobistisch (was Besseres durch Dünkel oder Hochmut), Subkulturen und parallelgesellschaftlich, klerikal-klösterlich, PolitikerIn, Sonderling oder wertneutral persönlich andersartig. Alleine lebend, Single, Zusammenleben und Wohngemeinschaft, Kleinfamilie, Großfamilie, Mehrgenerationenhaus, Heim, betreutes Wohnen, Gefängnis, Krankenhaus u.v.a.m.
___
Standort: Familienstatistik (In memoriam Walter Toman)
Überblick Walter Toman im Internet.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
z.B. Walter Toman site: www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
IP-GIPT (DAS). Familien-Statistik. In memoriam Walter Toman 28.9.2006. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/lit/toman/famstat.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende Familien-Statistik_ Überblick_ Rel. Aktuelles_Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service-iec-verlag_ Mail: sekretariat@sgipt.org_
kontrolliert: irs 27.09.06
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
15.09.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.
12.05.15 2013 Erwerbstätige Mütter sind im Schnitt 27 Stunden pro Woche berufstätig.
10.10.14 2013 Jugendämter führten rund 116 000 Gefährdungseinschätzungen für Kinder durch.
07.12.13 2012: Geburtentrends und Familiensituation in Deutschland.
12.07.12 2011: In Deutschland lebte 2011 jede fünfte Person allein.
11.07.12 Scheidungsstatistik 1985-2011.
18.01.12 2010 Öffentliche Hand gab 2010 rund 28,9 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhilfe aus.
21.10.11 2010: In fast jedem dritten Haushalt leben Senioren
09.04.11 Arbeitszeiten von Eltern.
17.01.11 2010: Betreuungsquote bei einjährigen Kindern in vielen ostdeutschen Kreisen über 50%.
20.09.10 2009: Jedes vierte minderjährige Kind ist ein Einzelkind.
23.10.09 2008: Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe weiter stark gefragt
14.10.09 1998-2008: Mütter arbeiten immer häufiger in Teilzeit.
29.07.09 Bamberger Studie u.a. zu homosexuellen Eltern.
22.07.09 2008: Adoptionen
18.07.09 Sorgerechtsentzüge 2007 und 2008.
07.07.09 Scheidungen und Anzahl betroffener Kinder 1985-2008.
29.05.09 Jugend und Familie in Europa.
15.11.08 Gleichberechtigung: 2007: Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen.
04.11.08 2007: Wie leben Männer in Deutschland ?
18.07.08 2007: Zahl der Sorgerechtsentzüge 2007 um 13% gestiegen.
15.07.08 2007 Inobhutnahmen: Tag für Tag nehmen Jugendämter 77 Kinder in Obhut.
11.06.08 2008-1Q 2,5% weniger Schwangerschaftsabbrüche im ersten Quartal 2008. * Elterngeld für 2007 geborene Kinder.
09.05.08 2007 Große regionale Unterschiede bei Ganztagsbetreuung von Kindern 2007.
01.05.08 2006 Jede zehnte Frau zwischen 25 und 54 bleibt wegen Familie zu Hause. * Umorganisation: einige Statistiken wurden in die Abteilung Wirtschaftsstatistik ausgelagert bzw. umglinkt.
12.03.08 2007: Elterngeld für Väter in bayerischen Kreisen besonders attraktiv * 2007: Konsumausgaben 2007 stark von PKW-Käufen beeinflusst.
11.03.08 2006: Leichter Anstieg der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. * 2006: Alleinstehende Frauen sind oft älter als 65, alleinstehende Männer seltener.
06.03.08 2008: Frauen in den Parlamenten weltweit unterrepräsentiert.
05.03.08 2,4% weniger Schwangerschaftsabbrüche 2007.
29.02.08 Elterngeld 2007.
07.02.08 Rubrik Krankenversicherung eingeführt.
20.12.07 Neugliederung. * Entwicklung der privaten Haushalte.
19.12.07 2007: Mehr Kinder unter 3 Jahren in Tagesbetreuung. * 2006: Die meisten Haushaltsabfälle werden getrennt gesammelt.
18.12.07 Frauen werden im Durchschnitt mit 26 Mutter.
29.11.07 Ausgaben für Kinderbetreuung 2005/06.
25.11.07 Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe 2006.
07.11.07 Ehescheidungen und Anzahl betroffener Kinder 1985-2006 * Wohngeld 2006 *
08.10.07 Nachtrag: 2006: Geburten, Sterbefälle und auch Bevölkerung gingen zurück.
05.10.07 Entwicklung Privathaushalte bis 2025.
04.10.07 Erwerbssituation Schuldenberatener.
18.09.07 Rund 306 000 Personen erhalten (Sozial) Hilfe zum Lebensunterhalt.
12.09.07 Erziehungsberatung half 178 000 Schulkindern.
11.09.07 Große regionale Unterschiede bei der Kindertagesbetreuung 2006.
11.10.06 Link: Geschwisterbeziehungen zwischen Nähe und Rivalität