(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=30.04.2008 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 27.10.16
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Wirtschaftsstatistik Sozialhilfe
von Rudolf Sponsel, Erlangen
- 2015 398 000 Personen erhielten Ende 2015 Hilfe zum Lebensunterhalt.
- 2010: Sozialhilfeausgaben in 2010 um 3,9 % gestiegen.
- 2010: Quote der Empfänger sozialer Mindestsicherung sinkt auf 9,2 %.
- 2009: Sozialhilfeausgaben 2009: Anstieg auf netto 20,9 Milliarden Euro.
- 2007: 312 000 Personen erhielten Ende 2007 Hilfe zum Lebensunterhalt.
- 2007: Sozialhilfeausgaben 2007: Anstieg auf netto 18,8 Milliarden Euro.
- Sozialhilfe 2006: 1,1 Mill. Menschen erhielten besondere Leistungen.
- Rund 306 000 Personen erhalten (Sozial) Hilfe zum Lebensunterhalt.
- Methodische Kurzbeschreibung Sozialhilfestatistik.
- Ausgaben Statistik Sozialhilfe (2003 - 2006).
- Einnahmen und Ausgaben Sozialhilfestatistik (2003-2006).
- Sozialleistungen - Sozialhilfe in Deutschland (2003-2005).
- Wohngeld 2006.
2015 398 000 Personen erhielten
Ende 2015 Hilfe zum Lebensunterhalt
PRESSEMITTEILUNG des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)
„Zahl der Woche“ vom 25.10.2016
"WIESBADEN – Am Jahresende 2015 erhielten in Deutschland rund 398 000
Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII "Sozialhilfe"). Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die Zahl der Empfängerinnen
und Empfänger im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 %."
2010:
Sozialhilfeausgaben in 2010 um 3,9 % gestiegen
Pressemitteilung des Statistischen
Bundesamtes Nr. 391 vom 20.10.2011
"WIESBADEN - Im Jahr 2010 wurden in Deutschland
21,7 Milliarden Euro netto für Sozialhilfeleistungen nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII "Sozialhilfe") ausgegeben. Nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes (Destatis) entsprach dies einer Steigerung
von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr.
Pro Kopf wurden in Deutschland
2010 für die Sozialhilfe rechnerisch 266 Euro netto aufgewendet. Im
früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) waren die Pro-Kopf-Ausgaben mit
276 Euro deutlich höher als in den neuen Ländern (einschließlich
Berlin) mit 227 Euro. Die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben hatten im Jahr
2010 die drei Stadtstaaten: In Bremen lagen sie bei 441 Euro, in Hamburg
bei 414 Euro und in Berlin bei 406 Euro. Von den westdeutschen Flächenländern
gab Baden-Württemberg mit 194 Euro je Einwohner am wenigsten für
Sozialhilfe aus, Schleswig-Holstein mit 314 Euro am meisten. In den ostdeutschen
Flächenländern waren die Pro-Kopf-Ausgaben in Sachsen mit 139
Euro am niedrigsten und in Mecklenburg-Vorpommern mit 223 Euro am höchsten.
Im Jahr 2010 entfiel mit 57
% der überwiegende Teil der Nettoausgaben für Sozialhilfe auf
die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (im 6. Kapitel des
SGB XII geregelt). 19 % der Ausgaben wurden für die Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung (gemäß 4. Kapitel des SGB
XII) aufgewendet, 14 % für die Hilfe zur Pflege (nach dem 7. Kapitel
SGB XII) und 10 % vor allem für die Hilfe zum Lebensunterhalt und
für die Hilfen zur Gesundheit (entsprechend dem 3., 5., 8. und 9.
Kapitel des SGB XII). Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese Ausgabenanteile
nicht verändert.

"
_
2010: Quote der
Empfänger sozialer Mindestsicherung sinkt auf 9,2 %
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr.
48 vom 29.11.2011
"WIESBADEN - Im Jahr 2010 ging der Anteil der Empfängerinnen und
Empfänger sozialer Mindestsicherungsleistungen an der Gesamtbevölkerung
deutlich zurück. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
sank die Mindestsicherungsquote nach vorläufigen Ergebnissen 2010
auf 9,2 %. Das ist der niedrigste Wert seit der erstmaligen Berechnung
im Jahr 2006. Ende 2010 erhielten somit etwa 7,5 Millionen Menschen Transferleistungen
zur Sicherung ihres Lebensunterhalts.
Weitere Informationen und methodische Hinweise zu
den einzelnen Leistungen der sozialen Mindestsicherungssysteme sowie ausführliche
Ergebnisse für das Jahr 2009 enthält die Publikation "Soziale
Mindestsicherung in Deutschland 2009". Diese steht im Internetangebot des
Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de, Publikationen > Fachveröffentlichungen
> Sozialleistungen zum Download bereit."
2009:
Sozialhilfeausgaben 2009: Anstieg auf netto 20,9 Milliarden Euro
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr.
380 vom 22. Oktober 2010
"WIESBADEN - Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
wurden im Laufe des Jahres 2009 in Deutschland rund 23,0 Milliarden Euro
brutto für Sozialhilfeleistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
(SGB XII "Sozialhilfe") ausgegeben. Nach Abzug der Einnahmen in Höhe
von circa 2,1 Milliarden Euro, größtenteils Erstattungen anderer
Sozialleistungsträger, betrugen die Sozialhilfeausgaben netto etwa
20,9 Milliarden Euro. Damit stiegen sie gegenüber dem Vorjahr um 5,9%.
Pro Kopf wurden in Deutschland im Jahr 2009 für
die Sozialhilfe rechnerisch 255 Euro (Vorjahr: 241 Euro) netto aufgewendet.
Im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) waren die Pro Kopf-Ausgaben
mit 264 Euro wesentlich höher als in den neuen Ländern (ohne
Berlin) mit 172 Euro. Die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben hatten im Jahr
2009 - wie im Vorjahr - die drei Stadtstaaten Bremen (418 Euro), Hamburg
(396 Euro) und Berlin (391 Euro). In den alten Flächenländern
verbuchte Baden-Württemberg die niedrigsten Pro-Kopf-Ausgaben (188
Euro), Schleswig-Holstein die höchsten (305 Euro). In den neuen Ländern
gab Sachsen je Einwohner am wenigsten für Sozialhilfe aus (134 Euro),
Mecklenburg-Vorpommern am meisten (215 Euro).
Wie in den Vorjahren floss der mit Abstand größte
Teil der Nettoausgaben für Sozialhilfe (57%) in die Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen. Mit knapp 12,0 Milliarden Euro stiegen diese
Ausgaben gegenüber 2008 um 6,8%. Die im 6. Kapitel des SGB XII geregelte
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hat die Aufgabe, eine
drohende Behinderung zu verhüten, eine vorhandene Behinderung oder
deren Folgen zu beseitigen beziehungsweise zu mildern und die Menschen
mit Behinderungen in die Gesellschaft einzugliedern.
Die Nettoausgaben für die Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung betrugen rund 3,9 Milliarden Euro - dies
entsprach 19% der gesamten Sozialhilfeausgaben. Im Vergleich zum Vorjahr
stiegen die Ausgaben um 6,7%. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
ist eine seit dem 1. Januar 2003 bestehende Sozialleistung, die den grundlegenden
Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Seit dem 1. Januar 2005
wird diese Leistung nach dem 4. Kapitel des SGB XII gewährt. Sie kann
bei Bedürftigkeit von 18- bis 64-Jährigen in Anspruch genommen
werden, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder von Personen ab 65
Jahren.
Für die Hilfe zur Pflege gaben die Sozialhilfeträger
4,6% mehr als im Vorjahr aus. Damit beliefen sich die Ausgaben im Jahr
2009 auf etwa 2,9 Milliarden Euro (14% aller Sozialhilfeausgaben). Die
Hilfe zur Pflege wird gemäß dem 7. Kapitel SGB XII Personen
gewährt, die in Folge von Krankheit oder Behinderung bei den gewöhnlichen
und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen
Lebens auf fremde Hilfe angewiesen sind.
Detaillierte Informationen und lange Zeitreihen
zu den Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe können auch kostenfrei
über die Tabelle 22111-0001 in der GENESIS-Online-Datenbank abgerufen
werden.
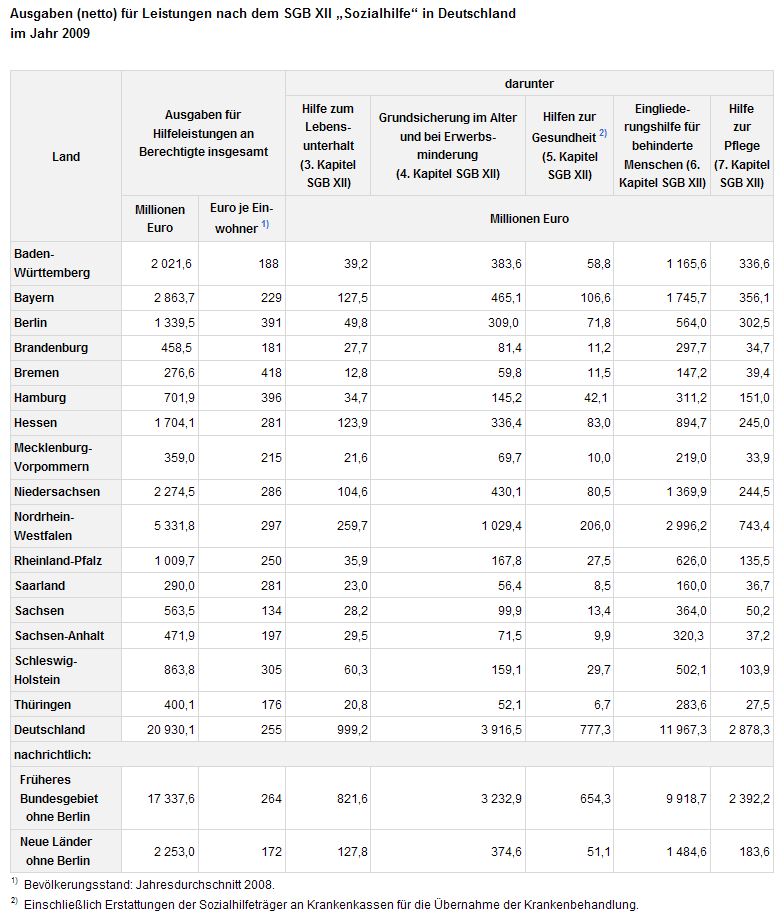
"
2007:
312 000 Personen erhielten Ende 2007 Hilfe zum Lebensunterhalt
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 410
vom 6. November 2008
WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt, ist zum Jahresende 2007 in Deutschland die Zahl der Empfänger
von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
(SGB XII "Sozialhilfe") gegenüber dem Vorjahr um 2,1% auf insgesamt
rund 312 000 Personen angestiegen. Der Anteil dieser Hilfebezieher an der
Bevölkerung lag damit - wie im Vorjahr - bei 0,4%. Die laufende Hilfe
zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII "Sozialhilfe" soll
den Grundbedarf vor allem an Nahrung, Kleidung, Unterkunft und Heizung
decken ("soziokulturelles Existenzminimum").
Die höchsten Empfängerquoten gab es Ende
2007 in Berlin (7,4 Empfänger je 1 000 Einwohner) und Sachsen-Anhalt
(5,9 je 1 000 Einwohner). Die niedrigsten Quoten verzeichneten Baden-Württemberg
(1,3 je 1 000 Einwohner) sowie Rheinland-Pfalz (2,4 je 1 000 Einwohner).
Von den insgesamt 312 000 Empfängern bezogen
88 000 Personen (28% der Empfänger) laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
außerhalb von Einrichtungen (bis Ende 2004 so genannte "Sozialhilfe
im engeren Sinne"); dies entspricht einem Anstieg von 8,1% gegenüber
dem Vorjahr. Der Anteil dieser Hilfebezieher an der Bevölkerung lag
- wie im Vorjahr - bei 0,1%. Infolge des zum 1. Januar 2005 in Kraft getretenen
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ("Hartz
IV") ging die Zahl der Hilfebezieher außerhalb von Einrichtungen
drastisch zurück. Ende 2004, also unmittelbar vor Inkrafttreten von
"Hartz IV", hatten noch rund 2,9 Millionen Personen oder 3,5% der Bevölkerung
diese Hilfeleistung bezogen. Seit 2005 erhalten ehemalige Sozialhilfeempfänger
im engeren Sinne, die grundsätzlich erwerbsfähig sind, sowie
deren Familienangehörige Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) "Grundsicherung für Arbeitsuchende". Dieser Personenkreis
wird seit 2005 nicht mehr in der Sozialhilfestatistik nachgewiesen. Hilfe
zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen erhalten seit Anfang
2005 somit zum Beispiel nur noch vorübergehend Erwerbsunfähige,
längerfristig Erkrankte oder Vorruhestandsrentner mit niedriger Rente.
Zur Struktur der Empfänger von laufender Hilfe
zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende 2007
ist Folgendes festzustellen: Rund 77 000 oder 87% der Hilfebezieher waren
Deutsche, 11 000 oder 13% ausländische Mitbürger. Die Empfängerquote
der Ausländer (1,6 Hilfebezieher je 1 000 Einwohner) lag höher
als die der Deutschen (1,0 Hilfebezieher je 1 000 Einwohner). Etwas mehr
als die Hälfte der Leistungsempfänger (52%) war männlich.
Rund 18% der Empfänger waren Kinder unter 18 Jahren. Das Durchschnittsalter
der Hilfebezieher lag bei 41 Jahren.
Die rund 88 000 Empfänger von laufender Hilfe
zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen lebten in 80 000
Haushalten; gut drei Viertel davon (76%) waren Einpersonenhaushalte.
Neben den Hilfebeziehern außerhalb von Einrichtungen
gab es am Jahresende 2007 noch rund 224 000 Personen (72% der Empfänger
insgesamt), die Hilfe zum Lebensunterhalt in einer Einrichtung (zum Beispiel
Wohn- oder Pflegeheim) erhielten. Gegenüber dem Vorjahr war hier ein
minimaler Rückgang (- 0,1%) festzustellen. Der Ausländeranteil
lag bei den Hilfeempfängern in Einrichtungen bei lediglich knapp 3%.
In Einrichtungen überwogen leicht die Hilfebezieherinnen mit 51%.
Das Durchschnittsalter der Hilfeempfänger in Einrichtungen betrug
55 Jahre.
Gegenüber dem Stand Ende 2004 hat sich die
Zahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen
aufgrund gesetzlicher Änderungen damit mehr als vervierzehnfacht.
Bis Ende 2004 wurden nämlich auch die Kosten des reinen Lebensunterhalts
in einer Einrichtung (Unterkunft, Verpflegung, et cetera) im Rahmen der
stationären Leistung oder Maßnahme (zum Beispiel Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen oder Hilfe zur Pflege) als Bedarf anerkannt.
Seit 2005 werden der Lebensunterhalt und die Maßnahmen für diesen
Personenkreis jeweils als separate Leistungen bewilligt. Dadurch werden
behinderte und pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen nun auch
in der Statistik über die Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt
erfasst, sofern sie diesen Bedarf nicht zum Beispiel durch Renteneinkünfte,
durch Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder
in anderer Weise decken können.
Insgesamt wandten die Kommunen und die überörtlichen
Sozialhilfeträger für die Hilfe zum Lebensunterhalt im Jahr 2007
netto, das heißt nach Abzug insbesondere von Erstattungen anderer
Sozialleistungsträger, 765 Millionen Euro auf; dies entspricht einer
Steigerung von 13,1% gegenüber dem Vorjahr. Rund 335 Millionen Euro
(44% der Ausgaben für diese Hilfeart) wurden dabei für Leistungen
außerhalb von Einrichtungen aufgewandt, die Ausgaben für Leistungen
in Einrichtungen beliefen sich auf 430 Millionen Euro (56% der Ausgaben
für die Hilfe zum Lebensunterhalt). Im Jahr 2004 wurden noch 8,8 Milliarden
Euro für die Hilfe zum Lebensunterhalt ausgegeben. Der deutliche Ausgabenrückgang
bei dieser Hilfeart ist - wie oben bereits dargestellt - auf die Einführung
des SGB II zum 1. Januar 2005 zurückzuführen. Rein rechnerisch
wurden im gesamten Jahr 2007 pro Einwohner rund 9 Euro für die Hilfe
zum Lebensunterhalt ausgegeben, 2004 waren es noch 107 Euro.
Eine methodische Kurzbeschreibung, eine zusätzliche
Tabelle und weitere Daten und Informationen zum Thema bietet die Online-Fassung
dieser Pressemitteilung unter www.destatis.de.
2007:
Sozialhilfeausgaben 2007: Anstieg auf netto 18,8 Milliarden Euro
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr.
288 vom 11. August 2008
"WIESBADEN - Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) haben im Jahr 2007 die Ausgaben für Sozialhilfeleistungen
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII "Sozialhilfe") in
Deutschland brutto 21,1 Milliarden Euro betragen. Nach Abzug der Einnahmen
in Höhe von 2,3 Milliarden Euro, die den Sozialhilfeträgern zum
größten Teil aus Erstattungen anderer Sozialleistungsträger
zuflossen, betrugen die Sozialhilfeausgaben netto 18,8 Milliarden Euro;
dies waren 3,9% mehr als im Vorjahr.
Je Einwohner wurden in Deutschland damit 2007 für
die Sozialhilfe rechnerisch 228 Euro (Vorjahr: 220 Euro) ausgegeben. In
den alten Bundesländern (ohne Berlin) waren es mit 237 Euro je Einwohner
wesentlich mehr als in den neuen Bundesländern (ohne Berlin) mit 152
Euro. Die mit Abstand höchsten Sozialhilfeausgaben je Einwohner hatten
im Jahr 2007 - wie schon im Vorjahr - die drei Stadtstaaten Bremen (385
Euro), Hamburg (367 Euro) und Berlin (355 Euro). Innerhalb der alten Flächenländer
wurden die geringsten Ausgaben je Einwohner in Baden-Württemberg mit
168 Euro festgestellt, die höchsten in Schleswig-Holstein mit 277
Euro. In den neuen Ländern waren in Sachsen
(114 Euro) die Pro-Kopf-Ausgaben am niedrigsten, in Mecklenburg-Vorpommern
(194 Euro) am höchsten.
Betrachtet man die finanziell wichtigsten Hilfearten
des SGB XII, so ist für die Nettoausgaben im Berichtsjahr 2007 auf
Bundesebene Folgendes festzustellen:
Mit 10,6 Milliarden Euro entfiel - wie in den Vorjahren
- der mit Abstand größte Teil der Sozialhilfeausgaben (57%)
auf die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Im Vergleich
zu 2006 stiegen die Ausgaben für diese Hilfeart um 0,9%. Die im 6.
Kapitel des SGB XII geregelte Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
hat die Aufgabe, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine vorhandene
Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen beziehungsweise zu mildern
und die Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft einzugliedern. Leistungsberechtigt
sind alle Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig
oder seelisch wesentlich behindert oder von einer Behinderung bedroht sind,
so weit die Hilfe nicht von einem vorrangig verpflichteten Leistungsträger
- wie zum Beispiel der Krankenversicherung, der Rentenversicherung oder
der Agentur für Arbeit - erbracht wird.
Die Nettoausgaben für die Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung lagen im Jahr 2007 bei 3,5 Milliarden Euro;
dies entspricht 18% der Sozialhilfeausgaben insgesamt. Im Vergleich zum
Vorjahr sind die Ausgaben für diese Hilfeart damit um 12,7% gestiegen.
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine seit dem
1. Januar 2003 bestehende Sozialleistung, die den grundlegenden Bedarf
für den Lebensunterhalt sicherstellt. Seit 1. Januar 2005 wird diese
Leistung nach dem 4. Kapitel des SGB XII gewährt. Sie kann bei Bedürftigkeit
von 18- bis 64-jährigen Personen, wenn diese dauerhaft voll erwerbsgemindert
sind, sowie von Personen ab 65 Jahren in Anspruch genommen werden.
Für die Hilfe zur Pflege gaben die Sozialhilfeträger
im Jahr 2007 netto insgesamt 2,7 Milliarden Euro aus (+ 5,4% gegenüber
dem Vorjahr). Die Ausgaben für diese Hilfeart machten somit 14% der
gesamten Sozialhilfeaufwendungen aus. Die Hilfe zur Pflege wird gemäß
dem 7. Kapitel SGB XII Personen gewährt, die in Folge von Krankheit
oder Behinderung bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf fremde Hilfe angewiesen
sind. Sie wird jedoch nur geleistet, wenn der Pflegebedürftige die
Pflegeleistungen weder selbst tragen kann noch sie von anderen - zum Beispiel
der Pflegeversicherung - erhält.
Für die Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel
SGB XII) wurden 2007 netto 740,1 Millionen Euro ausgegeben (+ 9,4% gegenüber
2006); dies entspricht 4% der gesamten Sozialhilfeausgaben. Im Jahr 2004,
also vor Inkrafttreten des "Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt" (Hartz IV), wurden noch 8,8 Milliarden Euro für diese
Hilfeart ausgegeben. Seit 1. Januar 2005 erhalten bisherige Sozialhilfeempfänger
im engeren Sinne (das heißt Empfänger von laufender Hilfe zum
Lebensunterhalt), die grundsätzlich erwerbsfähig sind, sowie
deren Familienangehörige Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II "Grundsicherung für Arbeitsuchende"). Die Ausgaben für
diesen Personenkreis werden seit 2005 nicht mehr in der Sozialhilfestatistik
nachgewiesen.
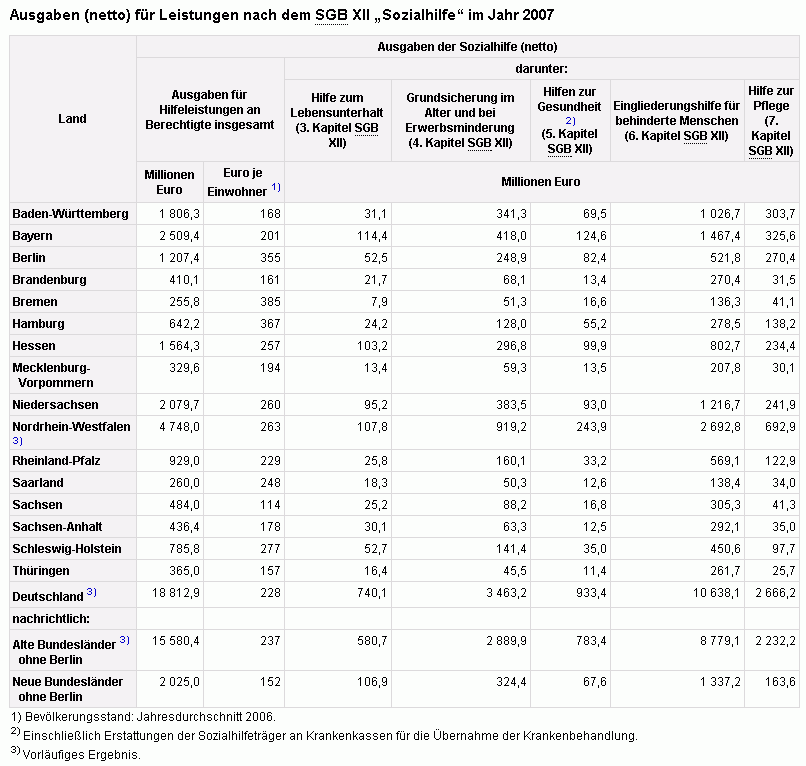
"
Sozialhilfe
2006: 1,1 Mill. Menschen erhielten besondere Leistungen
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 462 vom 16. November
2007
"WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, erhielten in
Deutschland im Laufe des Jahres 2006 rund 1,1 Millionen Personen Leistungen
nach dem 5. bis 9. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB
XII "Sozialhilfe"). Diese Leistungen waren bis Ende 2004 unter dem Oberbegriff
"Hilfe in besonderen Lebenslagen" bekannt.
Die mit Abstand wichtigste Hilfeart ist dabei die
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit 643 000 Empfängern
im Laufe des Jahres 2006. Ferner ist die Hilfe zur Pflege von erheblicher
Bedeutung: So erhielten im Laufe des Jahres 2006 rund 366 000 Personen
diese Hilfeleistung. Insgesamt gab die öffentliche Hand im Jahr 2006
netto rund 14,4 Milliarden Euro für die Leistungen nach dem 5. bis
9. Kapitel des SGB XII "Sozialhilfe" aus; dies entspricht einem Anteil
von 79% an den gesamten Nettoaufwendungen der Sozialhilfe (18,1 Milliarden
Euro).
Die im 6. Kapitel des SGB XII "Sozialhilfe" geregelte
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hat die Aufgabe, eine
drohende Behinderung zu verhüten, eine vorhandene Behinderung oder
deren Folgen zu beseitigen beziehungsweise zu mildern und die Menschen
mit Behinderungen in die Gesellschaft einzugliedern. Leistungsberechtigt
sind alle Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig
oder seelisch wesentlich behindert oder von einer Behinderung bedroht sind,
so weit die Hilfe nicht von einem vorrangig verpflichteten Leistungsträger
- wie zum Beispiel der Krankenversicherung, der Rentenversicherung oder
der Agentur für Arbeit - erbracht wird.
Im Laufe des Jahres 2006 erhielten 643 000 Personen
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. 60% dieser Empfänger
waren männlich, 40% weiblich. Der Anteil der deutschen Hilfeempfänger
betrug 96%. Die Empfänger von Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen waren im Durchschnitt 32 Jahre alt (Männer: 31 Jahre, Frauen:
34 Jahre).
Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
wurde 2006 an gut zwei Drittel der Leistungsberechtigten (69%) in voll-
beziehungsweise teilstationären Einrichtungen gewährt. Gut ein
Drittel der Empfänger (36%) erhielt Eingliederungshilfe außerhalb
von Einrichtungen. Bei rund 6% der Personen, die im Laufe des Jahres 2006
Eingliederungshilfe bezogen, erfolgte die Leistungsgewährung sowohl
in als auch außerhalb von Einrichtungen.
Insgesamt gaben die Träger der Sozialhilfe
im Jahr 2006 netto, das heißt nach Abzug insbesondere von Erstattungen
anderer Sozialleistungsträger, 10,5 Milliarden Euro für die Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen aus. Mit einem Anteil von 58% an den gesamten
Nettoaufwendungen der Sozialhilfe ist die Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen damit die finanziell mit Abstand bedeutendste Hilfeart
im Rahmen der Sozialhilfe.
Die Sozialhilfe unterstützt mit der Hilfe zur
Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII auch pflegebedürftige Personen.
Die Hilfe zur Pflege wird bedürftigen Personen gewährt, die in
Folge von Krankheit oder Behinderung bei den gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf fremde
Hilfe angewiesen sind. Sie wird jedoch nur geleistet, wenn der Pflegebedürftige
die Pflegeleistungen finanziell weder selbst tragen kann noch sie von anderen
- zum Beispiel der Pflegeversicherung - erhält. Bis zum Inkrafttreten
des Pflegeversicherungsgesetzes zum1. Januar 1995 und den daraus resultierenden
Leistungen seit April 1995 (häusliche Pflege) beziehungsweise seit
Juli 1996 (stationäre Pflege) war die Hilfe zur Pflege im Rahmen der
Sozialhilfe das wichtigste Instrument zur materiellen Absicherung bei Pflegebedürftigkeit.
Im Laufe des Jahres 2006 erhielten rund 366 000
Personen Hilfe zur Pflege. Gut drei Viertel (76%) dieser Personen befanden
sich 2006 zumindest vorübergehend in stationärer Pflege. In knapp
einem Viertel der Fälle (24%) wurde die Hilfe zur Pflege außerhalb
von Einrichtungen gewährt. Bei den Empfängern von Hilfe zur Pflege
überwogen die Frauen mit einem Anteil von 69% deutlich. Der Anteil
der deutschen Hilfeempfänger betrug 94%. Die Empfänger von Hilfe
zur Pflege waren im Durchschnitt 75 Jahre alt (Männer: 66 Jahre, Frauen:
80 Jahre). Für die Hilfe zur Pflege gaben die Sozialhilfeträger
im Jahr 2006 netto insgesamt 2,5 Milliarden Euro aus.
Darüber hinaus gab es im Laufe des Jahres 2006
rund 78 000 Empfänger von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) beziehungsweise von Hilfen in anderen
Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII), für die netto zusammen 0,4 Milliarden
Euro aufgewandt wurden. Ferner gab es rund 62 000 Empfänger von unmittelbar
vom Sozialamt gewährten Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel
SGB XII. Hilfe zur Gesundheit wird Personen gewährt, die ansonsten
keinen ausreichenden Krankenversicherungsschutz - zum Beispiel aufgrund
einer Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung - genießen.
Neben den unmittelbar vom Sozialamt gewährten Hilfen zur Gesundheit
wurden in der amtlichen Sozialhilfestatistik noch nachrichtlich 130 000
nicht gesetzlich krankenversicherte Personen erfasst, deren Behandlungskosten
im Bedarfsfall zunächst über die Krankenkassen abgewickelt und
später den Krankenkassen durch die Sozialhilfeträger erstattet
werden. Für die Hilfen zur Gesundheit (einschließlich der Erstattungen
an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung) wurden
2006 insgesamt 0,9 Milliarden Euro aufgewendet.
Eine methodische Kurzbeschreibung
und weitere Informationen zum Thema bietet die Online-Fassung dieser Pressemitteilung
unter ww.destatis.de."
Rund 306 000 Personen erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 377 vom 18. September 2007
"WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, erhielten am Jahresende 2006 in Deutschland insgesamt rund 306 000 Personen laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII "Sozialhilfe"). Davon bezogen 82 000 Personen (27% der Empfänger) laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (bis Ende 2004 so genannte "Sozialhilfe im engeren Sinne"); dies entspricht einem Anstieg von 1,2% gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil dieser Hilfebezieher an der Bevölkerung lag - wie im Vorjahr - bei 0,1%.
Die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII "Sozialhilfe" soll den Grundbedarf vor allem an Nahrung, Kleidung, Unterkunft und Heizung decken ("soziokulturelles Existenzminimum"). Infolge des zum 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ("Hartz IV") ging die Zahl der Hilfebezieher drastisch zurück. Ende 2004, also unmittelbar vor Inkrafttreten von "Hartz IV", hatten noch rund 2,9 Millionen Personen oder 3,5% der Bevölkerung Sozialhilfe im engeren Sinne bezogen. Seit 2005 erhalten bisherige Sozialhilfeempfänger im engeren Sinne, die grundsätzlich erwerbsfähig sind, sowie deren Familienangehörige Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) "Grundsicherung für Arbeitsuchende". Dieser Personenkreis wird ab 2005 nicht mehr in der Sozialhilfestatistik nachgewiesen. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen erhalten seit Anfang 2005 somit zum Beispiel nur noch vorübergehend Erwerbsunfähige, längerfristig Erkrankte oder Vorruhestandsrentner mit niedriger Rente.
Zur Struktur der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am Jahresende 2006 ist Folgendes festzustellen: Rund 70 000 oder 86% der Hilfebezieher waren Deutsche, 12 000 oder 14% ausländische Mitbürger. Die Empfängerquote der Ausländer (1,6 Hilfebezieher je 1 000 Einwohner) lag höher als die der Deutschen (0,9 Hilfebezieher je 1 000 Einwohner). Etwas mehr als die Hälfte der Leistungsempfänger (50,4%) war männlich. Rund 19% der Empfänger waren Kinder unter 18 Jahren.
Die höchste Empfängerdichte gab es Ende 2006 in den Stadtstaaten Bremen (2,3 Empfänger je 1 000 Einwohner) und Berlin (2,1 je 1 000 Einwohner). Unter den Flächenländern wiesen Schleswig-Holstein (1,7 je 1 000 Einwohner) und Hessen (1,5 je 1 000 Einwohner) die höchsten Quoten auf. Die niedrigsten Quoten verzeichneten Baden-Württemberg (0,5 je 1 000 Einwohner) sowie Thüringen und Bayern (jeweils 0,6 je 1 000 Einwohner).
Die rund 82 000 Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen lebten in 73 000 Haushalten; knapp drei Viertel davon (74%) waren Einpersonenhaushalte.
Neben den Beziehern außerhalb von Einrichtungen gab es am Jahresende 2006 noch rund 224 000 Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt in einer Einrichtung (zum Beispiel Wohn- oder Pflegeheime) erhielten (73% der Empfänger). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 16,7%; die hohe Steigerung ist jedoch zumindest teilweise auf Untererfassungen im Berichtsjahr 2005 zurückzuführen. Der Ausländeranteil lag bei den Hilfeempfängern in Einrichtungen bei lediglich 3%. In Einrichtungen überwogen die Frauen mit 52%.
Gegenüber dem Stand Ende 2004 hat sich die Zahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen aufgrund gesetzlicher Änderungen mehr als verzehnfacht. Bis Ende 2004 wurden nämlich auch die Kosten des reinen Lebensunterhalts in einer Einrichtung (Unterkunft, Verpflegung, etc.) im Rahmen der stationären Leistung oder Maßnahme (zum Beispiel Eingliederungshilfe für behinderte Menschen oder Hilfe zur Pflege) als Bedarf anerkannt. Seit 2005 werden der Lebensunterhalt und die Maßnahmen für diesen Personenkreis jeweils als separate Leistungen bewilligt. Dadurch werden behinderte und pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen nun auch in der Statistik über die Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt erfasst, sofern sie diesen Bedarf nicht zum Beispiel durch Renteneinkünfte, durch Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder in anderer Weise decken können.
Nach vorläufigen Angaben wandten die Kommunen und die überörtlichen Sozialhilfeträger für die Hilfe zum Lebensunterhalt im Jahr 2006 netto, das heißt nach Abzug insbesondere von Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, 682 Millionen Euro auf; dies entspricht einer Steigerung von 10,8% gegenüber dem Vorjahr. Rund 420 Millionen Euro (62% der Ausgaben für diese Hilfeart) wurden dabei für Leistungen in Einrichtungen aufgewandt, die Ausgaben für Leistungen außerhalb von Einrichtungen beliefen sich auf 262 Millionen Euro (38% der Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt). Im Jahr 2004 wurden noch 8,8 Milliarden Euro für die Hilfe zum Lebensunterhalt ausgegeben. Der deutliche Ausgabenrückgang bei dieser Hilfeart ist - wie oben bereits dargestellt - auf die Einführung des SGB II zum 1. Januar 2005 zurückzuführen. Rein rechnerisch wurden im gesamten Jahr 2006 pro Einwohner rund 8 Euro für die Hilfe zum Lebensunterhalt ausgegeben.
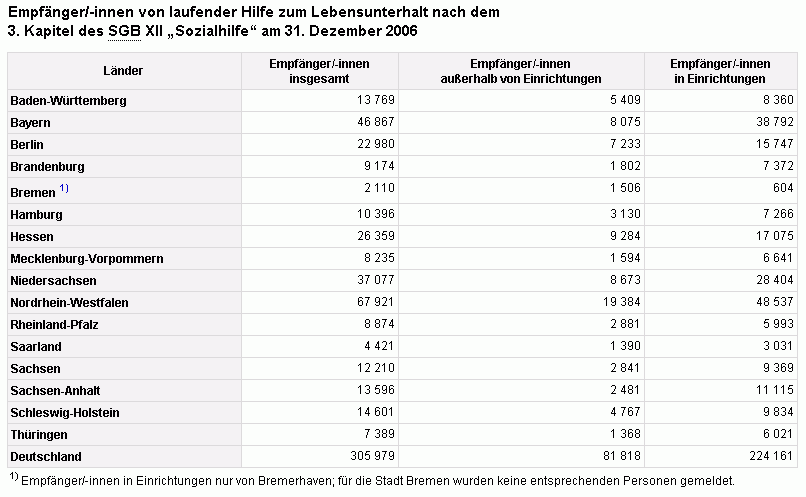
Eine methodische Kurzbeschreibung und weitere Daten
und Informationen zum Thema bietet die Online-Fassung dieser Pressemitteilung
unter www.destatis.de."
Methodische Kurzbeschreibung Sozialhilfestatistik: [nach destatis Heruntergeladen am 18.9.7]
Was beschreibt die Sozialhilfestatistik?
Die Sozialhilfe schützt als letztes "Auffangnetz" vor Armut, sozialer
Ausgrenzung und besonderer Belastung und soll den Leistungsberechtigten
die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen. Die
Sozialhilfe ist im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) geregelt.
Sie erbringt Leistungen für diejenigen Personen und Haushalte, die
ihren Bedarf nicht aus eigener Kraft decken können und auch keine
(ausreichenden) Ansprüche aus vorgelagerten Versicherungs- und Versorgungssystemen
haben. Auch die zum 1. Januar 2005 eingeführte „Grundsicherung für
Arbeitsuchende“ nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) ist ein
solches vorgelagertes System und gehört somit nicht zur Sozialhilfe
(die Statistiken über die Empfänger dieser Leistungen und die
damit verbundenen Ausgaben werden von der Bundesagentur für Arbeit
durchgeführt).
In der amtlichen Sozialhilfestatistik werden verschiedene Erhebungen als Bundesstatistiken durchgeführt. Sie liefern Ergebnisse über die Zahl und Struktur der Sozialhilfeempfänger/-innen sowie über die mit den Hilfeleistungen nach dem SGB XII verbundenen finanziellen Aufwendungen. Damit erhalten Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit detaillierten Einblick in die staatliche Sozialhilfegewährung und somit wichtige Datengrundlagen für weitere Planungen, Entscheidungen und die Fortentwicklung der Sozialgesetzgebung.
Das mit Inkrafttreten des SGB XII „Sozialhilfe“ zum 1. Januar 2005 letztmals
grundlegend reformierte Berichtssystem der Sozialhilfestatistik gliedert
sich seitdem in die folgenden wichtigsten Teilerhebungen, die sich jeweils
durch unterschiedliche Erhebungsverfahren, Berichtszeiten und Inhalte unterscheiden:
- Statistik der Empfänger/-innen
- von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
- von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB X
- von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII (unter anderem Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit; bis Ende 2004 wurden diese Leistungen als „Hilfen in besonderen Lebenslagen“ bezeichnet)
- Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe.
Wie werden die Sozialhilfestatistiken erhoben?
Die Sozialhilfestatistiken sind dezentrale Statistiken, das heißt
das Statistische Bundesamt bereitet Organisation und Technik vor, die Statistischen
Ämter der Länder führen die Befragungen durch und bereiten
die erhobenen Daten zu statistischen Ergebnissen auf. Es handelt sich bei
den Sozialhilfestatistiken um sogenannte Sekundärstatistiken, bei
denen bereits vorliegende Daten aus dem Verwaltungsvollzug statistisch
aufbereitet werden.
Rechtsgrundlage der Sozialhilfestatistiken sind die §§ 121-129
des SGB XII „Sozialhilfe“. Für sämtliche Erhebungen besteht gemäß
§ 125 SGB XII eine Auskunftspflicht durch die örtlichen Träger
(Sozialämter der kreisfreien Städte beziehungsweise Landkreise)
oder die überörtlichen Träger (Länder selbst oder höhere
Kommunalbehörden, wie zum Beispiel Landeswohlfahrtsverbände,
Landschaftsverbände oder Bezirke) der Sozialhilfe.
Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (3.
Kapitel SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII „Sozialhilfe“ erhalten seit
Inkrafttreten des „Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt“ (Hartz IV) zum 1. Januar 2005 lediglich noch nicht erwerbsfähige
Hilfebedürftige, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln
(zum Beispiel Vermögen) oder durch Leistungen anderer Sozialleistungsträger
decken können. Dazu gehören zum Beispiel vorübergehend Erwerbsunfähige,
längerfristig Erkrankte oder Vorruhestandsrentner mit niedriger Rente.
Hilfebedürftige Personen, die grundsätzlich erwerbsfähig
sind, sowie deren Familienangehörige erhalten jetzt Leistungen der
„Grundsicherung für Arbeitsuchende“ nach dem SGB II.
Der notwendige Lebensunterhalt der Leistungsberechtigten umfasst nach § 27 SGB XII "insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens". Zu letzteren gehören "in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben (soziokultureller Mindeststandard)“.
Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine individuelle Hilfe, die für jeden Einzelfall (neu) zu berechnen ist. Die Hilfe wird immer für eine Bedarfsgemeinschaft – auch „Personen- beziehungsweise Einstandsgemeinschaft“ genannt – gewährt. Dementsprechend werden Haushalte von zusammen wohnenden Partnern sowie im Haushalt lebende (hilfebedürftige) minderjährige Kinder als eine Bedarfsgemeinschaft betrachtet. Allein stehende Hilfeempfänger bilden eine eigene Bedarfsgemeinschaft.
Die Hilfe zum Lebensunterhalt kann auch Personen gewährt werden, die in einer Einrichtung (zum Beispiel Wohn- oder Pflegeheim) leben. Bis Ende 2004 wurde den bedürftigen Personen in Einrichtungen der Lebensunterhalt als Bestandteil der stationären Leistung oder Maßnahme (zum Beispiel Eingliederungshilfe für behinderte Menschen oder Hilfe zur Pflege) gewährt. Ab 2005 werden der Lebensunterhalt und die Maßnahmen für diesen Personenkreis jeweils als separate Leistungen erbracht (einschlägig ist in diesem Zusammenhang insbesondere § 35 SGB XII). Dadurch werden die Leistungsberechtigten in Einrichtungen nunmehr auch in der Statistik über die Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt erfasst.
Die Erhebung über die Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt wird als Bestandserhebung jährlich zum 31. Dezember durchgeführt. Der Katalog der erfassten Merkmale ist breit: Neben klassischen personenbezogenen oder soziodemographischen Grunddaten (Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund etc.) werden auch detaillierte Angaben über die Art, Höhe und Dauer des Leistungsbezugs erhoben. Ferner liefert die Statistik Angaben zur Einkommenssituation.
Darüber hinaus werden im Rahmen einer Zu- und Abgangsstatistik Angaben bei Beginn und Ende der Leistungsgewährung sowie bei Änderung der Zusammensetzung des Haushalts erfasst. Mit Hilfe dieser Zu- und Abgangsstatistik sind insbesondere Aussagen zur Dynamik innerhalb der Hilfe zum Lebensunterhalt, zu den endgültigen Bezugsdauern sowie über die Gründe für das Ende der Hilfegewährung möglich.
Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(4. Kapitel SGB XII)
Nach dem 4. Kapitel des SGB XII haben Personen ab 65 Jahren sowie dauerhaft
voll erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahren mit gewöhnlichem Aufenthalt
in der Bundesrepublik Deutschland – sofern Sie bedürftig sind – einen
Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung. Die Leistungen werden in gleicher
Höhe bemessen wie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb
von Einrichtungen (3. Kapitel SGB XII). Die Leistungen werden nur auf Antrag
gewährt und jeweils für ein Jahr bewilligt. Einkommen, wie zum
Beispiel Rentenbezüge oder Vermögen des Leistungsberechtigten,
des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners sowie des Partners
einer eheähnlichen Gemeinschaft, werden wie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt
angerechnet. Jedoch wird gegenüber unterhaltsverpflichteten Kindern
oder Eltern mit einem Jahreseinkommen unterhalb von 100 000 Euro kein Unterhaltsrückgriff
vorgenommen. Insofern sollen die Leistungen der Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung auch dazu beitragen, die sogenannte "verschämte
Armut" einzugrenzen. Vor allem ältere Menschen machten bestehende
Sozialhilfeansprüche in der Vergangenheit oftmals nicht geltend, weil
sie den Rückgriff auf ihre unterhaltspflichtigen Kinder fürchteten.
Die Erhebung über die Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird jährlich zum 31. Dezember als Bestandserhebung durchgeführt. Der Katalog der erfassten Merkmale entspricht im Wesentlichen dem der Statistik über die Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt.
Empfänger/-innen von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB
XII
In den Kapiteln 5 bis 9 des SGB XII werden folgende Leistungen unterschieden,
die bis Ende 2004 unter dem Oberbegriff „Hilfe in besonderen Lebenslagen“
bekannt waren:
- 5. Kapitel SGB XII: Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52),
- 6. Kapitel SGB XII: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60),
- 7. Kapitel SGB XII: Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66),
- 8. Kapitel SGB XII: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69),
- 9. Kapitel SGB XII: Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74).
In dieser Statistik werden Daten über Hilfeempfänger erfasst,
die irgendwann im Laufe des jeweiligen Berichtsjahres mindestens eine der
Hilfen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII erhalten haben. Neben diesen
kumulierten Zahlen liegen Angaben zum Stichtag 31.12. jeden Jahres für
Leistungen vor, die am Jahresende noch andauerten.
Detaillierte Angaben werden dabei insbesondere über die Empfänger/-innen von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie über die Empfänger/-innen von Hilfe zur Pflege erhoben. Zum einen erfolgt für diese besonders bedeutsamen Hilfearten eine differenzierte Erfassung der verschiedenen Unterhilfearten sowie eine Differenzierung nach ambulanter, teilstationärer und stationärer Hilfe. Zum anderen werden auch Angaben zu den Ausgaben je Fall sowie zum Beginn und Ende der Hilfegewährung erhoben.
Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe
In dieser Statistik werden die jährlichen Ausgaben und Einnahmen
der Sozialhilfe für das jeweils abgelaufene Kalenderjahr erhoben.
Damit sollen umfassende und zuverlässige Daten über die finanziellen
und sozialen Auswirkungen des SGB XII bereitgestellt werden. In der jährlichen
Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfeträger werden
erfasst:
- die Ausgaben (differenziert nach einzelnen Hilfe- beziehungsweise Unterhilfearten) für Leistungen nach dem SGB XII; sie umfassen sowohl die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung als auch die Hilfen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII,
- die Einnahmen von Geldern durch die Sozialhilfeträger; insbesondere handelt es sich hierbei um finanzielle Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (zum Beispiel gesetzliche Kranken-, Renten-, Pflege- oder Arbeitslosenversicherung) sowie um übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete.
Durch Gegenüberstellung von Bruttoausgaben und Einnahmen der
Sozialhilfe können die „reinen Ausgaben“ oder Nettoausgaben differenziert
nach Hilfearten dargestellt werden. Insgesamt entsprechen die Hilfearten
der Aufwandsstatistik denjenigen, die auch in der Empfängerstatistik
erfasst werden. Dadurch ist eine enge Verzahnung beider Erhebungsteile
sichergestellt.
Wann werden die Sozialhilfestatistiken veröffentlicht?
Die Statistiken werden üblicherweise rund neun bis zwölf
Monate nach der Erhebung zunächst in einer Pressemitteilung veröffentlicht.
Anschließend erfolgt die differenzierte Darstellung in weiteren Publikationen
(Fachserien/Themenpapiere/Beiträge in „Wirtschaft und Statistik“ etc.).
Sämtliche Publikationen sind im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes (in der Regel kostenlos) abrufbar. Neben Bundesergebnissen
sind auch vielfältige Ergebnisse für die Bundesländer beziehungsweise
noch tiefer auf Kreisebene verfügbar, die in der Regel von den jeweiligen
Statistischen Ämtern der Länder veröffentlicht werden.
Wie genau ist die Sozialhilfestatistik?
Die Statistiken zur Sozialhilfe werden jeweils als Vollerhebungen durchgeführt,
das heißt sämtliche örtliche und überörtliche
Träger der Sozialhilfe sind gegenüber der amtlichen Statistik
auskunftspflichtig. Zudem finden regelmäßig umfangreiche Plausibilitätsprüfungen
und eine durchgehende Qualitätskontrolle statt. Insofern sind die
Ergebnisse von hoher Aussagekraft und Qualität. An den Stellen, an
denen ausnahmsweise nur eingeschränkte Aussagen möglich sind,
ist dies jeweils kenntlich gemacht."
Ausgaben Statistik Sozialhilfe 2003 - 2006 [Quelle destatis Version: 2.23.0 / 14.05.2007]
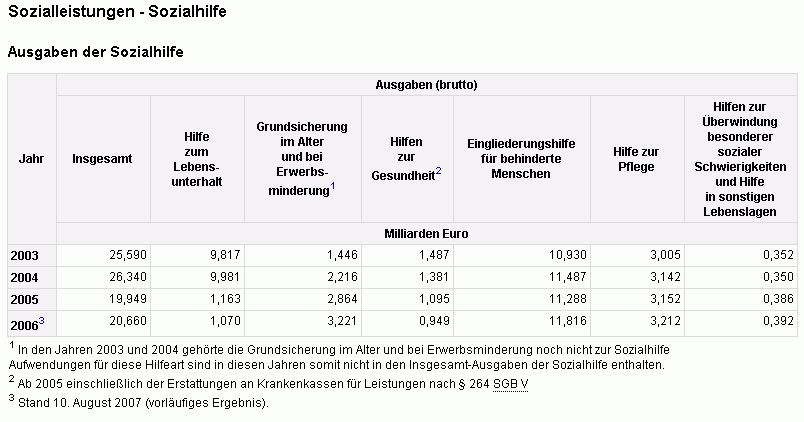
Einnahmen und Ausgaben Sozialhilfestatistik 2003-2006 [nach destatis Version: 2.23.0 / 14.05.2007]
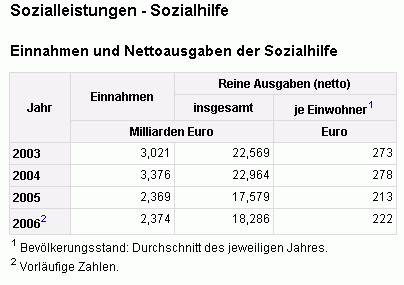
Sozialleistungen - Sozialhilfe in Deutschland 2003-2005 [nach destatis Version: 2.23.0 / 14.05.2007]
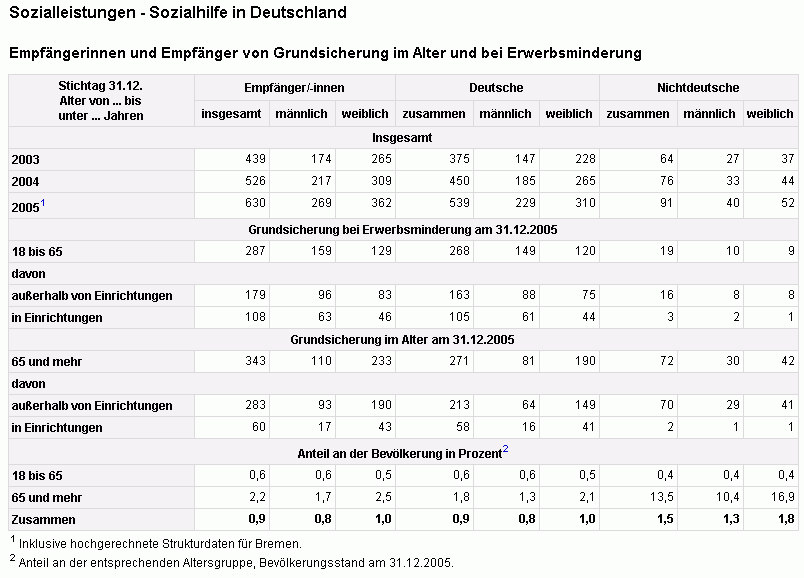
Wohngeld
2006: Rund 15% weniger Empfängerhaushalte
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr.
443 vom 7. November 2007
"WIESBADEN - Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, erhielten am
Jahresende 2006 in Deutschland rund 666 000 Haushalte Wohngeld; gegenüber
dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang um 14,7%. Somit bezogen
Ende 2006 noch 1,7% aller privaten Haushalte Wohngeld (Vorjahr: 2,0%).
Wohngeld ist ein von Bund und Ländern je zur Hälfte getragener
Zuschuss zu den Wohnkosten. Dieser wird - gemäß den Vorschriften
des Wohngeldgesetzes - einkommensschwächeren Haushalten gewährt,
damit diese die Wohnkosten für angemessenen und familiengerechten
Wohnraum tragen können.
Seit Inkrafttreten des Vierten Gesetzes für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ("Hartz IV") und den damit verbundenen
Änderungen wohngeldrechtlicher Bestimmungen zum 1. Januar 2005 entfällt
für Empfänger staatlicher Transferleistungen (zum Beispiel Arbeitslosengeld
II, Sozialgeld, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung, Asylbewerberleistungen) sowie Mitglieder ihrer Bedarfsgemeinschaft
das Wohngeld. Die angemessenen Unterkunftskosten der Empfänger dieser
Transferleistungen werden seitdem im Rahmen der jeweiligen Sozialleistungen
berücksichtigt, so dass sich für die einzelnen Leistungsberechtigten
keine Nachteile ergeben. Ende 2004, also unmittelbar vor Inkrafttreten
von "Hartz IV", bezogen noch 3,5 Millionen Haushalte Wohngeld.
Mieter erhalten das Wohngeld als Mietzuschuss, selbst
nutzende Eigentümer erhalten Lastenzuschuss, das heißt einen
Zuschuss zu den Aufwendungen für Kapitaldienst und Bewirtschaftung
ihres Eigentums.
89% der Empfängerhaushalte erhielten 2006 ihr
Wohngeld als Mietzuschuss, die restlichen 11% als Lastenzuschuss. Der durchschnittliche
monatliche Wohngeldanspruch lag 2006 bei 91 Euro: Den Empfängerhaushalten
von Mietzuschuss wurden durchschnittlich 87 Euro im Monat an Wohngeld ausgezahlt,
den Empfängerhaushalten von Lastenzuschuss durchschnittlich 119 Euro.
Die monatliche Bruttokaltmiete der Mietzuschussempfänger betrug Ende
2006 durchschnittlich 5,90 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, die monatliche
Belastung der Lastenzuschussempfänger lag mit durchschnittlich 4,32
Euro je Quadratmeter Wohnfläche niedriger.
Gut die Hälfte aller Wohngeldempfänger
lebte allein (52%), weitere 15% lebten in Zwei-Personen-Haushalten und
9% in Drei-Personen-Haushalten. In den übrigen 24% der Empfängerhaushalte
wohnten vier oder mehr Personen.
Bei der Wohngeldbezugsquote ist ein Ost-West-Gefälle
zu erkennen. Während - gemessen an der Gesamtzahl der privaten Haushalte
- im früheren Bundesgebiet (mit Berlin) 1,5% der privaten Haushalte
zum Jahresende 2006 Wohngeld bezogen, waren es in den neuen Ländern
(ohne
Berlin) 2,8%. Im Ländervergleich wiesen Mecklenburg-Vorpommern
(3,7%) sowie Sachsen (3,2%) die höchsten Wohngeld-Bezugsquoten auf.
Die niedrigsten Bezugsquoten wurden im Saarland (1,0%) sowie in Bayern
und Hessen (je 1,1%) ermittelt.
Neben den rund 666 000 "reinen" Wohngeldhaushalten
gab es Ende 2006 in Deutschland noch rund 25 000 wohngeldrechtliche Teilhaushalte
in so genannten "Mischhaushalten"; dies entspricht einem Rückgang
um 16,5% gegenüber dem Vorjahr. Dabei handelt es sich um Haushalte,
in denen Empfänger von staatlichen Transferleistungen, die nicht selbst
wohngeldberechtigt sind, mit Personen zusammen leben, die wohngeldberechtigt
sind.
Die Gesamtausgaben für das Wohngeld betrugen
im Jahr 2006 bundesweit rund 1,16 Milliarden Euro; dies entspricht einem
Rückgang um 5,9% gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2004, dem Jahr
vor der Reform, beliefen sich die Ausgaben für das Wohngeld noch auf
5,18 Milliarden Euro.
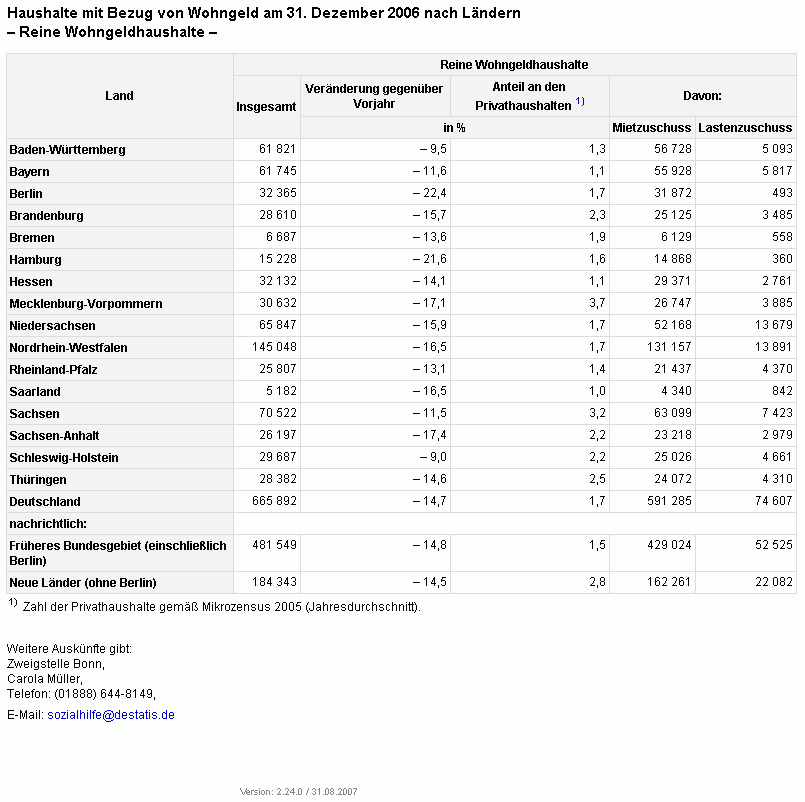
"
Literatur (Auswahl)
Links (Auswahl: beachte)
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT = General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
Standort: Wirtschaftsstatistik Sozialhilfe 07/08.
* Überblick Wirtschaftsstatistiken * Überblick Statistik * Beweisen in Statistik *
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Gelderwerb Geld site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Psychologie und Psychopathologie des Geldes, 2*Privatverschuldung*Schuldenstatistik*Geldtabu und Geldgeheimnisse*
Querverweis: Macht Geld glücklich? - Die Sicht eines Börsenmaklers.
Arbeitslosen-Typologie aus integrativer Sicht.
Psychologische Materialien zur Arbeitsmotivation 1. Möglichkeiten zum Aufbau einer positiven Arbeits-Einstellung.
*Überblick Staatsverschuldung*
Sinnfragen: Lebenssinn 1 *Lebenssinn 2 (mit 100 Jahre Leben Meditation).
Überblick Programm Politische Psychologie in der IP-GIPT.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Wirtschaftsstatistik Sozialhilfe 07/08. Abteilung Wirtschaft und Soziales. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/wirtsch/WStat/Sozial/wsSoHi78.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen, die die Urheberschaft der IP-GIPT nicht jederzeit klar erkennen lassen, ist nicht gestattet. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert:
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik sind willkommen
27.10.16 2015.
05.02.12 2010: Sozialhilfeausgaben in 2010 um 3,9 % gestiegen.
29.11.11 2010: Quote der Empfänger sozialer Mindestsicherung sinkt auf 9,2 %
11.11.00 2007: 312 000 Personen erhielten Ende 2007 Hilfe zum Lebensunterhalt
11.08.08 Sozialhilfe 2007 (Netto) .