(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=30.03.2009 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 03.04.15
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail: sekretariat@sgipt.org___ Zitierung & Copyright_
Willkommen in unserer Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Kunst, Ästhetik, Psychologie der Kunst, Bereich Theater, und hier speziell zum Thema:
Kasimir und Karoline
Ödön von Horváth (1932)
Selbst echte Liebe genügte nicht, es muss schon auch passen.

Katherina Sattler, Lisa Marie Janke,
Andreas Petri, Martin Molitor, Stefan Gad, Winfried Wittkopp, Mirjam Luttenberger,
Josephine Mayer, Claudia Wiedemer, Daniel Wagner © Mario Heinritz
* Rechts: Daniel Wagner, Claudia Wiedemer © Mario Heinritz
Mit Eindrücken
zur Inszenierung im Markgrafentheater, Aufführung vom 29.3.2009, 18.00-19.45
von Rudolf Sponsel, Erlangen
Kasimir
und Karoline im Rahmen der "Traumfahrer"-Deutung.
Überblick: TheaterInfo * Hintergrund * PsySoz-Situation * Zentralthema: Prekäre Liebesverhältnisse * Eindrücke Erlanger Inszenierung * Literatur * Links * Werkorientierte Interpretation * Kritiken * Querverweise * Zitierung * Änderungen *
Theater-Info:
"Mit Stefan Gad, Lisa Marie Janke, Mirjam Luttenberger, Josephine Mayer, Martin Molitor, Andreas Petri, Katherina Sattler, Daniel Wagner, Claudia Wiedemer, Winfried Wittkopp. Regie Marc Pommerening. Regiemitarbeit Frank de Buhr. Bühne Nikolaus Granbacher. Kostüme Birgit Stoessel. Premiere: 12.03.2009. Markgrafentheater
Das Oktoberfest brummt, dass der Berch brüllt! Der gerade arbeitslos gewordene Chauffeur Kasimir bekommt bei dem Rummel wegen nichts Krach mit seiner Freundin Karoline. Wegen nichts? Nun, einen Grund muss es ja geben. Vielleicht sind die Liebenden wirklich, wie Karoline argwöhnt, „zu schwer füreinander“? Oder vielleicht ist auch Kasimirs Arbeitslosigkeit Schuld? Immerhin stellt der Festbesucher Schürzinger fest: „Nehmen wir an, Sie lieben einen Mann. Und nehmen wir weiter an, dieser Mann wird arbeitslos. Dann lässt die Liebe nach, und zwar automatisch.“
Das Stück wurde vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise von 1929 konzipiert. Es erhält gespenstische Relevanz angesichts eines global und rücksichtslos agierenden Kapitalismus, ohne als platte Sozialkritik zu verpuffen. Horváths Klassikers nimmt sich Regisseur Marc Pommerening an, der sich in den letzten Jahren als Experte für Sprachmagie am theater erlangen einen Namen gemacht hat." Dauer 110 min, keine Pause.
Zum brandaktuellen historischen Hintergrund des Stückes
Aus dem Programmheft.
Zur psychologisch-soziologischen Situation der Menschen in Horváths Stück

Aus dem Programmheft.
Prekäre Liebesverhältnisse: Arbeitslosigkeit, Geldmangel, Hartz IV, Misserfolg und Liebe
"Nehmen wir an, Sie lieben einen Mann. Und nehmen
wir weiter an, dieser Mann wird nun arbeitslos. Dann läßt die
Liebe nach, und zwar automatisch." (Schürzinger)
"Und dennoch hab ich harter Mann die Liebe schon
gespürt – und die ist ein Himmelslicht und macht deine Hütte
zu einem Goldpalast – und sie höret nimmer auf, solang du nämlich
nicht arbeitslos wirst." (Kasimir)
Eine eigentliche Gretchenfrage des Stückes gibt es gar nicht, weil Horváths traurige Simmel-Botschaft (> Schlussgedicht) lautet: "Liebe ist nur ein Wort" und zerbricht ganz leicht an den - prekären - Verhältnissen. Das ist aber nur die vordergründige und augenscheinliche Botschaft. Denn die prekären Verhältnisse sind nicht die primäre Ursache, sondern die prekären Beziehungen, die unter prekären Verhältnissen manifest brüchig werden (können). Dies zeigt auch die brillante Analyse im Programmheft zur psychologisch-soziologischen Situation der Menschen, um die es hier geht; nämlich dass die wahren Gründe viel tiefer, nämlich in den gestörten zwischenmenschlichen Beziehungen liegen, die eine entsprechend gestörte Kommunikation sowohl begleiten, ausdrücken, hervorbringen als auch, rückkoppelnd, die gestörten Beziehungen noch gestörter werden lassen - bis sie denn brechen.
Die frische Arbeitslosigkeit Kasimirs ist nicht
der Grund, allenfalls der Auslöser für
die in der Tiefe schwelenden Konflikte. Der Anlass - nicht
der Grund - für den Ausbruch der tieferen Konflikte sind die unterschiedlichen
Erwartungen und Wünsche ans Oktoberfest, Kasimir hat verständlicherweise
keine Lust zum Feiern und auch kaum Geld übrig für den doch nicht
ganz billigen Spaß, Karoline will sich amüsieren und bemerkt
unter diesen Umständen verstärkt, wie wichtig ihr doch wohlhabende
und materiell sichere Verhältnisse - inzwischen? - sind (zwei Beamte
hatte sie früher schon ausgeschlagen). Kasimir ist ihr, von dem, was
er ihr finanziell und vom Status her bieten kann, nicht genug.
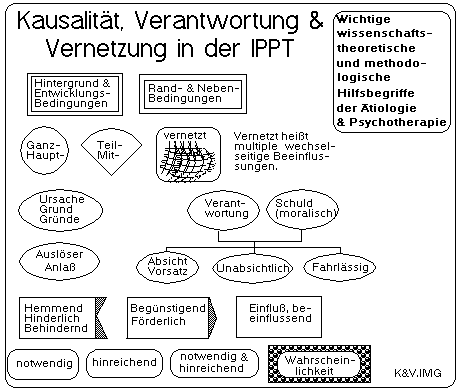 |
Exkurs: Kausalitätsmodell am Beispiel Geburtstagsgratulation: Die Freundschaft ist der Grund, dass ich meinem Freund zum Geburtstag gratuliere, Anlass ist das Datum und Auslöser das Bemerken. Bedingung ist, dass der gewählte Kommunikati- onsweg, z.B. das Telefon funktioniert. Verantwortlich bin ich für mein Darandenken, und eine Schuld würde ich auf mich laden, wenn ich es ohne besondere Hindernisse einfach vergessen hätte. Und so ist der Grund für das Scheitern der vermeintlichen Liebe auch nicht die Arbeitslosigkeit Kasimirs, sondern die vermutlich nie genügend tragfähig entwickelte Liebe und eine tiefgreifende Beziehungs- und Kommunikationsstörung. Dann erst greifen die widrigen materiellen Bedingungen besonders und es knallt. |
Verallgemeinert kann man die brisante Frage stellen:
wie beeinflusst Misserfolg die Liebe? Macht Misserfolg unattraktiv,
macht er gar hässlich? Können wir Verlierer lieben?
Betrachtet man sich die sog. "Gewinnertypen" - festgemacht
an gesellschaftlichem Status und den Einkünften - dieses Stücks,
so kann einem angesichts der sehr gut gespielten widerlichen Typen des
Unternehmers Rauch (Stefan Gad) und des Landgerichtsdirektors Speer (Winfried
Wittkopp) nur schlecht werden.
Querverweise: IP-GIPT Materialien zur Liebe:
- Liebes- und Partnerschaftskonzept (Zwei-Faktoren-Hypothese: Lieben und Passen)
- Materialien.
- Liebestest.
- Liebeskummer.
- Ehemotive.
- Einfühlung und Empathie (Heilmittelmonographie)
- Kommunikationsregeln für Nahestehende.
- Attraktivität.
- Der Beziehungsraum.
- Beziehungstreppe.
Eindrücke von der Aufführung am 29.3.9
Das Stück der Erlanger Inszenierung beginnt mit den Klängen der deutschen Nationalhymne, nicht mit der Münchner Hymne "So lang der alte Peter" und läutet damit eine allgemeinere und politische Brisanz ein. Die Verallgemeinerung durch Abstraktion vom typischen Oktoberfestlichen oder oberflächlich Kirchweihhaften ist sehr gut gelungen. Der tiefgreifende Beziehungskonflikt entzündet und äußert sich da nur.
Das Bühnenbild zeigt im Zentrum ein eindrucksvolles Achterbahnschema (siehe bitte oben Eingangsfotos) flankiert mit Gläsern, der Boden übersät mit Abfall, der ein knautschendes Geräusch von sich gibt, wenn man auf ihn tritt. Die Assoziation Das Leben und die Seele eine Achterbahn drängt sich geradezu auf.
Die Inszenierung enthält sehr desillusionierend-resignative (alles erscheint käuflich, sehr vergänglich, sehr unzuverlässig [treulos], sehr unecht, sehr opportunistisch, sehr materiell orientiert; Machotum und autoritäre Hierarchie), aber auch komische und schrille, überzeichnende Momente, etwa bei den musikalischen Songeinlagen (ins Englische modernisiert), die öfter spontanen Beifall hervorriefen.
Sehr schön umgesetzt sind z.B. auch die Darstellung der Achterbahnfahrt und das Reiten, trefflich auch die aktuellen Bezugnahmen auf Steuerbetrüger, Abwrackprämie und die autosuggestiv hohl-falsche Botschaft "es geht besser, immer besser" Coues ("Die Selbstbemeisterung durch bewusste Autosuggestion"; W) wird durch den heute bekannteren Dale Carnegie ("Sorge dich nicht, lebe!"; W) ersetzt. Schürzinger geht durchs Publikum und animiert alle mitzumachen und mitzurufen: "es geht immer besser" - was tatsächlich auch immer besser geht ;-) indem es viele aus dem Publikum mitrufen. Dieses autosuggestive Gesundbeten steht in scharfem Kontrast zum realen und wahren Scheitern einer Liebe, die wahrscheinlich nie wirklich nachhaltig fundiert war. Man könnte es aber auch positiv sehen: Karoline mit ihren materiellen Bedürfnissen passt in der Tat besser zu Schürzinger und Erna zu Kasimir. Denn: Selbst echte Liebe genügte nicht, es muss schon auch passen.
Es dauert ein wenig, bis die Zuschauer erkennen, dass das Stück mit der paradox-absurd anmutenden Schlusssentenz zu Ende ist - "Kasimir: Träume sind Schäume. Erna: Solange wir uns nicht aufhängen, werden wir nicht verhungern. Stille. Kasimir: Du Erna – Erna: Was? Kasimir: Nichts. Stille" - , vielleicht weil die Kundigen noch auf das tatsächlich entbehrliche Schlußgedicht warten. Dann aber erhalten die Schauspieler und die Inszenierung lang anhaltenden Beifall, teilweise, ca. 5 mal, mit Johlen und Rufen, verstärkt bei Karoline (Claudia Wiedemer), Kasimir (Daniel Wagner), Erna (Lisa Marie Janke) und Schürzinger (Martin Molitor).
Vermutlich ein zeitloses Stück, weniger durch die aktuelle ökonomische Dramatik, wenn auch dadurch verstärkt, als durch das tiefgreifende emotionale Beziehungs- und Kommunikationsproblem von Mann und Frau und dem, was sie für Liebe halten und wie sie sie leben. Eine gutes Thema, eine gelungene Inszenierung.
Literatur (Auswahl)
- Der Text Online im Gutenbergprojekt.
- Theater Erlangen (2009). Programmheft Ödön von Horváth Kasimir und Karoline.
- Krischke, Traugott (1973). Materialien zu Ödön von Horváths "Kasimir und Karoline". Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Kasimir und Karoline. Editionen für den Literaturunterricht

Zu Ödön von Horváth und seinem Werk (Auswahl):
- Bartsch, Kurt (2000). Ödön von Horváth. Stuttgart: Metzler.
- Baumann, Peter (2003). Ödön von Horváth: "Jugend ohne Gott" - Autor mit Gott? Analyse der Religionsthematik anhand ausgewählter Werke. Bern: Lang.
- Hildebrandt, Dieter (1975). Horváth. Reinbek: Rowohlt.
- Horváth, Ödön von (1991). Gesammelte Werke [Herausgegeben und bearbeitet in acht Bänden von Krischke, Traugott]. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Krischke, Traugott (1980). Ödön von Horváth. Kind seiner Zeit. München: Heyne.
- Krischke, Traugott (1981, Hrsg). Ödön von Horváth. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Krischke, Traugott (1988). Horváth-Chronik. Daten zu Leben und Werk. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Mildenberger, Angelika-Ditha (1988). Motivkreise in Ödön von Horváths dramatischem Werk. Zürich: Leu.
- Oellers, Piero (1987). Das Welt- und Menschenbild im Werk Ödön von Horváths. Bern u.a.: Lang.
Links (Auswahl: beachte)
Veränderte URLs ohne Weiterleitung wurden entlinkt.
- Der Text Online im Gutenbergprojekt.
- Kasimir und Karoline im Rahmen der "Traumfahrer"-Deutung.
- Kerber.net Fachbereich Deutsch: Materialien zu Kasimir und Karoline, Literatur.
- Unterrichtsmaterialien zur Theateraufführung in Linz [Doc]
- Eine oktoberfestnahe Variante hat das theater der keller in Köln inszeniert.
- "KASIMIR UND KAROLINE" IN HAMBURG. Schwer in der Krise. Es ist das Stück zur Finanzkrise. Stephan Kimmig verbrutalisierte Horváths "Kasimir und Karoline" am Hamburger Thalia Theater - und bot trotz seines großartigen Ensembles nur Allgemeinplätze über die Folgen des Desasters für den kleinen Mann. ... [Spiegel 2.11.8]
- Fritz Gross zum Stück.
- junges theater göttingen.
- Wikipedia: [Kasimir und Karoline, Ödön von Horváth]
- Literaturhaus Kasimir und Karoline.
Allgemeine
Theater-Links:
Veränderte URLs ohne
Weiterleitung wurden entlinkt.
- Die Deutsche Bühne * Perlentaucher. * Theater Heute * Theater-Index. * Theaterkritik (Kultur Online). * Theaterlexikon: [PDF] * Theater Online , DU, (Links). * Theater-Paradies-Deutschland. * ZDF-Theaterkanal. * SR-Online. * Berliner Schauspielschule Theaterkritiken: Online.* 3sat Theater. * Dramaturgie: [W] * Theaterstück [W.Drama]
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT = General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
Eindrücke. Meine "Eindrücke" von Theateraufführungen sind zwar an manchen Stellen gelegentlich kritisch, sind aber nicht als traditionelle Theaterkritiken misszuverstehen. Hierzu bin ich gar nicht ausgebildet und habe auch zu wenig Theaterkenntnis und -erfahrung. Ich kann also die vielfältige Leistung von Dramaturgie, Regie, Musik, Bühnentechnik und Darstellung, besonders der SchauspielerInnen gar nicht angemessen bewerten. Und deshalb möchte ich mich auch mit Eindrücken begnügen. Ich verlange vom Theater nicht mehr, als dass es Interesse weckt, berührt und zur Auseinandersetzung mit der Aufführung und dem ihm zugrunde liegenden Stück anregt.
___
Kritiken (vom Theater zitierte):
Stern der Woche Abendzeitung Nürnberg! Marc Pommerening und das Ensemble für „Kasimir und Karoline“ im Markgrafentheater Erlangen
Wenn Karoline zum Schluss noch einmal Nicole Kidmans Sehnsuchtslied vom Davonfliegen aus „Moulin Rouge“ anstimmt und dabei verzweifelt versucht, den Schmuckvorhang vor die ganze Angelegenheit zu ziehen, Martin Molitors Schürzinger (zunächst ein tumber Muttersohn und faszinierender Augenspieler) in der Markgrafenloge zum großen Agitator wird, sich sein Weibchen packt wie ein Urmensch und das andere Paar ausdruckslos ins Publikum starrt, gelingt Pommerening ein großes, düsteres Finale.
(Georg Kasch, Abendzeitung Nürnberg)
Regisseur Marc Pommerening hat die gestörten Beziehungsrituale zwischen dem frisch entlassenen Kasimir und seiner am gesellschaftlichen Aufstieg interessierten Karoline, zwischen den wohlhabenden Herren und den verzweifelt perspektivlosen Mädels klug herausgearbeitet. Der Versuchung, das Weltwirtschaftskrisen-Szenario brav zu aktualisieren, setzt er den genauen Blick auf die einzelnen Figuren entgegen. (Katharina Erlenwein, Nürnberger Nachrichten)
___
Schlußgedicht. [Online]
| "117. Szene Erna singt leise – und auch
Kasimir singt allmählich mit: Und blühen einmal die Rosen
Jedes Jahr kommt der Frühling
|
"Nur der Mensch hat alleinig Einen einzigen Mai.", d.h.
jedes Leben hat nach Meinung Horváths nur eine einzige große
Liebe und auch die währt seiner Meinung nach nur sehr kurz. Glücklicherweise
stimmt diese Botschaft nicht. Die Metapher spricht auch nicht die Liebe
an, sondern wahrscheinlich eher die Verliebtheit,
wovon viele möglich sind ... und, wenn man so will: alle Jahre wieder
- bevorzugt in der "Rosenzeit".
Ansonsten enthält das Schlussgedicht auch die These einer klimasensiblen Herbst-Winter-"Depression", wenn der kälteren Jahreszeit das trübe Herz zugeordnet wird. Ein Leben währt derzeit ca. 27-28.000 Tage; jeder ist kostbar, und daher sollte man, nur weil die Klima- und Wetterwünsche nicht stimmen, keinen freiwillig hergeben. Eine gute Entscheidung, auf diese falsche Botschaft Horváths am Ende zu verzichten. |
Werkorientierte Interpretation ist eine natürliche Idee, die sich viele KünstlerInnen auch wünschen, woran sich aber viele InterpretInnen nicht halten. Bei der werkorientierten Interpretation wird bewusst auf Rückgriffe auf andere Werke und die Biographie der KünstlerIn verzichtet.
Jede Kritik ist eine Bewertung und verlangt daher, streng betrachtet, ein Bewertungsverfahren, das im allgemeinen aber unbekannt ist. So haftet der Kritik nicht selten etwas Willkürlich-Zufälliges und Subjektiv-Persönliches an. Daher besteht seit jeher ein spannungsvolles Verhältnis zwischen KünstlerIn und KritikerIn. Häufig spielen auch ganz profane - wenn auch selten zugegebene - Fragen eine Rolle: wie viel Platz steht für die Kritik zur Verfügung, wie schnell muss sie geschrieben sein, wie hoch ist das Honorar, was erwartet der Finanzier, die Redaktion, die LeserIn? Ist die KünstlerIn berühmt, hat sie Einfluss? Versteht, schätzt oder mag man sie?
Die von uns bevorzugten 4 Grundsätze und Regeln werkorientierter Interpretation sind: (1) Inhaltsangabe, Hintergrund, Zeit- und Rahmenbedingungen und Verlauf der Handlung. (2) Leitmotive und Hauptthemen des Werkes. (3) Ausdrucksmittel: Sprache, Stil, Erwähnen und weg lassen, Dramaturgie und Spannung. (4) Besondere Analyse spezieller Themen. (5) Werkorientierte Wirkung und Interpretation der LeserInnen (Hierzu bringt W ein interessantes Zitat von Marcel Proust: "„In Wirklichkeit ist jeder Leser, wenn er liest, ein Leser nur seiner selbst. Das Werk des Schriftstellers ist dabei lediglich eine Art von optischem Instrument, das der Autor dem Leser reicht, damit er erkennen möge, was er in sich selbst vielleicht sonst nicht hätte erschauen können. Dass der Leser das, was das Buch aussagt, in sich selber erkennt, ist der Beweis für die Wahrheit eben dieses Buches und umgekehrt.“ – Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 7: Die wiedergefundene Zeit".)
___
Standort: Kasimir und Karoline.
*
Überblick Theater.
Überblick Kunst, Ästhetik, Psychologie und Psychopathologie der Kunst in der IP-GIPT.
Literatur- und Link- Liste zu den Seiten: Kunst, Ästhetik, Psychologie und Psychopathologie der Kunst.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Theater site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Kasimir und Karoline. Aus unserer Abteilung Kunst, Ästhetik, Psychologie der Kunst. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/kunst/theater/Kas&Kar.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen, die die Urheberschaft der IP-GIPT nicht jederzeit klar erkennen lassen, ist nicht gestattet. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert: irs 10.04.09
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
03.04.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.
11.04.09 Korrektur.
07.04.09 Lit Erg.
02.04.09 IP-GIPT Querverweise Materialien zur Liebe.