(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=30.07.2016 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 27.01.20
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org__Zitierung & Copyright_
Anfang_Heilmittel kognitive Differenzierung__Datenschutz_Überblick_Rel. Aktuelles_Rel. Beständiges_ Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ Service-iec-verlag__ Wichtige Hinweise Links u. Heilmittel
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Heilmittel-Lehre & Heilmittel-Monographien, und hier speziell zum:
J-Heilmittel Kognitive Differenzierung gegen Beweis-, Behauptungsangst und Lampenfieber
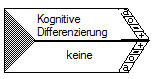
oder: Angst in für wichtig befundenen Entscheidungssituationen, z.B. Prüfungen. Aus aktuellem Anlass für Menschen, die Bewältigungshilfe gegen ihre Angst vor Anschlägen suchen.
Übersicht
Heilmittellehre und Heilmittel-Monographien *
Literaturhinweis
Symbolik
Heilmittelgraphik *
Terminologie
und Kennzeichnungen.
Originalarbeit von Rudolf Sponsel, Erlangen
Angst in für wichtig befundenen Entscheidungssituationen:
Ein psychotherapiedidaktisches
Papier zur Unterstützung bei Behauptungs-, Beweisangst und
Lampenfieber.
Angst ist der biologische Signalgeber für Gefahr, durch das Angsterlebnis werde ich auf Gefahren aufmerksam gemacht. Welche Gefahr droht also durch eine Behauptungs- oder Beweissituation, z. b. bei einer Prüfung? Nun, dass man schlecht abschneidet, durchfällt und damit seine Ziele nicht erreichen kann und man an Ansehen vor sich selbst und gegenüber anderen (Eltern, FreundInnen, KollegInnen, Vorgesetzten) verliert. Behauptungs- und Beweisangst wie z. B. die Prüfungsangst ist Angst vor dem Misserfolg, vor dem Versagen und den Folgen daraus.
Jede Angst besteht nun aus einem natürlichen, normalen Teil:
Primär-Angst
Und zu jeder Angst machen wir selbst einen künstlichen Teil
dazu: Sekundär-Angst
Der Primärangstanteil ist normal und natürlich, er sorgt dafür, dass wir aufmerksam sind und uns für die Aufgabe rüsten und wappnen. Daneben gibt es aber die Möglichkeit, zusätzliche Angst, Sekundärangst, aufzubauen, das ist die Angst, die wir selbst zusätzlich erzeugen, indem wir uns unter Druck setzen und Gedanken und Fantasien hingeben, die sich mit dem Versagen und seinen Folgen beschäftigen:
Behauptungs- und Beweisangst = Primär-Angst + Sekundär-Angst
= Natur-Angst + Künstliche Angst
Die Primär-Angst z. B. in Prüfungssituationen gehört zu den natürlichsten und normalsten Erscheinungen des Lebens. Jeder hat sie gewöhnlich und die allermeisten von uns spüren sie auch in den ganz verschiedenen psychologischen Funktionsbereichen.
”Gesichter” und Erscheinungsformen der Angst
Im Bereich des Gedächtnisses kann sich Angst so äußern,
dass frühere angstvolle Erfahrungen erinnert werden. Im Denken
bewirkt Angst vermehrtes meist negatives Nachdenken und Grübeln, Sorge
und Zweifel. Nimmt die Angst sehr starke Formen an, kann sich dies im Bereich
des Denkens als Blockade, Brett vor dem Kopf, alles Wissen und Können
wie weggeblasen und als Einfallslosigkeit, Gedankensperre äußern.
Im Gefühlsbereich äußert sich Angst direkt
als Angstgefühl, als Unbehagen, Unsicherheit, Beklemmung und als Erregung,
Aufregung, Nervosität, Spannung und Druck. Angst kann lähmen
und dies zeigt sich dann im Antriebs- und Energiebereich
als Antriebsmangel, Kraftlosigkeit und Schwächegefühl, man kann
sich lustlos, müde, leer, ja ausgebrannt, fühlen. Im Bereich
der Einstellung kann sich Angst als Ablehnung und Widerwille, (Ekel, Hass)
äußern. Auf den Willen und die Selbstkontrolle
wirkt die Angst in doppelter Weise, einerseits möchte man flüchten,
den angstbesetzten Situationen aus dem Weg gehen, andererseits spürt
man vielleicht, dass man den Konflikt aushalten sollte, was meist zu An-
und Verspannungen führt. Vielfältige Auswirkungen kann die Angst
auch auf den Körper haben: Im Bereich der
Brust
kann es zu einem Engegefühl kommen, im Bereich des Halses
und beim Sprechen kann sich die Angst als "Kloßgefühl" bemerkbar
machen. Die
Atmung kann sich beschleunigen, ist manchmal
flach und gepresst oder zeigt sich in Form von Atemnot. Der Atem kann stocken.
Die
Pupillen weiten sich, die Augen können sich weit
öffnen. Der Mund kann sehr trocken werden. Die Haut
kann rot oder blass werden, man schwitzt vermehrt oder bekommt sogar einen
regelrechten Schweißausbruch. Hitzewallungen oder Kälteschauer
können entstehen oder sich gar abwechseln. Die Ausscheidungsorgane
können verstärkten Harn- oder Stuhldrang melden. Bei großer
und plötzlich in “Beweis”-Situationen einsetzender Angst kann man
regelrecht in die Hosen machen. Der Kreislauf reagiert mit
erhöhtem Blutdruck und beschleunigtem Puls, es kann zur Herzrasen
oder Herzjagen kommen, man spürt das Herz in der Brust schlagen. Schwindel
kann auftreten. Im Muskel- und Skelettsystem kommt es zu
vermehrter Spannung, Verspannung oder Verkrampfung; auch sog. “weiche Knie”
können sich einstellen, Unruhe und Zittern kann einsetzen, man kann
aber auch ganz steif werden vor Angst. Der Gang kann schwankend
werden, wie auf einem Schiff. Das Verdauungssystem kann mit
einem flauen Gefühl im Magen reagieren, man sich kann sich unwohl
fühlen bis hin zum schlecht werden und erbrechen müssen. Im Wahrnehmungsbereich
kann es zu stärkeren Einschränkungen kommen, zu Seh- und Hörstörungen.
Das Bewusstsein engt sich ein auf das Angsterleben.
Wie entsteht die Sekundärangst, wie wird sie erhalten
und gesteigert?
All diese Äußerungsformen der Behauptungs-, Beweis- und
Misserfolgs-Angst sind in einem gewissen - milden - Umfang ganz normal
und natürlich. Erst das gesteigerte geistige Beschäftigen mit
den negativen Möglichkeiten erzeugt die zusätzliche Sekundär-Angst
sozusagen "künstlich". Die Sekundär-Angst entsteht durch die
geistige Beschäftigung mit dem Thema Misserfolg, Versagen, Fehler,
Scheitern und den fantasierten Folgen hieraus:
Dadurch wird die Aufmerksamkeit von der Aufgabe abgezogen
und Leistungsfähigkeit und Selbstvertrauen sinken. Die zusätzliche
Sekundär-Angst wirkt wie ein Störsender, Selbstvertrauen und
Leistungsfähigkeit werden gestört, worauf sich durch das Erleben
der Störung die Sekundär-Angst wieder verstärkt und ein
Teufelskreis wechselseitigen Hochschaukelns einsetzen kann. Die Fehleranfälligkeit
wird größer, Misserfolgsdenken drängt sich vermehrt auf,
so schaukelt sich die Sekundär-Angst immer weiter hoch, manchmal bis
zu panikartigem Erleben.
Wie kommt es zum Versagen und Scheitern?
Die Aufmerksamkeit geht von der Lösung der Anforderung weg. Bewusstsein
und Konzentration sind quasi zweigeteilt: der eine Teil versucht, mit der
Anforderung fertig zu werden, der andere Teil beschäftigt sich mit
der Angst und ihren Auswirkungen, oft auch mit den Folgen möglichen
Versagens und Scheiterns. Je öfter und je länger sich jemand
der Sekundär-Angst zugewendet und sie “gepflegt” hat, desto mehr konnte
sie sich verfestigen und ausweiten bis zum Schluss einer solchen Entwicklung
auch schon kleine oder entfernte Ereignisse durch die unfruchtbare Fantasietätigkeit
und Vorstellungskraft die Sekundär-Angst auslösen können.
Sekundär-Angst-Bekämpfung
Primär-Angst ist hilfreich und nützlich, weil sie uns eine
nützliche und leistungsfähige Grundspannung (”Lampenfieber”)
verschafft. Sekundär-Angst wird bekämpft und zurückgebildet,
indem Sekundär-Themen aus dem Bewusstsein verbannt werden, indem man
sich hier und jetzt völlig der Anforderung zuwendet, alles Störende
aktiv mental beiseite schiebt, sich genau und ausschließlich auf
das konzentriert, was ansteht, was man tun will. Diese Hingabe-Haltung
des Ganz-bei-der-Sache-Seins muss und kann man lernen, üben und trainieren.
Die psychologischen Heilmittel heißen: Hingabe, Konzentrieren (auf
das Richtige) und Nicht-Beachten, Ignorieren (des Falschen). Hierzu kann
das psychotherapeutische Papier "Bewusstseinslenkung
und mentales Training" ergänzend sehr hilfreich sein.
Literatur (Auswahl)
Literaturhinweis: In: Sponsel, R. (1995) werden S. 193 - 200 die meisten potentiellen psychologischen Heilmittel (neudeutsch: Heilwirkfaktoren) gelistet und ca. 180 - das sind längst nicht alle - in der Literatur beschriebenen Heilmittel S. 387 - 404 dokumentiert. Überblick Sponsel 1995.
Links (Auswahl: beachte) > Querverweise.
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
psychotherapiedidaktisches Papier
PatientInnen / KlientInnen können in unserer Praxis für das eine oder andere Problem oder Therapieziel von uns sog. psychotherapiedidaktische Papiere erhalten, falls sie diese als unterstützend und hilfreich bewerten, z.B. "Wie werde ich meine eigene PsychotherapeutIn - Praxis ("Straße") der Veränderung" oder "Bewusstseinslenkung" (das diese Seite gut ergänzt). Das Konzept des vorliegenden Papiers wird seit über 30 in unserer Praxis erfolgreich eingesetzt.
__
Terminologie. Mit dem griechischen Buchstaben Theta J (nach Jerapeia (therapeia): Heilung) kennzeichnen wir Psychische Funktionen, wenn sie Heilmittel oder Heilwirkfaktoren Qualität (Funktion) annehmen, z. B. J einsehen, J zulassen unterdrückter Erinnerungen, J stellen (konfrontieren), J sich überwinden und J mutig sein, J differenzieren, J entspannen, J lernen, J loslassen, J beherrschen ...
Man vergegenwärtige sich auch, dass viele Sachverhalte eine Doppelfunktion haben können: Heilmittel und Störmittel ("Gift"). Möchte man von der Heilmittelfunktion absehen, kann man einfach die Vorsilbe "Heil" weglassen und spricht dann ganz allgemein nur noch vom "Mittel" (zum Zweck). Ein Mittel zum Heilzweck wird sozusagen zum Heilmittel, wenn das Mittel zur Begleitung, Linderung, Besserung oder Heilung von Störungen mit Krankheitswert eingesetzt werden soll. Für Mittel zum Zweck fehlt ein eigentliches griechisches Wort, so dass sich Begriff und Wort des Werkzeuges organon (organon) anbietet mit dem Nachteil, dass sich o wenig vom lateinischen o unterscheidet, so dass wir aus typologischen Gründen lieber in lautgestaltlicher Analogie den Buchstaben m (Mü) wählen. Die Kennzeichnung m loben bedeutet also z.B., dass wir loben als Mittel kennzeichnen, um einen Zweck zu erreichen zur Abgrenzung von loben als z.B. spontaner Ausdruck von (freudiger) Anerkennung.
Und um deutlich zu machen, dass wir ein Wort nicht alltagssprachlich, sondern im Rahmen einer psychologisch-psychotherapeutischen Fachsprache verwenden, kennzeichnen wir das Wort mit dem griechischen Buchstaben y (Psi, mit dem das griechische Wort für Seele = yuch, sprich: psyche, beginnt). Störungs- Funktor. Begriffe, die eine Störung repräsentieren sollen, kennzeichnen wir mit dem Anfangsbuchstaben Tau (t) des griechischen Wortes für Störung tarach (tarach). Viel Verwirrung gibt es in und um die Psychologie, weil viele ihrer Begriffe zugleich Begriffe des Alltags und anderer Wissenschaften und damit meist vielfache Homonyme sind. Um diese babylonische Sprachverwirrung, die unökonomisch, unkommunikativ und entwicklungsfeindlich ist, zu überwinden, ist u. a. das Programm der Erlanger Konstruktivistischen Philosophie und Wissenschaftstheorie entwickelt worden: Kamlah & Lorenzen (1967). Zu einigen psychologischen Grundfunktionen siehe bitte: vorstellen. Ausführlich zur Terminologie.
- Querverweise
(Links) zum Terminologie-Problem in der Psychologie, Psychopathologie,
Psychodiagnostik und Psychotherapie:
- Über den Aufbau einer präzisen Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie aus Allgemeiner und Integrativer Sicht.
- Grundzüge einer Idiographischen Wissenschaftstheorie.
- Introspektion, Bewusstseins- und Bewusstheitsmodell in der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.
- Beispiel Nur_empfinden_fühlen_spüren.
- Über den Aufbau einer präzisen Wissenschaftssprache in Psychologie, Psychopathologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie.
- Überblick der Signaturen: Dokumentations- und Evaluationssystem Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
- Testtheorie der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.
- Probleme der Differentialdiagnose und Komorbidität aus Sicht der Allgemeinen und Integrativen Psychotherapie.
*
Querverweise
Standort: Heilmittelmonographie Heilmittel kognitive Differenzierung.
*
Überblick Heilung, Heilmittel und Heilmittelmonographien.
*