(ISSN 1430-6972)
DAS=06.10.2013 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung 20.10.13
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org__Zitierung & Copyright
Anfang Eindrücke vom Symposium 2013_Überblick_Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges_Titelblatt_Konzept_Archiv_ Region__ Service-iec-verlag_ _Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen_
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychologie, Psychopathologie, Psychodiagnostik und Psychotherapie, Abteilung Differentielle Psychologie der Persönlichkeit, und hier speziell zum Thema:
Bewusstsein – Selbst – Ich
Die Hirnforschung und das Subjektive
Eindrücke
von Rudolf Sponsel, Erlangen, zum subjektiven Geleit:
_
|
|
Zusammenfassung
Eindrücke
Es war ein sehr anregendes, interessantes und anstrengendes Wochenende,
weil ich alle 14 Veranstaltungen nicht nur erleben, sondern einschließlich
der Diskussion auch mit Notizen erfassen wollte, da ich mir so viel nicht
merken kann, so kam ich denn auf 29 Seiten Notizen (die auch entziffert
sein wollen ;-).
Die Atmosphäre war sehr gut und es schien mir,
als ob bei den neurowissenschaftlichen Vertretern etwas mehr Bescheidenheit
neben einer gewissen Ernüchterung einkehrte, wie weit man in den letzten
20 Jahren gekommen ist. Schon die unbekümmerte und naive Sprachweise
von "dem" Bewusstsein, als ob klar wäre,
was darunter zu verstehen ist, zeigt, dass die NeurowissenschaftlerInnen
teilweise immer noch auf dem sprachkritischen Niveau früherer Zeiten
verharren. Selbst so einfache Fragen, ob man zwischen Entscheidung
und Entschluss unterscheide (Diskussion Haynes), zeigte, dass selbst
auf dieser grundlegenden Ebene immer noch nicht viel geschehen ist. Dabei
sollte jedem klar sein, dass man ohne eine klare operationale und normierte
Sprache des Erlebens nicht sehr viel weiter kommen wird. Das alljährliche
Symposium im Turm der Sinne, Träger Humanistischer Verband (HVD),
ist, so gesehen, eine ganz hervorragende Einrichtung, die interdisziplinäre
Entwicklung voran zu bringen, und das auch noch bei rund 600 TeilnehmerInnen
aus allen Bildungs- und Fachbereichen.
Den Untertitel "Die Hirnforschung und das Subjektive"
suchte man in den meisten Vorträgen (Ausnahme > Amunts)
allerdings vergeblich, was mich einigermaßen verwunderte und enttäuschte.
Das Grundproblem der zwei Welten - das objektive
Geschehen und seine subjektive Bedeutung - ist bei vielen HirnforscherInnen
immer noch nicht angemessen verstanden, obwohl die neue sich abzeichnende
Tendenz eine eigene mentale Meßgröße um den Informationsbegriff
herum zu definieren (Koch in
Anlehnung an Tononi) zumindest grundsätzlich in die richtige Richtung
weist. Die Kernfrage: wie kann Erleben naturwissenschaftlich erfasst werden?
ist nach wie vor offen. Ich sitze jetzt vor dem Computer und schreibe diese
Zeilen, ich erlebe mich wach, interessiert, motiviert, konzentriert und
fühle mich gut. Das ist mein Erleben, das mein Gehirn möglich
macht. Natürlich stecken dahinter letztlich molekulare, physikalisch-chemische
Prozesse, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Tun oder Verhalten wird
von solchen getragen. Doch was "ist"
das Erleben? Nur eine Erscheinungsform (Identitätstheorie) ein und
desselben oder eine höhere Funktion (neue funktionale Kategorie) komplex
organisierter Materie oder etwas ganz Neues (neue fundamentale Kategorie)
...?
Verstehen und Überwinden der Schnittstelle
zwischen Materie und Erleben ist nach wie vor offen, wobei besonders verblüfft,
dass die biologische Grundaufgabe, was der evolutionäre Vorteil von
Bewusstsein und bewusstem Eleben ist, auch noch einer Antwort harrt. Auch
das hülfe wahrscheinlich weiter.
Obwohl es auch erfreuliche und bedeutsame Fortschritte
im Einzelnen gibt, tritt doch immer klarer und deutlicher hervor, dass
es am grundlegenden Verständnis und an einer geeigneten Sprache zu
seiner Formulierung fehlt. Hier wäre eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe,
die sich an die grundbegriffliche Basisarbeit macht, sehr wünschenswert
und für weitere Entspannung und konstruktive Zusammenarbeit hilfreich
und nützlich.
Meine Eindrücke zu
den einzelnen Vorträgen sind an Ort und Stelle vermerkt. Auf der Homepage
des Turms der Sinne sollen in der nächsten Zeit die Vorträge
(Powerpoint/ PDF), soweit die AutorInnen das zulassen (können), zum
Download
angeboten werden. Ich werde das gelegentlich mitteilen und dokumentierten.
Zur Einführung und zum Geleit des Turms der Sinne
"Die Fortschritte der Neurowissenschaften erschließen grundlegende Arbeitsprinzipien des menschlichen Gehirns. Alle geistigen Aktivitäten gehen mit spezifischen neuronalen Anregungsmustern einher. Doch nur die wenigsten Leistungen des Gehirns führen zu einem bewussten Erleben seines Besitzers. Und ein „Ich“ kommt in den Daten von Hirnscans naturgemäß nicht vor.
Wie weit reichen also die Methoden und Konzepte der Hirnforschung? Kann die „Erste-Person-Perspektive“ des Ich-Erlebens auf die „Dritte-Person-Perspektive“ der Neurobiologie zurückgeführt werden? Wie verhält sich die subjektive Innensicht unserer Erlebnisse zur objektiven Außensicht unserer Hirnzustände? Wie entstehen Bewusstsein und persönliches Identitätsgefühl? Welche Störungen können dabei auftreten? Wovon hängt unser Selbstbild ab?
Wir diskutieren diese Fragen mit einigen der bedeutendsten deutschsprachigen Hirnforscher und schlagen dabei die Brücke zu Medizin, Psychologie und Philosophie. Diskutieren Sie mit!"
Freitag, 4. Oktober 2013: 18:00-19:30 Empfang Öffnung des Tagungsbüros
Prof. Dr. Christof Koch
(19:30-21:30)
Das Leib-Seele-Problem im 21. Jahrhundert Die biologischen Grundlagen
des Bewusstseins [PDF]
| Zusammenfassung: "Zu Beginn des dritten Jahrtausends versuchen Wissenschaftler zu verstehen, wie subjektive, phänomenale bewusste Empfindungen von hochorganisierter Gehirnmaterie hervorgebracht werden. Ich werde den Kenntnisstand der Anatomie und Physiologie des Bewusstseins zusammenfassen, die Grenzen unseres Wissens aufzeigen und aktuelle Experimente mit Menschen, Affen und Mäusen vorstellen, die die neuronalen Korrelate von Bewusstsein dingfest machen sollen. Ich werde den vielversprechendsten theoretischen Zugang beschreiben, der auf Schaltkreiskomplexität und Informationstheorie beruht, und daraus Folgerungen für Bewusstsein bei natürlichen und künstlichen Systemen ziehen." |
Koch, der mit Crick forschte, fing mit seinem Eröffnungsvortrag gut an, als er das Wissen um "das" Bewusstsein darlegte und dabei Funktionsbereich um Funktionsbereich als Grundlage des Bewusstseins oder wichtig bzw. bedeutsam für es, (C im folgenden) einen nach dem andern ausschloß:
- C gibt es auch ohne Verhalten.
- C erfordert keine Bewusstheit.
- C erfordert kein Sprache.
- C brauche keine Affekte / Emotionen.
- C erfordert kein Selbstbewusstsein.
- C braucht kein Langzeitgedächtnis.
- C braucht braucht keine verbundenen Hirnhälften, es existiert auch nach Durchtrennung des corpus callosum in beiden Hemisphären (split brain).
- C wird in seinen Inhalten durch Destruktion bestimmter Hirnteile betroffen.
- C ist etwas anderes als Aufmerksamkeit, die auf etwas gerichtet sein kann, ohne dass es bewusst ist oder wird.
- C braucht kein Kleinhirn (86 Mrd. Neuronen), auch Selbstbewusstsein nicht beeinträchtigt.
- Augen nicht notwendig zum bewussten Sehen [RS: Koch unterscheidet nicht zwischen sehen, wahrnehmen und vorstellen]
Bei mir hat diese einleuchtende Methode und Aufzählung
beeindruckender Sachverhalte, was alles nicht erforderlich ist für
"das" Bewusstsein, die Erwartung erzeugt, dass am Ende des Ausschlussverfahrens
nun gesagt wird, welche neuronalen Zellen und Gebiete die Grundlage des
Bewusstseins bilden. Aber das kam nicht. Stattdessen die Hoffnung, dass
man in 10, 20, 30, ... Jahren, irgendwann wird genau zeigen können,
welche Zellen mit welchen Bewusstseinszuständen zusammenhängen
und welche Strukturen in der Lage sind, Bewusstseinszustände herbeizuführen.
Nun gut, ich hatte eine falsche Erwartung ausgebildet.
Fazit: wir wissen nicht, wie und wodurch "das"
Bewusstsein erzeugt und gesteuert wird.
Sodann geht Koch auf die Bewusstseins-Theorie ("Das Bewusstsein ist
eine grundlegende Eigenschaft, wie Masse oder Ladung.") von Tononi [W]
ein. Die beiden Kernbegriffe sind hier Differenzierung und Integration/Integrität.
Eine wichtige Rolle spielt hier ein mathematischer Ansatz, mit dem die
Integration/Integrität gemessen werden kann, wobei mir nicht klar
wurde, was da genau wie gemessen wird.
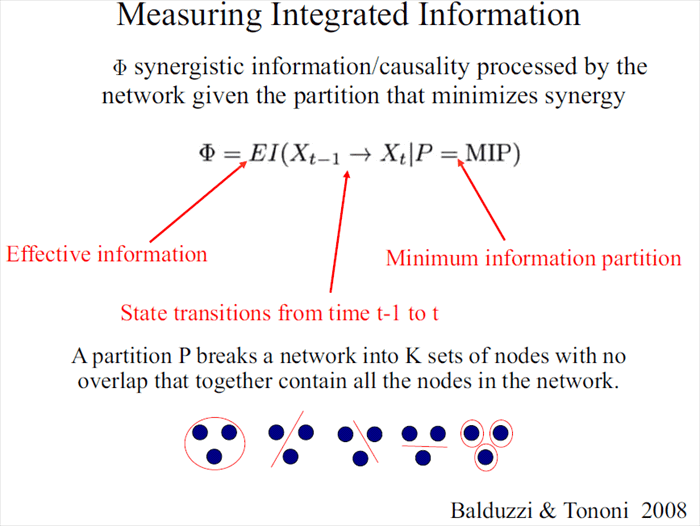
Quelle: https://turmdersinne.de/magic/show_image.php?id=10907&download=1
Wie wichtig, ja unverzichtbar, gemeinsame Größen von Bewusstsein
und seinen Inhalten (Geist) und neuronaler Materie sind, wurde erst später
durch die Physikerin, Wissenschaftstheoretikerin und Philosophin Brigitte
Falkenburg sehr eindringlich deutlich gemacht: ohne gemeinsame Messgrößen
(vereinfacht zwischen Materie und Geist) gibt es kein naturwissenschaftliches
Erkenntnisniveau.
Obwohl im abstract angekündigt, konnte ich
im Vortrag nicht erkennen, wie sich nun das Subjektive in der Hirnforschung
Kochs zeigt.
Ende 21.16. Es folgte eine rege und lange Diskussion
mit 19 Beiträgen. Aus einigen Antworten ergeben sich die Fragen:
Die Quantentheorie braucht man für die Theorie des Bewusstseins
(B) nicht. Eines Tages wird man eine Maschine, die B. hat, bauen können.
Unterschiedliche soziale Umwelten haben Auswirkungen auf das B. Die Variabilität
des Gehirns ist sehr hoch. Seele wird informationstheoretisch interpretiert.
Hinsichtlich der Nahtoderfahrungen verweist Koch auf ein Experiment von
1943, wo man feststellte, wie lange es dauert, eine Ohnmacht durch Unterbindung
der Sauerstoffzufuhr herbeizuführen (7 sec.); die meisten berichteten
hierbei Erlebnisse ähnlich wie die Nahtoderfahrungen. Einfache Strukturen
sind nicht untersuchbar, z.B. beim Wurm, mangels Aktionspotentialen. Er
habe sich die ersten 20 (seiner 30) Forscher-Jahre viel von Emergenz versprochen.
Jetzt denke er, das physikalische Universum (Raum, Zeit, Masse, Energie)
müsse erweitert werden. Meta-Gedanken seien essentiell für den
Menschen und zeichneten ihn gegenüber seinen biologischen Verwandten
aus. Je höher die Selbstorganisation, desto höher das phi (Integrität
des B.). Die schlechten Meßmethoden sehe er als Herausforderung,
er möge nicht in einer Endzeitwelt leben, in der man schon alles wisse.
B. brauche keine Emotionen, Damasio habe hier nicht recht. Es sei gesichert,
dass es B. gibt, wenn Affekte fehlen. Über die langsamen Gliazellen
wisse man zu wenig. Zum B. des Internets: jedes integrierte System habe
ein phi > 0. Verbindungen erfassen sei Integration.
Anmerkung: Die Koch’sche Position wurde am Sonntag
von Norbert Bischof angegriffen.
Samstag, 5. Oktober 2013: 08:30-09:00 Empfang
Prof. Dr. Wolf Singer (09:00-09:45)
In unserem Kopf geht es anders zu, als es uns scheint Das Gehirn – ein sich selbst organisierendes System [PDF]
| Zusammenfassung: "Unsere Intuition legt nahe, dass es in unserem Gehirn eine Instanz gibt, die über alle im Gedächtnis gespeicherten und durch Sinnessignale ergänzten Informationen verfügt. Dieser Instanz obläge es, das Geschehen im Körper und der Welt draußen zu interpretieren, daraus Schlüsse zu ziehen, Entscheidungen zu fällen und zukünftiges Handeln zu strukturieren. Die Ergebnisse der Hirnforschung widersprechen dieser so plausibel erscheinenden Vermutung. Sie verneinen die Existenz einer zentralen Instanz und zeichnen das Bild eines in hohem Maße distributiv organisierten Systems, in dem ständig eine Vielzahl sensorischer und exekutiver Prozesse parallel abläuft. Es wird diskutiert, auf welche Weise diese verteilten Funktionen sich selbst organisieren und so verbinden können, dass sie zu kohärenten Wahrnehmungen, Entscheidungen, Aktionen und bewussten Zuständen führen. Auf mögliche Parallelen zur Organisation von komplexen sozialen Systemen wird verwiesen." |
Singer führt zunächst aus, dass "das" Gehirn
unsere kognitiven Leistungen begrenzt, es ist ein Ergebnis evolutionärer
Anpassung, erfasst nur einen winzigen Ausschnitt der Welt und ist eklektisch.
All unser Wissen residiert in der Architektur unseres Gehirns, auch die
Regeln des Erkennens, auch das Mentale und alle neuronalen Prozesse gehorchen
den Naturgesetzen. Er geht auf die Natur der Erkenntnis, das Leib-Seele-Problem,
die Frage des ICHs und den freien Willen ein - der im deterministischen
Weltbild mit Kausalitätspostulat natürlich keinen Platz hat.
Anschließend nennt er eine Taxonomie der Wissensformen: durch die
Evolution vermitteltes, tradiertes implizites Wissen, durch Erfahrung erworbenes,
epigenetisches,
teilweise implizites Wissen und lebenslange Lernprozesse als explizites
Wissen. Die Grundfrage: Gibt es einen verorteten Beobachter, verneint er
wie immer schon.
Das ist der (vorläufige) Befund Singers. Hier
fehlt es der Hirnforschung offenbar einerseits an Fantasie und Kreativität,
andererseits an einer klar definierten, standardisierten erlebenspsychologischen
Terminologie und Methodologie - die die Psychologie anzubieten bislang
leider auch nicht in der Lage ist - um an dieses Problem angemessen heranzukommen.
Zwar mag es richtig sein, dass das Gehirn ein hochdimensionales, nicht-lineares
System ist, das grundsätzlich keine Voraussagen ermöglicht und
in seiner Komplexität nur schwer naturwissenschaftlich erfasst werden
kann, aber es fragt sich dann natürlich umso mehr, wenn man so wenig
klar wissen kann, wieso man dann andererseits alle Grundfragen so leicht
und locker, quasi im Nebenbei, meint beantworten zu können. Es gibt
nicht den geringsten Zweifel, dass es Selbstbilder und Ich-Identitätserleben
- das auch gestört sein kann - gibt. Und so wie die mentale Organisation
des Begriffes "Hund" - wie eindrucksvoll in einer Graphik in dieser Tagung
gezeigt wurde - so ist natürlich auch die vielfältige Bedeutung
des Begriffes ICH im Gehirn repräsentiert. Aufgrund der enormen Vielfalt
an Knotenpunkten (Neuronen), Schaltstellen (Synapsen) und ihren Verbindungen
(Axone, Dendriten), dürfte hier allerdings außer einem riesigen
dunklen Flecken nichts mehr erkennbar sein. Man müsste "das" ICH zerlegen,
z.B. in Wahrnemungs-Ich, autobiographisches Gedächtnis-Ich, Wunsch-Ich,
... Dass die Hirnforschung kein Zentrum finden kann, spricht nicht gegen
ein Zentrum, sondern nur gegen die Fähigkeiten und Konzepte
dieser
Hirnforschung. Um hier diskutable Aussagen machen zu können, wäre
es natürlich zu allererst notwendig, "Zentrale", "Zentrum", "zentrale
Steuerung" - gegenüber anderen Steuerungen, wie z.B. die von Schwärmen
- klar zu definieren.
Sodann formuliert Singer zwei wichtige grundlegende
Fragen: wie wird gebunden, was zusammengehört und wie wird getrennt,
was nicht, illustriert durch einige schöne Beispiele unvollständiger
Bilder (4 Pferde). Das sind alte Fragen der Gestaltpsychologie
von Gestaltbildung, Figur und Hintergrund. Die Aussage, dass Inhalte durch
Assembles kodiert werden, erhellt so wenig wie alle Prozesse äußerten
sich in komplexen Mustern. Die Ausführung, aus der Paradoxie zwischen
Kausalität einerseits, andererseits Nichtvorhersagbarkeit aufgrund
hochdimensionaler, nicht linearer Komplexität, ergäbe sich Raum
für Kreativität und Veränderung, bleibt etwas dunkel. Die
Fragen zu den großen psychiatrischen Erkrankungen (Schizophrenie,
Autismus, Alzheimer) seien immer noch ungeklärt, ja hier befinde man
sich sogar erst am Anfang.
Nun, das stimmt wohl überhaupt.
Ende 09.39. Im Anschluss konnten vier Fragen gestellt werden:
Das Wort sei sehr mächtig und könne die
Gehirnarchitektur verändern. Nicht nur die kognitive Verhaltenstherapie,
alle Therapien seien hier gleichwertig. Zum Identifizieren beim Sehen wird
auf die Gestaltregeln verwiesen. Zum Widerspruch zwischen Determiniertheit
von Entscheidungen und Raum für Veränderungen, bekräftigt
Singer, dass es unendlich viele Bifurkationsmöglichkeiten [W]
gäbe und nichtlineare Dynamik grundsätzlich nicht vorhersagbar
sei. Er schließt mit der Empfehlung für die jungen NachwuchswissenschaftlerInnen,
dass sie mehr Mathematik lernen sollen, wenn sie weiter kommen wollen.
Ende der Nachfragen 9.46 Uhr.
Prof. Dr. Katrin Amunts
(09:45-10:30)
Mein Hirn, Dein Hirn, das simulierte Hirn Individuelle Vielfalt
aus der Sicht der Neuroanatomie [PDF]
| Zusammenfassung:
"Interindividuelle Variabilität in Hirnbau und Funktion wird von vielen
Wissenschaftlern als Störfaktor gesehen, den man in seinen Experimenten
möglichst „klein halten“ oder später „herausrechnen“ sollte.
So möchte man letztlich zu allgemeinen Aussagen über eine bestimmte
kognitive Leistung oder ein strukturelles Organisationsprinzip gelangen.
Mit diesem Ziel werden in funktionell bildgebenden Untersuchungen zum Beispiel Stichproben von männlichen Probanden genommen – alle Mitte 20 und vielleicht auch noch alle weiteren Studenten. Von diesen Ergebnissen wird dann auf das menschliche Gehirn im Allgemeinen geschlossen. In epidemiologischen Untersuchungen werden nicht-selektierte, große Populationen untersucht, die bis in die Zehntausende oder Hunderttausende gehen können. Somit kann in diesen Stichproben nur ein Bruchteil von Hirnprozessen analysiert werden. Bei beiden unterschiedlichen Forschungsansätzen lautet die Frage, was interindividuelle Variabilität in der Ausprägung eines bestimmten Gehirnmerkmals mit Persönlichkeit oder Verhalten zu tun hat. Der hier vorgestellte Ansatz ist als interindividuelle Variabilität im Bau des Gehirns in seinen verschiedenen Organisationsebenen als Korrelat der Variabilität mentaler Leistungen zu betrachten. Es wird dargestellt, wie sich interindividuelle Variabilität des Hirnbaus zeigt – in der zellulären Architektur, der molekularen Architektur und der Konnektivität. Schließlich werden Beispiele zeigen, dass es sowohl für relativ einfache, motorische Funktionen als auch für einige komplexere Verhaltensweisen aus dem Bereich der Sprache durchaus Hinweise dafür gibt, welche Auswirkungen Hirnstruktur auf Funktion, sich ändernde Strukturen auf Änderungen der Hirnfunktionen und umgekehrt haben." |
Dieser Vortrag erfüllte angenähert den Untertitel des Symposiums
- wenn auch nicht ganz bis hin zum einzelnen Subjektiven - und befasste
sich tatsächlich mit den individuellen Unterschieden der Gehirne,
wobei eine große interindividuelle Variabilität belegt werden
konnte [1000GehirneStudie].
Schon das Gewicht der Gehirns zeigt erstaunliche Unterschiede, aus dem
allerdings kaum Folgerungen ableitbar sind. Die Sprachareale 44 und 45
variieren sehr, z.T. bis zum Faktor 5. Auch das Sprachgenie Legationsrat
Krebs (1867-1930) [W],
der 60 Sprachen beherrschte, zeigte deutliche individuelle Eigentümlichkeiten
(44 symmetrisch, 45 asymmetrisch gegenüber 10 Kontrollgehirnen). Das
ist besonders für Eingriffe und Therapie außerordentlich wichtig,
um die richtigen Zielgebiete auch treffen zu können. Im Alter wird
das Gehirn etwas leichter. Bestimmte Krankheiten können zu fortschreitenden
Einbußen führen.
10.29 Ende. Anschließend war noch Zeit für
vier Fragen:
Bei Delphinen, die wie die Wale ein viel größeres
Gehirn als der Mensch haben, sei das schwer zu untersuchen. Intelligenz
ist nicht gleich Intelligenz, Vergleiche sind schwierig, die Forschung
steckt hier noch in den Kinderschuhen. Es gäbe zwar noch Spielraum,
aber die Magnetresonanzmethode habe ihre physikalischen Grenzen. Einzelne
Zellen werden wohl nicht darstellbar sein. Das Spannungsfeld zwischen Individualität
und allgemeinen Regeln geht weiter, Atlanten nötig [3DAtlas].
In Zukunft könnten sich höhere Hirngewichte und spezifischere
Architekturen entwickeln. Ende 10.39.
10:30-11:00 Pause (Kaffee, Tee, Mineralwasser inkl.)
Prof. Dr. Ansgar Beckermann
(11:00-11:45)
Selbstbewusstsein ohne Ich Wie kognitive Wesen lernen, sich
als Teil der Welt zu sehen [PDF]
| Zusammenfassung: "Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel schaue? Mein Ich? Mein Selbst? Nein, ich sehe mich, nur mich – das Lebewesen, das ich bin. Dass es in jedem Menschen, sozusagen als inneren Personenkern, ein Ich oder Selbst gibt, das wie ein Operator in einer Schaltzentrale das ganze Denken und Handeln dieses Menschen steuert, ist eine Annahme, die sich erst im 17. Jahrhundert entwickelt und die – als massiver philosophischer Irrtum – eine Menge Unheil angerichtet hat. Aber wenn es kein Ich und kein Selbst gibt, was kann dann Selbstbewusstsein bedeuten? Viele Lebewesen – auch wir Menschen – sind kognitive Wesen, die, um angemessen in ihrer Umwelt agieren zu können, diese Umwelt repräsentieren müssen. Wir müssen herausfinden, welche Dinge es in unserer Umwelt gibt, was das für Dinge sind, welche Eigenschaften sie besitzen und in welchen Beziehungen sie zueinander stehen. Für die meisten Zwecke ist es jedoch nicht nötig, dass wir uns selbst als Teil unserer Umwelt repräsentieren. Diese Notwendigkeit ergibt sich erst, wenn wir in einer Umwelt leben, in der es andere kognitive Wesen wie uns selbst gibt. Denn für diese kognitiven Wesen sind wir Teil ihrer Umwelt, und deshalb repräsentieren diese Wesen uns auch als Dinge in ihrer Umwelt. Wenn wir das bemerken, beginnen wir zu verstehen, dass auch wir in der Tat Dinge in unserer Umgebung sind, die einen bestimmten Ort und die bestimmte Eigenschaften haben. Selbstbewusstsein – ein Bewusstsein unserer selbst – entwickelt sich also, wenn wir uns selbst explizit als Dinge in unserer Umwelt repräsentieren und wenn wir versuchen herauszufinden, wo wir uns befinden, welche Eigenschaften wir haben und – zum Schluss – wie wir selbst unsere Umwelt repräsentieren." |
Beckermann steigt fulminant ein mit seiner These:
DAS Ich und DAS Selbst gibt nicht. Seine profunde und interessante Sprachkritik
setzt an Übersetzungsfehlern bei Descartes an, dem die Neuzeit im
wesentlichen die unglückliche und falsche substantivische Sprechweise
von DAS ICH und DAS SELBST verdanken soll. Er sieht in dieser Sprechweise
eine unnötige, verwirrende und falsche Verdoppelung. Feinsinnig bemerkt
er, dass es zwar ein Selbstbewusstsein meiner selbst aber
nicht meines Selbst gibt.
11.45 Ende. 6 Fragen wurden gestellt.
Viele Menschen täuschen sich mit ihren Ansichten über sich
selbst. Ob Pflanzen eine Repräsentation der Umwelt haben (Klima) ist
nicht ausgemacht, sie könnten auch direkt auf die Temperaturen reagieren.
Zwischen Ich- und Selbstbegriffen gäbe es sicher Zusammenhänge.
Ja, zur Kritik am ICH gibt es Vorgänger (Nietzsche wurde genannt).
Auf die vorletzte Frage bekräftigt Beckermann noch einmal: Man sollte
die Welt nicht verdoppeln. Bei der letzten Frage zur Eigenwahrnehmung räumt
er ein, dass es viele explizite und implizite Selbstrepräsentationen
gibt. Ende Fragen 12.02.
Aus psychologisch-psychotherapeutischer Sicht mag
diese Kritik aus sprachanalytischer Sicht durchaus richtig und nötig
sein, aber sie ist doch sehr sophistisch und partikularistisch und geht
an der Alltags-, psychologischen Forschungs-, besonders der differentiellen
Psychologie der Persönlichkeit, und der psychotherapeutischen Praxisrealität
weit vorbei. Beckermann schüttet quasi das Kind mit dem Badewasser
aus und scheint auch gezielt misszuverstehen. Wer hat denn jemals behauptet,
dass er, wenn er in den Spiegel sieht, seinem ICH und nicht seinem Abbild
begegnet? Auch falscher oder missverständlicher sprachlicher Ausdruck
kann gutwillig interpretiert angemessen verstanden werden. Denn natürlich
haben die allermeisten Menschen ein Verständnis von sich selbst, das
sich z.B. im Ausdruck Selbstbild findet. Und man kann natürlich jederzeit
auch ein ICH konstruieren. Selbst die psychoanalytischen Konstruktionen
ICH, ES, ÜBER-ICH liessen sich, jenseits von homunkulustischen
Fehlentwicklungen, sinnvoll und praktisch konstruieren. Für jeden
Affen ist es lebenswichtig, dass er einschätzen kann, wie er von einem
Ort zum andern springen kann. Dazu bedarf es keines anderen Affen. Nur
noch ein Beispiel: Wissen, das man durch Erfahrung erwirbt, was man kann
und nicht kann, wie lange und wie gut man es kann oder nicht, ist sicher
überlebens-, zumindest aber lebensqualitätsförderlich. Und
das rechnet man völlig berechtigt einem Selbstkonzept zu.
Anmerkung: Die Kritik an Prechts
Äußerungen im SPIEGEL wird dessen kritischer Haltung, wie er
sie in seinem Buch (2007) "Wer bin ich und wenn ja, wie viele" nicht
gerecht.
Prof. Dr. Ulrich Kühnen
(11:45-12:30)
Kultur und Kognition Wie das Selbst das Denken formt [PDF]
| Zusammenfassung: "Wie beeinflusst die Kultur das Selbstkonzept einer Person? Welche Konsequenzen hat das Selbstkonzept für ihr Erleben und Handeln? Das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und sozialen Gruppen, denen er angehört, bzw. die relative Betonung von Autonomie vs. sozialer Eingebundenheit, stellen eine der wichtigsten Kulturdimensionen dar. Entlang dieser Dimension finden sich auch Unterschiede in den Selbstkonzepten der jeweiligen Kulturmitglieder. So können Personen sich selbst einerseits vorwiegend durch solche Aspekte definieren, die die eigene Unabhängigkeit betonen (etwa eigene Ansichten, Fähigkeiten oder Eigenschaften). Andererseits kann das Selbst durch solche Merkmale definiert werden, die den sozialen Bezug zu anderen Personen herstellen (z.B. eigene Gruppenmitgliedschaften oder soziale Rollen). Wann immer ein psychologischer Prozess die eigene Person betrifft, wirkt sich der Unterschied in den Selbstkonzepten auf das Ergebnis aus. Dies gilt zum Beispiel auch für subjektive Erklärungen von eigenen und fremden Handlungen. Personen neigen generell dazu, den Einfluss von internen Merkmalen des Handelnden (etwa seine Motive oder Einstellungen) zu überschätzen, situative Einflüsse jedoch nicht ausreichend zu berücksichtigen. Eigene Entscheidungen werden überdies als Ausdruck der persönlichen Identität angesehen und als solche oftmals auch im Nachhinein gerechtfertigt. Diese Urteilstendenzen sind in solchen Kulturen, die die Autonomie des Einzelnen betonen, besonders stark ausgeprägt." |
Witzig merkte Kühnen gleich zu Beginn an, dass er nach Beckermann
den Untertitel seines Vortrags umformulieren müsste. Tatsächlich
kann man diese empirisch fundierten und informativen Ausführungen
gerade als einen Beleg dafür ansehen, wie wichtig und nützlich
das Selbstkonzept in der kulturvergleichenden Forschung ist. Die Gegenüberstellung
des westlichen und asiatischen Kulturkreises erbrachte klare empirische
Belege für die unterschiedlichen und generalisierten Selbstkonzepte.
Das westliche Selbstverständnis ist ich- und selbstbezogener als das
Asiatische. Das asiatische Selbstkonzept bezieht die soziale Bezugsgruppe
sehr viel stärker ein. Der Westen überbetont das Individuelle
und der Osten die soziale Bezugsgruppe. Das lässt sich in der Sprache
nachweisen und hat Auswirkungen bei Verhandlungen und im Verhalten. Westler
fangen bei den Außenrändern ("Extremen") an, Ostler, mehr harmoniebetont,
im Mittelfeld.
Ende 12.37, sieben Fragen wurden gestellt:
Vergewaltigte Frauen in Indien und liegenbleibende Verletzte in China
haben damit zu tun, dass die Bindung nur die nähere soziale Bezugsgruppe,
aber nicht Fremde betreffen. Dass auch andere Faktoren eine Rolle spielen
wie Alter, Geschlecht und Subgruppen stimme, invalidiere aber die Hauptaussage
nicht. Priming - für die Versuche - hält nicht sehr lange vor,
Minuten bis vielleicht eine halbe Stunde, ist hier aber nicht speziell
untersucht worden. Ja, die soziale Schicht spiele auch eine Rolle. Durch
Migrantenstudien wisse man um die Anpassungsfähigkeit, man könne
von einem epigenetischen priming sprechen.
Wahrnehmungsfehler seien von den Zielen und Zwecken und von den jeweiligen
Situationen abhängig. Um dem clash der Kulturen besser begegnen zu
können, könnte man versuchen, die Vorteile beider Sichtweisen
zusammenzubringen. Der Osten sehe mehr die Zwischenräume, der Westen
eher die Säulen. Ende 12.52
12:30-14:00 Mittagspause
Prof. Dr. Dr. Henrik Walter
(14:00-14:45 )
Der ganz normale Wahnsinn Bewusstsein, Hirnforschung und psychische
Erkrankung [PDF]
| Zusammenfassung: "Werden wir menschliches Denken, Fühlen und Erleben jemals wissenschaftlich vollständig erklären können? Darüber lässt sich im Lehnstuhl trefflich streiten: „Du bist Dein Gehirn!“ sagen die einen; „Die Existenz von neuronalen Korrelaten des Geistigen ist trivial!“ die anderen. Trotz einer Vielzahl unterschiedlicher Positionen zu psychischen Erkrankungen ist es inzwischen unbestritten, dass psychische Erkrankungen immer auch mit entsprechenden Hirnveränderungen einhergehen, und jede Form der Therapie, auch die Redekur, nur über ihre Einwirkung auf das Gehirn Effekte haben kann. Deswegen können wir etwas über den menschlichen Geist aus der biologischen Psychiatrie lernen. Ich werde zunächst die aktuelle Diskussion um das psychiatrische Diagnosesystem vorstellen, den Ansatz der biologischen Psychiatrie erläutern, und neuartige Methoden und aktuelle Erkenntnisse aus der biologischen Psychiatrie vorstellen. Dabei werde ich einige weitverbreitete und hartnäckige Missverständnisse zum biologischen Ansatz aufklären, die populäre Bewegung der Neurokritik kommentieren und methodische, erkenntnistheoretische und ethische Grenzen eines biologischen Ansatzes aufzeigen. Abschließend werde ich die Frage aufwerfen, wie lange wir noch auf einen „Darwin des Gehirns“ warten müssen, oder ob wir ihn vielleicht schon gefunden haben." |
Walter beginnt mit einem Beispiel (Prodromalstadium
Schizophrenie), kommt dann auf die Diagnostik (Schizophrenie, depressive
Episode), zu sprechen, erwähnt Zweifel an der Psychodiagnostik am
Beispiel Mollath und kommt in diesem Zusammenhang auf die notwendige und
überfällige Kritik am DSM 5 zu sprechen, das in extremer
und gänzlich unakzeptabler Weise Normales pathologisiert und berichtet,
dass kein Geringerer als Thomas Insel von der NIMH am 29.4.2013 sich hierzu
sehr kritisch zu Wort gemeldet hat.
Er referiert dann das Projekt RDoC - ein Projekt
der NIMH (2009) zu den Grundfunktionen und kommt sodann auf die 3. Welle
der biologischen Psychiatrie zu sprechen. Die erste Welle: symptomatische
Hirnforschung (z.B. progressive Paralyse, Nietzsche). Die zweite Welle
Phase der Neurotransmitter (1957 Imipramin, 1958 Haloperidol, 1963 Diazepam).
Mit der dritten Welle, seit ca. 2 Jahrzehnten, liegen folgende Modelle
psychischer Erkrankungen hervor: 1) essentialistisches Modell, 2) sozialer
Konstruktivismus (Antipsychiatrie), 3) pragmatisches Modell (ICD, DSM),
4) Clustermodell mechanistischer Eigenschaften. Es ist charakterisiert
durch folgende Methoden: Molekularbiologische Methoden: Hochdurchsatzmethoden
in (Epi-)genetik, Kognitionspychologie, Neuroimaging, Methodenkombination,
z.B. Imaging Genetics, tiefe Hirnstimulation, Optogenetik, die im Folgenden,
nicht leicht verständlich, gestreift werden. Das Problem: Es gibt
keine 1:1 Relationen zwischen Symptomen und Hirnprozessen. Ein systematischer
Ansatz nimmt eine multiple Kartierung vor.
Nach dem Schlagwort "Das Gehirn ist keine Insel"
erwähnt er Neurochauvinismus und die Neurokritik. Mit dem Stichwort
"Situierte Kognition" wird ein neuer Ansatz der Kognitionswissenschaft
besprochen mit Konsequenzen für die Theoriebildung. Schmerzlich vermisst
Walter eine allgemeine Hirntheorie und stellt einen Kandidaten vor (Karl
Friston, 2010), dessen Grundidee auf zwei Prinzipien beruht: Minimierung
von Vorhersagefehlern und von Energieverbrauch. Aus seiner Zusammenfassung
der m. E. wichtigste Satz: Die Zeiten simplifizierter Hypothesen sind vorbei.
Ende 15.05. 6 Fragen wurden gestellt.
Die Antwort auf die Frage zu den Remissionen bei Schizophrenien ist
mir entgangen. Um eine behaviorale Diagnostik 2. Ebene gehe es nicht. Ob
der Patient, den er am Anfang beschrieb, geheilt wurde, dürfe sich
der Fragende aussuchen, weil er sich diesen ausgedacht habe (Prodromalstadium
Schizophrenie). Wahn lasse sich gut behandeln. Strukturelle Diagnostik,
Mikro- und molekulare Ebene wird berücksichtigt. Im Zusammenhang mit
Schizophrenien gäbe es in der Tat einen großen Überschneidungsbereich
mit Verschwörungstheorien. Ende Fragen 15.15
Für meine Aufnahmekapazität am frühen
Nachmittag war der fünfte Vortrag zu dicht gepackt.
Prof. Dr. Frank Erbguth
(14:45-15:30)
Narkose – Koma – Wachkoma
Erkenntnisse zum „abgeschalteten“
Bewusstsein [PDF]
| Zusammenfassung: "Es gibt unterschiedliche Zustände, in denen unser Bewusstsein „abgeschaltet“ zu sein scheint: (1) in natürlicher Weise im Schlaf (griech. „Hypnos“; in der Antike der Bruder des Todes Thanatos und Vater der Träume), (2) bei Schädigungen des Gehirns im Koma (griech. „tiefer Schlaf“) und (3) bei einer Narkose („künstliches Koma“) in Form unterdrückter Hirnaktivität durch zugeführte Substanzen. Der Begriff „Wachkoma“ ist unglücklich gewählt, da er zwei widersprüchliche Zustandsbezeichnungen enthält. Gemeint ist die Kombination geöffneter Augen als Signal für Wachheit bei gleichzeitig komplett aufgehobener Reaktivität als Zeichen der Bewusstlosigkeit (= Koma). Oft besteht eine Begriffsverwirrung bei der korrekten Bezeichnung von Gehirnschädigungen mit Auswirkungen auf Wachheit und Bewusstsein: die Bedeutungen von „Koma“, „Wachkoma“, oder sogar dem „Hirntod“ werden vermischt oder verwechselt. Neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung stellen einige Inhalte der bisherigen Konzepte von Schlaf, Narkose, Koma und Wachkoma in Frage und werden in einem Überblick erläutert. Befunde, die darauf hindeuten, dass bei schwerer Hirnschädigung trotz fehlender Reaktion noch „Reste“ von Bewusstsein im Gehirn verborgen sein könnten, haben enorme ethische Implikationen beispielsweise auf die Frage der Einstellung der künstlichen Ernährung (z.B. „Fall“ Terry Schiavo 2005) und werden kontrovers diskutiert." |
Ein klarer, informativer und verständlicher Vortrag zu den ganz harten Bewusstseinsthemen. Ende 15.56. 8 Fragen wurden gestellt. Die erste Frage betraf Motivationsarbeit und Behandelbarkeit. Die Möglichkeit, im künstlichen Koma, das Schmerzgedächtnis zu löschen, wird mit "schwierig" bewertet. Ob man in der Narkose etwas mitbekommen kann, wie man immer wieder mal höre, hänge davon ab, wie intensiv die Narkose sei. Ja, es gibt vielleicht Teilbereiche, die "wach" sind. Es sei sehr selten, dass Patienten noch Schmerzen hätten (oft werden mit der Narkose auch Schmerzmittel gegeben). Es folgten noch Fragen zu Demenzkranken, zur retrograden Amnesie und zum Locked-in-Syndrom. Ende 16.35
15:30-16:00 Pause (Kaffee, Tee, Mineralwasser inkl.)
PD Dr. Ursula Voss
(16:00-16:45)
Traum und Bewusstsein Wieviel Selbst steckt im Traum? [PDF]
| Zusammenfassung:
"Geschichten und Bilder, die unser Gehirn nachts während des sogenannten
Rapid-Eye-Movement-Schlafs generiert, sind meist bizarr und befremdlich.
Zugleich fühlen sie sich jedoch auch vertraut an. Wir wissen während
des Traums, von wem wir gerade träumen, und doch sieht der/diejenige
ganz anders aus als in Wirklichkeit. Wir erkennen die Umgebung, in der
wir uns befinden, obgleich wichtige Elemente fehlen oder verändert
sind. Unser Handeln im Traum stellen wir nicht in Frage, trotz offensichtlichem
Mangel an Logik und Moral. So ist es beispielsweise nicht ungewöhnlich,
dass wir im Traum Dinge miteinander verknüpfen, die Jahrzehnte auseinander
liegen. Auch sind viele Träume aggressiven Inhalts. So werden wir
ebenso scheinbar grundlos von Angreifern oder Ungeheuern bedroht wie wir
ohne Reue oder schlechtes Gewissen Anderen Gewalt antun. Typischerweise
fragen wir nachts nicht nach dem „Warum“.
Diese Frage stellen wir erst nach dem Erwachen. Trotz der meist nur bruchstückhaften Erinnerung versuchen wir, Sinn in dem intensiven Traumgeschehen zu finden und den Trauminhalt auf unser Wachleben zu projizieren. Dahinter steckt oftmals der Wunsch, mehr über uns selbst in Erfahrung zu bringen als uns dies mithilfe der Reflexion möglich ist. Auch fürchten manche, dass Träume prophetischen Charakter haben könnten. Eine Voraussetzung dafür wäre, dass Träume einzigartig sind. Eine andere wäre, dass sie uns spiegeln, dass Veränderungen an unserem Selbst im Traum manifest werden. Stimmen diese Annahmen mit wissenschaftlichen Untersuchungen überein?" |
Beginn 16.39. Kinder träumen mehr als Erwachsene. Grundfragen betreffen
die Symbolik, Problematik, Bedeutung (Kontinuitäts-, Diskontinuitätshypothese)
und luzide Träume, d.h. das Wissen im Traum, dass ich träume
und Einfluss nehmen kann. Der Vortrag behandelte nur REM-Schlaf-Träume
und luzide Träume, nicht NREM (Tiefschlaf). Voss berichtete von ihren
aktuellen Forschungen* zur Unterscheidung von REM-Schlaf-Träumen
und luziden Träumen, von denen sie sich wichtige Erkenntnisse auch
für das Wach-Bewusstsein erhofft. Hierbei nutzte sie Faktorenanalysen,
die bei der ersten explorativen 8 Traum-Faktoren ergaben und die in einer
zweiten konfirmatorischen "validiert" wurden: Einsicht, Kontrolle, Denken,
Realismus, Gedächtnis, Dissoziation, negative und positive Emotion.
Das sind allerdings nur Benennungen oder Namensgebungen von Faktoren. Eine
der interessantesten Grundfragen, wieso können manche luzid träumen,
andere nicht, wartet noch auf ihre Antwort, wobei die vorgestellten Untersuchungen
und Methoden hoffen lassen. Aber auch hier fällt auf, dass klare Definitionen,
etwa wann genau ein Traum ein luzider genannt werden soll oder darf, Mangelware
sind. Muss das luzide Traum-Bewusstsein, ich weiß, dass ich träume,
ständig gegeben sein, genügt es einmal oder zwei Mal, wie lässt
es sich prüfen?
Der Vortrag endet mit einem wichtigen Fazit:
Träumen ist lebenswichtig, aber ist scheint nicht so wichtig, was
wir träumen, sondern dass wir träumen.
Ende 17.20, 7 Fragen wurden gestellt. Zunächst
zur Bewertung des luziden Träumens, das kurzfristig kein Schaden sei.
Die Interpretation von immer wiederkehrenden Träumen sei nicht so
gewichtig. Ja, das EEG erlaube keine Untersuchung tieferer Traumschichten.
Vorsatzträumen gelinge höchstens teilweise. Es kam noch das spezifische
"Traum-Selbst" und zeitverzerrtes Träumen zur Sprache. Bei Nachtdiensten
käme wahrscheinlich der REM-Schlaf zu kurz, schwieriger sei hier ein
ständiger Wechsel. Das Thema Umspeichern schloss ab. Ende 17.38
| Grundfragen
der Bewusstseins- und Traumbewusstseinsforschung
Die grundlegenden und jedermann bekannten Bewusstseinszustände sind: Wach, Schlaf, Traum, Abwesend (Trance), Bewusstlos. Die neurowissenschaftliche Bewusstseinsforschung sollte ihren Ansprüchen nach in der Lage sein, Kriterien - nicht wissenschaftliche sondern auch praktische - für diese verschiedenen Bewusstseinszustände anzugeben und idealiter natürlich für weitere Differenzierungen. Eine praktische Leitlinie bietet die Glasgow-Coma-Scale (GCS): [Notmed.info]. Die grundlegenden wissenschaftlichen und praktischen Fragen sind (Sonder- und Grenzzustände ausgenommen):
|
Dr. Jennifer Windt
(16:45-17:30)
Träume, Bewusstsein und das Selbst Eine Analyse aus Sicht
der Philosophie des Geistes [PDF]
| Zusammenfassung:
"Warum sind Träume aus Sicht der Philosophie des Geistes interessant?
Was genau heißt es eigentlich, Träume als bewusste Zustände
zu bezeichnen? Und welche Rolle kommt dem Selbst-Erleben im Traum bei der
philosophischen Beschäftigung mit dem Selbstbewusstsein zu?
Träume werden oft als Kontrastbedingung für allgemeine Bewusstseinstheorien bezeichnet: Im Traum entsteht subjektives Erleben unter völlig anderen Bedingungen als im Wachzustand. Daher kann der Vergleich zwischen Traum- und Wachbewusstsein existierende Theorien bereichern, aber auch zu einer Kritik an ihnen führen. Um dieses Projekt sinnvoll verfolgen zu können, benötigt man jedoch zunächst ein begriffliches Modell zur Beschreibung der Inhalte des Traumbewusstseins selbst. Ich werde in meinem Vortrag dafür argumentieren, dass die Beschäftigung mit dem Selbst-Erleben im Traum den Schlüssel für ein neues begriffliches Modell des Traums, aber auch des Selbstbewusstseins darstellt. Anhand von Beispielen aus der empirischen Traumforschung werde ich aufzeigen, welche verschiedenen Formen des Selbst-Erlebens sich im Traum unterscheiden lassen und warum dies wichtige Konsequenzen für philosophische Theorien der Subjektivität und des Selbstbewusstseins hat." |
Beginn 17.39. Die Zusammenfassung klang sehr vielversprechend und der
Vortrag begann mit Descartes quälender Frage, wie er wachen und träumen
unterscheiden könne (Meditationen 1.7). Nach einigen Ausführungen:
Was macht virtuelle Realität zu erlebter, zu hier-und-jetzt-Erleben?
Ende 18.20.
8 Fragen wurden gestellt. Ob man träumen könne,
dass man träume, hänge vom Traumbegriff ab. Wir haben auf jeden
Fall ein bewegtes Selbst (Frage: motorisches Selbst). Fast alle Säugetiere,
auch Vögel, hätten einen REM-Schlaf. Schlafwandel (als eigener
Bewusstseinszustand) sei wenig erforscht. Mit Hypnose kenne sie sich nicht
so gut aus. Weitere Themen "Kopiergerättraum" (2005), Qualitätsproblematik,
Soldaten (Traumatisierte), Rettungssanitäter, logisches Denken im
Traum, falsches Erwachen. Ende 18.46.
- Limbische Begegnung
von „Ich“ und „Du“ (ab 17:30)
| Bewusstes „Come together“ bei einem Glas Wein und Gesprächen mit Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern |
„Selbst in Aktion“ Erleben, Staunen und Be-greifen in der Hands-on-Ausstellung tourdersinne im Foyer der Stadthalle Fürth
(abends):
| Zusammenfassung:
"Eine der bedeutendsten Erfahrungen im Leben eines Menschen ist das Erlebnis,
dass wir uns täuschen können. Verblüffende Wahrnehmungstäuschungen,
erstaunliche Effekte und faszinierende Illusionen machen Mechanismen erlebbar,
mit denen unser Gehirn ein plausibles Abbild unserer Umgebung (re-)konstruiert,
ohne dass uns dies bewusst wird. Dabei wird deutlich: Wahrnehmen ist ein
aktiver Prozess und wird von etlichen Faktoren, etwa individuellen Erfahrungen,
unbewussten Erwartungen und explizitem Vorwissen, beeinflusst.
Die mobile „Hands-on“-Ausstellung „tourdersinne“ macht zahlreiche dieser Phänomene erlebbar. In den vergangenen fünf Jahren hatten über 50.000 Besucherinnen und Besucher in Deutschland und Österreich Gelegenheit, mit den Effekten zu experimentieren. Erstmals wird nun eine größere Auswahl von Exponaten aus der „tourdersinne“ auch beim Symposium präsentiert: Zum Ausprobieren und Verweilen, zum Verblüffen und Diskutieren, zum Erleben, Staunen und Be-greifen." |
Sonntag, 6. Oktober 2013 08:30-09:00 Empfang
Prof. Dr. John Dylan Haynes
(09:00-09:45)
Das Ich im Hirnscanner Fakt und Fiktion beim Auslesen (un-)bewusster
Gedanken [PDF]
| Zusammenfassung: "Die Möglichkeit, die Gedanken einer Person zu lesen, hat Menschen seit alters her fasziniert. Mit modernen Hirnscannern, den Kernspintomographen, ergibt sich nun die Möglichkeit zu einem direkten Blick ins Gehirn. Computer können dazu trainiert werden, mit einer beachtlichen Genauigkeit die Gedanken einer Person aus ihrer Hirnaktivität zu entschlüsseln. Obwohl die Auflösung der Hirnscanner begrenzt ist, können sogar unbewusste Denkprozesse und freie Entscheidungen aus den Hirnaufnahmen ausgelesen werden. Allerdings ist diese Forschung vom echten Gedankenlesen noch weit entfernt. Das wichtigste Problem ist, dass wir erst noch lernen müssen, die Sprache des Gehirns, den Gedankenkode, zu verstehen. Viele Fragen stellen sich: Ändert sich der Gedankenkode im Laufe des Lebens oder von Person zu Person? Was passiert, wenn sich verschiedene Gedanken in unserem Gehirn überlagern? Wie kann man die komplexe Sprache menschlicher Gedanken prinzipiell durch Hirnprozesse erklären? Und sollte man – aus ethischen Gründen – überhaupt den Blick in das Gehirn wagen, und damit die geschützte mentale Privatsphäre betreten?" |
Beginn 9.02. Als eines der wichtigsten wissenschaftlichen Kriterien
und Härtetest für das Niveau einer Theorie gilt die Vorhersagbarkeit.
Wenn man hier auch noch weit entfernt ist, gelingen inzwischen doch schon
erstaunliche und beeindruckende Trefferquoten (bis zu 75%, z.B. bei Autowahlen)
bei der Bedeutungsauslesung von Mustern. Denn die Auflösung der allgemeinen
operationalen Messgröße, Änderung des Sauerstoffgehaltes
des Blutes, ist nicht sehr hoch, die Muster entsprechend grob. Dennoch,
der Weg zur universellen Gedankenlesemaschine ist beschritten. Für
manche eine Horrorvorstellung, für die Neurowissenschaft zunächst
mal eine Herausforderung, wobei die ehtische Problematik gesehen wird:
sollen wir alles tun dürfen, was wir können oder können
würden, wenn ...? Für neue Gedanken kann man das Prinzip der
Ähnlichkeit nutzen, eindrucksvoll vorgeführt für das Muster
Motorrad, zusammengesetzt aus dem Muster Auto und Fahrrad.
Eine wichtige Haupterkenntnis: Das Gesamtmuster
kodiert die Bedeutung. Und hierbei spielt die Mustererkennungssoftware
(Fingerabdruckerkennung) eine große Rolle, wobei man an psychologische
Grenzen stoße. Die Freud'sche Eisbergmetapher für die Verhältnisse
Bewusstsein-Nichtbewusstes, ohne ihn zu erwähnen, wurde aus Sicht
der Hirnforschung bestätigt. Das meiste spielt sich im Nichtbewussten,
im Verborgenen ab.
Am Ende konnten 6 Fragen gestellt werden. Ob entscheiden
und entschließen unterschieden wird, blieb offen, wurde aber
für wichtig befunden. Ein Entschlusszeitvorlauf von 7 Sekunden
wurde als nicht zu lange angesehen (z.B. für die einfache Entscheidung,
einen Finger zu krümmen). Kritisch wurde die tote Lachs Studie
(> hanebüchene Hirnforschung)
angesprochen. Das sei natürlich totaler Käse. Fraglich sei, ob
die Chaostheorie das Gehirn gut beschreibe. Die 7 Sek. wurden mit dem Beispiel
des "Bombers der Nation" bezweifelt. Das Thema Ganzheit, u.a. das neuronale
Netz im Bauchraum, bildete den Schluss. Der Bauchraum sei schwer zu scannen,
alles (Wesentliche?) sei im Gehirn repräsentiert. Ende 9.50.
Prof. Dr. Dr. Brigitte
Falkenburg
(09:45-10:30)
Mythos Determinismus Wieviel erklärt uns die Hirnforschung?
[PDF]
| Zusammenfassung: "Die Ansätze der Hirnforscher, unser Bewusstsein und seine kognitiven Leistungen zu erklären, stammen aus dem Methodenarsenal der Physik, Chemie und Biologie. Doch die dort üblichen Schlüsse vom Ganzen auf seine Teile und zurück oder von Wirkungen auf ihre Ursachen und zurück stoßen hier auf ihre Grenzen. Das Bewusstsein ist kein Teil des Gehirns; und wie es durch die neuronalen Aktivitäten im Gehirn erzeugt wird oder umgekehrt auf diese zurückwirken mag, ist unbekannt. Die „mechanistischen“ Erklärungen der Neurobiologie führen hier so wenig weiter wie der Informationsbegriff; die Information, die das neuronale Netz in unserem Kopf prozessiert, ist ja nicht unbedingt dasselbe wie die Information, die wir bewusst verstehen. Die Behauptung, unser Bewusstsein sei durch neuronale Prozesse verursacht oder determiniert, hält den Ansprüchen an eine stringente wissenschaftliche Erklärung nicht stand. Was taugen also die Modelle des Bewusstseins, die auf den bewährten naturwissenschaftlichen Methoden beruhen, aus der Sicht der Wissenschaftsphilosophie? Und was lässt sich aus ihnen über das Selbst oder das Ich lernen?" |
Diese Zusammenfassung machte neugierig, wobei sich mit dem Titel bereits
ankündigte, das da ein Kant'scher Knüppel ausgepackt wird, der
nicht viel übrig lassen könnte von der Hybris einiger - natürlich
nicht aller - Hirnforscher. Der Vortrag war in vier Teile gegliedert: Methoden,
Mechanistische Erklärung, Neuronale Mechanismen, Erklärung des
Bewusstseins. Das Kernproblem, der Überstieg von der Materie zum Geist
gestaltet sich hierbei schwierig und ist bislang nicht geglückt. Es
fehlt allenthalben an klaren Begrifflichkeiten (und Brückenbegriffen),
Grundlagen wie gemeinsamen Messgrößen, Nichtvermischen der Methoden
und Prinzipien (strikt, Determinismus, Kausalität). Während die
klassische und die Quantenphysik über gemeinsame Meßgrößen
verbunden sind, fehlt bislang eine solche Verbindung für Materie und
Geist, Neuronen und Bewusstsein, Gehirn und Erleben. Fazit:
Wir wissen nicht, was Bewusstsein ist. Ende 10.30
4 Fragen konnten gestellt werden. Codierungsthema:
Ein Computer könne nicht symbolisch denken. Phasenübergang sei
auch nur ein metaphorischer Begriff. Gemeinsames Neuronenfeuern (Singer)
als Basis als Übergang zu den Qualia (Erlebensinhalten) erkläre
es auch nicht. Es fehle an gemeinsamen Messgrößen. Der 2. Hauptsatz
der Thermodynamik sei nichtdeterministisch, Geist und Materie inkommensurabel.
Ende 10.40.
10:30-11:00 Pause (Kaffee, Tee, Mineralwasser inkl.)
Prof. Dr. Dr. h. c.
Norbert Bischof
(11:00-11:45)
Ignoramus – et ignorabimus? Warum das Leib-Seele-Problem noch
längst nicht gelöst ist [PDF]
| Zusammenfassung: "Neben quantenmechanischen und relativistischen Effekten ist auch die Beziehung zwischen Materie und Bewusstsein ein Problemfeld, auf dessen Klärung niemals ein Selektionsdruck lastete, sodass sich für seine Behandlung keine anschaulich plausiblen Denkkategorien ausgebildet haben. Im Unterschied zur Physik, die aus dieser Mangelsituation die theoretischen Konsequenzen gezogen hat, beharren Hirnforscher bisher darauf, das Leib-Seele-Problem in der naiv-evidenten Kategoriensprache der klassischen Physik zu diskutieren. Auf diesem argumentativen Niveau können essentielle Fragen aber noch nicht einmal gestellt, geschweige denn beantwortet werden. Der Vortrag wird einige dieser Problemfelder umreißen und insbesondere die Frage aufwerfen, ob eine Psychophysik, die das Bewusstsein als Epiphänomen neuronaler Prozesse beschreibt, eine unzulässige Gleichsetzung physikalischer und phänomenaler Zeit zu vermeiden vermag." |
Beginn 11.10 Zunächst wurden die großen Leib-Seele-Theorien
der Geistesgeschichte erwähnt: Wechselwirkung (Descartes), Parallelismus
(Leibniz), Identität (Spinoza). Es gibt keine Funktion des Bewusstseins,
nur das NCC (neuronal correlation consciousness).
Bischof kritisiert die Inanspruchnahme des Informationsbegriff, der sei
in der Informationstheorie (Shannon) formal definiert und habe keinen (semantischen)
Inhalt. Diese Theorie sei ein Etikettenschwindel. Tononi beschreibe den
Container (>phi), nicht den Inhalt. Die
Grundfrage, wie kommt die Bedeutung in die Welt, ist nicht geklärt.
Die formale Informationstheorie als Erklärung für die Semantik
der mentalen Vorgänge sei nicht hilfreich. Ausführungen
zur Zeit, Struktur und Gestalt, Stoff und Form, Materielles und Essenz.
Die Willensfreiheit sei wie ein Quantensprung (Pascal Jordan).
Fazit: Das ignoramus
habe bisher nichts von seiner Gültigkeit eingebüßt.
Ende 11.58. Drei Fragen: Unter Bezug auf Kanitscheider,
ob die Quantenphysik eine Rolle spiele: wir wüssten nicht, welche
Physik im Gehirn gilt. Es sei sehr optimistisch, anzunehmen wir stünden
vor den Zeit der Quantenphysik. Die Begriffe Kohärenz, Beschränktheit
und Lokalität hängen zusammen.
Podiumsgespräch: Die Vermessung des Bewusstseins (11:45-13:00)
Auf dem Podium: Ansgar Beckermann, Norbert Bischof, Brigitte Falkenburg und John-Dylan Haynes.
Moderation: Helmut Fink, Referent für Wissenschaft und Philosophie beim turmdersinne.
| Zusammenfassung:
"Die Kluft zwischen Innen- und Außensicht der Geistestätigkeit,
zwischen 1. und 3.-Person-Perspektive, zwischen Ich-Erleben und Weltbeschreibung,
scheint unüberbrückbar zu sein. Die Reichweite naturwissenschaftlicher
Konzepte und Methoden ist dabei ebenso umstritten wie die Aussagekraft
der erzielten Messresultate.
Der kritische Dialog zwischen Hirnforschung und Philosophie dreht sich um neuronale Korrelate, mentale Verursachung, Grenzen des Reduktionismus, angemessene Sprachebenen – und letztlich immer auch um die Fortentwicklung des Menschenbildes im Zeitalter der Wissenschaft. Auf dem Podium wollen wir unterschiedliche Standpunkte aufeinander beziehen und den gegenwärtigen Stand der Erkenntnisse und Erwartungen zusammenfassen." |
Beginn 12.05. Fink gibt drei Themenbereiche vor: Zuständigkeit
und Reichweite, Tragfähigkeit und Methoden, Verlässlichkeit.
Wie soll man anfangen, es angehen? Vereinfachen, z.B. mit der Wahrnehmung,
lautet hier die philosophische Empfehlung. Es geht dann um den Stand der
Hirnforschung, um den Frust einerseits, den Fortschritt andererseits (Bewusstseinsinhalte
mit beachtlichen Wahrscheinlichkeiten auslesen können). Bischof wendet
sich vor allem sehr kritisch gegen einen formalistischen Informationsbegriff
(Shannon), der nichts bringe, wenn es um Bedeutung gehe. Heynes verweist
dagegen auf einen neuen, anderen Informationsbegriff, der aber bislang
offenbar noch nicht hinreichend erklärt werden kann. Ende 12.55
Die Vermessung des Bewusstsein war ein ebenso
anspruchsvoller wie auf der Tagesordnung stehender Titel. Denn, so Falkenburg,
ohne gemeinsame Meßgrößen wird es keine naturwissenschaftliche
Beschreibung und Erklärung der erlebten Bewusstseinsvorgänge
geben können. Das Überstiegsproblem vom Materiellen zum Erleben
(Geistigen) ist nach wie vor ungelöst. Leider ging es im Podiumsgespräch
genau um die Titelfrage der Vermessung des Bewusstseins so wenig, wie um
das subjektive Gehirn des ganzen Symposiums. Erste Ansätze in diese
Richtung berichtete Koch in Anlehnung an Tononi (2008).
Inzwischen erwägt man sogar, die physikalischen Grundgrößen
um das Mentale, um eine Erlebensgröße, zu erweitern. Besser
wäre wahrscheinlich erst mal, mit grundlegenden, standardisierten
und normierten Definitionen der Erlebensgrößen zu beginnen.
Hier könnten sich die PsychologInnen sehr nützlich machen, was
sie aber leider aus mir unbekannten Gründen nicht tun. Vom Bewusstsein
wird frei drauflos schwadroniert, wie es offenbar assoziativ aus dem Hirn
in sein jeweiliges Bewusstsein fällt. Ich kann mir nicht vorstellen,
wie aus einem solchen babylonischen Chaos eine naturwissenschaftliche Basis
entstehen soll.
Literatur (Auswahl) > Vorträge, Buchtipps vom turmdersinne.
Links (Auswahl: beachte)
- Überblick Eindrücke von anderen Symposien des Turms der Sinne.
- https://www.brain-map.org/
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
1) GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Brückenbegriffe Wissenschaftstheoretische Neuschöpfung mit dem Sinn zwei unterschiedliche Gebiete miteinander zu verknüpfen: Neuronales System => Information => Geist/ Erleben. Der Informationsbegriff bildet die Brücke, die die Lücke zwischen Materie und Geist schließen soll. Hierzu einige Beispiele aus Falkenburg (2012):
- S. 311: "Der Neurophilosoph Albert Newen betont, dass die interdisziplinäre Erforschung des Selbstbewusstseins auf Brückenbegriffe wie den Informationsbegriff angewiesen ist. [FN46] Nach Newen schlagen sie die Brücke zwischen philosophischen Begriffen wie dem des „Selbst“ und den Untersuchungen der Hirnforscher. Doch die Hirnforschung ist auch ohne Philosophie voller Brückenbegriffe, mit denen sie verschiedene Ebenen ihrer mechanistischen Erklärungen verzahnt. Sie haben eine ähnliche heuristische Funktion wie die semantischen Aspekte von Bohrs Korrespondenzprinzip – sie sollen die Erklärungslücken schließen, die sich bei rein formalen Analogien auftun. Newen hebt hervor, dass er die Verwendung von Brückenbegriffen „als eine eigene Form der Erklärung betrachtet“, die er wie folgt charakterisiert: [FN47]"
- S. 325: "Die kausalen Erklärungen der kognitiven Neurowissenschaft liefern keine ehernen, unausweichlichen Mechanismen. Sie bieten: ein dichtes Gespinst von kausalen Bedingungen, die aus der Neuropathologie stammen; schöne bunte Bilder von Hirnscans, die teils nach Reiz-Reaktions-Experimenten, teils nach Auskunft der gescannten „Gehirne“ bzw. Personen mit kognitiven Leistungen und mentalen Phänomenen korreliert werden; neuronale Mechanismen mit stochastischen Grundlagen; das hochgradig idealisierte Computer-Modell eines extrem komplexen Geschehens; und den Analogieschluss vom Rechenprozess im Computer auf die kognitiven Leistungen des Gehirns, der auf dem Zauberwort „Information“ beruht.
Bei alledem handelt es sich aber nicht um strikte wissenschaftliche Erklärungen mit mathematischer Präzision, sondern nur um ein lose gestricktes Muster partieller Erklärungen, das durch Brückenbegriffe, Analogien und riesengroßes Vertrauen in das Kausalprinzip zusammengehalten wird. Dieses Vertrauen in das Kausalprinzip kommt aber ohne einen klaren, eindeutigen Begriff der Kausalität daher. Das Buch Explaining the Brain von Carl F. Craver hat nicht zufällig den Untertitel mechanisms and the mosaic unity of neuroscience. Die Erklärungsleistungen der kognitiven Neurowissenschaft bilden ein lose verfugtes Mosaik von kausalen Bedingungen, stochastischen Mechanismen und Analogien mit begrenzter Tragfähigkeit."
Eindrücke
Eindrücke sind immer subjektiv. Niemand sollte dies besser wissen als ein Psychologe. Andere werden andere Eindrücke haben. Und natürlich fließen in Eindrücke auch Vorannahmen, Voreinstellungen, Vorurteile und Bewertungen ein. Dazu gehört, dass ich der modernen Hirnforschung und biologisch orientierten Neurowissenschaften kritisch gegenüberstehe. Da sind mir zu viel Oberfläche, Naivität, Optimismus und unangemessener Führungsanspruch am Werk. In meine subjektiven Eindrücke fließt also diese kritische Grundhaltung ein. Selbstverständlich verknüpfe ich mit meinen Eindrücken keinerlei Ansprüche oder Verbindlichkeiten. Und ich habe trotz Motivation und Anstrengung natürlich nicht alles bzw.- auch nicht alles richtig mitbekommen, so wie es vielleicht gedacht oder beabsichtigt war.
__
epigenetisch 1) Genetik/ Biologie: . [W] Waddington 1942. [W] 2) Störungsverlauf in Psychopathologie und Psychotherapie. > Epikritische Bewertung.
__
Faktorenanalyse (FA) dubiose Methode hauptsächlich der Psychologie. Explorative FA: erkundend, ohne spezifische - soweit nicht schon durch die Datenauswahl und das Forschungsinteresse eingegrenzt - Vorannahmen oder Hypothesen. Konfirmatorische FA: gezielte, hypothesenorientierte FA, z.B. einer ganz bestimmten Faktorenstruktur.
__
Hanebüchene Hirnforschung
- "HIRNSCANS UNTER BESCHUSS Von den bunten Bildern haben sich viele Forscher grundlegend neue Einsichten in den menschlichen Geist versprochen. Doch jetzt macht sich Ernüchterung breit. ... Was ein toter Lachs fühlt. Wie leicht sich statistische Fehler einschleichen können, hat Craig Bennett von der University of California in Santa Barbara mit einem besonders drastischen Beispiel illustriert: Er schob einen fast 50 Zentimeter langen und zwei Kilogramm schweren Lachs in einen Hirnscanner und zeigte ihm sechs Minuten lang Bilder von Menschen mit wütenden, angstvollen und fröhlichen Gesichtern. Tatsächlich maß der Scanner ein positives BOLD-Signal in einer bestimmten Hirnregion.
- "Stephan Schleim: "Die Neurogesellschaft - Wie die Hirnforschung Recht und Moral herausfordert", Heise Verlag, Hannover 2010, 204 Seiten. Der Psychologe und Philosoph Stephan Schleim fühlt der modernen Hirnforschung auf den Zahn. Studie um Studie nimmt Schleim unter die Lupe - aber statt wissenschaftlicher Sternstunden fördert er Hanebüchenes zutage.
- ""Studien nicht wiederholbar". Der Hirnforschung mangelt es an wissenschaftlichen Standards, kritisiert der US-Psychologe Joshua Carp. Viele Studien seien methodisch unzureichend oder wegen mangelnder Angaben schlichtweg nicht nachvollziehbar - und werden dennoch in prestigeträchtigen Magazinen publiziert. ... In seiner Meta-Untersuchung analysierte Carp rund 240 Artikel, die er nach dem Zufallsprinzip aus fast 1.400 Artikeln (entstanden zwischen 2007 und 2011) auswählte. Diese neurowissenschaftlichen Studien stammten aus 68 verschiedenen Journals, zu denen auch prominente Titel wie "PLoS One", "PNAS" oder "Journal of Neuroscience" zählen. Ob und wie viele Informationen über die Methode und das Vorgehen der Wissenschaftler veröffentlicht wurden, war sehr unterschiedlich.
- "Hirnforschung in den Medien. Heureka und Hurra statt kritischer Aufklärung. Über Spektakuläres aus den Neurowissenschaften wird regelmäßig berichtet. Journalisten machen dabei kleine Fehler. Viel mehr nervt aber, dass gerade deutsche Medien gute Gelegenheiten verpassen, den Neurohype kritisch zu hinterfragen. ..." [dg 25.9.12]
Das Problem: Der Lachs war längst tot, bevor er gescannt wurde – und seine „Hirnaktivität“ ein schlichtes Rauschen, das man nicht ordentlich korrigiert hatte. Bennett wollte seine Kollegen mit dem „Leichen-Scan“ vor einer lässigen Datenauswertung warnen. Denn seine Analyse neuer wissenschaftlicher Scan-Studien hatte ergeben, dass bei mehr als einem Fünftel die Korrekturverfahren nicht rigide genug waren. ..." [BdW 5, 2012]
Lachse reagieren auf den Anblick sozialer Situationen mit einer Aktivierung bestimmter Gehirnregionen. Das konnten US-Wissenschaftler mithilfe modernster Gehirnscanner zeigen. Das Forschungsergebnis hat nur einen Schönheitsfehler: Die unter den Scanner gelegten Lachse waren tot. ... "[dr 7.2.11]
"In mehr als einem Drittel der Studien wurde die Anzahl, die Dauer und die Abstände der Versuchsabläufe nicht beschrieben. In weniger als der Hälfte wurde die Anzahl der ausgeschlossenen Probanden angegeben oder die Gründe für den Ausschluss. Es wurde nicht gesagt, ob und wie Versuchspersonen für die Teilnahme am Experiment entschädigt wurden. Auch über die Auflösung, den genauen Untersuchungsbereich oder die Anordnung der Schichtbilder der fMRI-Untersuchung fehlten ausreichende Informationen", äußerte sich Jonathan Carp gegenüber dem "Research Digest" der British Psychological Society. ... " [ORF 24.9.12]
Precht, David (2007) Wer bin ich und wenn ja, wie viele? München: Goldmann, S. 71f:
"Zu den etwas seltsamen Vorgängen in der Hirnforschung gehört, dass manche Neurowissenschaftler zwar das Ich bestreiten, aber gleichzeitig untersuchen, wie es entsteht. Nicht selten ist das Ich der Lieblingsfeind im Labor, den man allerdings erstmal voraussetzen muss, um ihn bekämpfen zu können. So etwa können Hirnforscher genaue Angaben darüber machen, wie sich eine Persönlichkeit - mithin also das Ich - ausbildet. Schon im frühen Embryonalstadium entsteht das limbische System. Nach der Geburt tritt das Gehirn mit der Außenwelt in Kontakt und wird noch einmal völlig revolutioniert. Die Gehirnstrukturen passen sich an, sie verringern die Zahl der Nervenzellen und ummanteln dabei gleichzeitig die Leiterbahnen. Im Alter von 18 bis 24 Monaten bildet sich das »Ich-Gefühl« aus. Es ist die Zeit, in der Kleinkinder sich das erste Mal auf Fotos erkennen können. Und noch später entsteht die gesellschaftlich-juristische »Person«: das Ich als mehr oder weniger verantwortlich handelndes Mitglied der Gesellschaft. Manche dieser Fähigkeiten und Eigenschaften entwickeln sich im Gehirn erst während und nach der Pubertät. Alle diese Beschreibungen erklären die Entwicklung der Persönlichkeit und sind damit zugleich untrennbar verbunden mit dem Ich-Gefühl. Denn Personen sagen zu sich selbst »Ich«. Etwa die Hälfte dieser Persönlichkeitsentwicklung, so wird mehrheitlich angenommen, hängt sehr eng mit angeborenen Fähigkeiten zusammen. Etwa 30-40 Prozent ist abhängig von Prägungen und Erlebnissen im Alter zwischen 0 und 5 Jahren. Und nur 20-30 Prozent werden offensichtlich maßgeblich durch spätere Einflüsse im Elternhaus, in der Schule usw. beeinflusst.
Mit der Entzauberung des Ich ist es also so eine Sache. Als Kopernikus nachwies, dass sich die Erde um die Sonne dreht, entdeckte er eine zuvor unbekannte Tatsache. Die alte Vorstellung von der Erde als Mittelpunkt des Universums war definitiv falsch. Als Darwin nahelegte, dass sich alle Lebewesen aus primitiven Vorfahren entwickelt haben und auch der Mensch keine [>72] Ausnahme davon macht, beschrieb er ganz offensichtlich ebenfalls eine Tatsache. Die Annahme, dass der Mensch eine Sonderanfertigung Gottes sei, war definitiv falsch. Aber wenn Hirnforscher heute das Ich durchstreichen möchten, weisen sie nicht unbedingt eine neue Tatsache nach. Die alte Vorstellung, dass der Mensch von einem Supervisor namens Ich geistig zusammengehalten wird, ist nicht widerlegt. Dieses Ich ist eine komplizierte Sache, es lässt sich mitunter in verschiedene Ichs zerlegen, aber es ist gleichwohl so etwas wie eine gefühlte Realität, die sich naturwissenschaftlich nicht einfach erledigen lässt. Reicht denn nicht schon die Beobachtung aus, dass wir uns als ein Ich fühlen, um festzustellen, dass es ein Ich gibt? »Man ist Individuum«, schreibt der Soziologe Niklas Luhmann, »ganz einfach als der Anspruch, es zu sein. Und das reicht aus.« Den gleichen Satz könnte man wohl auch über das Ich sagen.
»Das Ich ist keine unveränderliche, bestimmte, scharf begrenzte Einheit« - mit diesem Satz hatte Ernst Mach Recht. Es sei denn, man erkennt im Gehirn eine Einheit und eine Begrenzung oder, wie mancher Hirnforscher gerne sagt, einen »Rahmen«. Doch dass unsere Empfindungen »allein in der Welt spazieren« gehen, ist eher unwahrscheinlich. Das Ich ist ein ziemlich aufmerksamer Kindergärtner, und meistens ist es beobachtend, mitfühlend und mehr oder weniger wachsam bei uns. Menschen haben keinen Kern, kein »wahres Selbst«, das man irgendwo absolut dingfest machen könnte. Aber das wäre, wie gesagt, wohl auch ein bisschen wenig. Denn die wahre Entzauberung wäre doch gewesen, einen Ich-Apparat zu finden, ihn den Philosophen vor die Nase zu legen und zu sagen: Hier, das ist es! Stattdessen haben wir ein schillerndes, vielschichtiges und multi-perspektivisches Ich. Denn die Hirnforschung beweist nicht, dass es kein Ich gibt, sondern dass unser gefühltes Ich ein unglaublich komplizierter Vorgang im Gehirn ist, so faszinierend, dass wir nach wie vor allen Grund haben, darüber zu staunen. Von der umfassenden Ergründung unseres »Ich-Zustandes« ist die Hirn[>73]forschung noch Meilen oder genauer: Jahrzehnte entfernt, falls sie es denn überhaupt je schafft. Denn wenn das Beobachten einfacher Emotionen die Mondlandung der Hirnforschung war, so ist die Reise zum Ich eine bemannte Fahrt mindestens zum Jupiter. Eine Reise, von der wir bislang kaum ahnen können, was uns dabei noch alles begegnet ... "
__
Voss U., Schermelleh-Engel, K., Windt, J., Frenzel, C. & Hobson, J. Allan (2013). Measuring Consciousness in Dreams: The Lucidity and Consciousness in Dreams Scale. Consciousness and Cognition, 22, 8-21. Mehr hier: https://user.uni-frankfurt.de/~voss/homepage/de-ger/publ.html
__
|
|
Standort: Turm der Sinne - Eindrücke vom Symposium 2013
*
Überblick Eindrücke von anderen Symposien des Turms der Sinne.
Übersicht Differentielle Psychologie und Psychopathologie der Persönlichkeit.
Psychopathographien von Herrschern (Überblick).
*
Suchen in der IP-GIPT mit Hilfe von Suchmaschinen, z.B. Google:
*
| <suchbegriff site:
www.sgipt.org> Beispiel: <Herrscher
site: www.sgipt.org>
Hier gibt Ihnen die Suchmaschine aus, auf welchen IP-GIPT Seiten der Suchbegriff "Herrscher" vorkommt. |
Dienstleistungs-Info.
*
Zitierung
Sponsel, R. (DAS). Bewusstsein – Selbst – Ich. Die Hirnforschung und das Subjektive. Eindrücke vom Symposium des Turms der Sinne 2013. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/diffpsy/ich/TdS2013.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffssaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet. Zitate und Links sind natürlich erwünscht. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Ende_Eindrücke vom Symposium 2013_Überblick_Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges _Titelblatt_Konzept_Archiv _ Region_ Service-iec-verlag_Mail:_sekretariat@sgipt.org_
korrigiert: 11./12.10.2013 irs
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
00.00.00