(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=23.05.2002 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung 18.8.7.
Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen _Zitierung & Copyright
Anfang_Alltag_Service_ Überblick_ Relativ Aktuelles_Rel. Beständiges Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region__Mail:_sekretariat@sgipt.org_ Wichtige Hinweise zu Links u. Empfehlungen
Willkommen in der Abteilung Allgemeine und Integrative Politische Psychologie, hier zum Bereich Ökologie, Ökopsychologie und politische Umweltpsychologie, hier speziell zum Thema:
Die Bausteine des Alltag
Zur Psychologie des menschlichen Arbeitens und Handelns
Ein Buchhinweis von Rudolf Sponsel, Erlangen
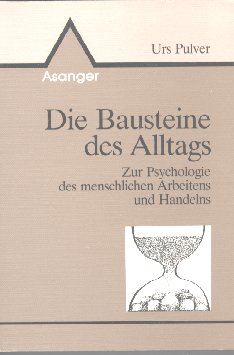 |
Pulver, Urs (1991). Die Bausteine des Alltags. Zur Psychologie des menschlichen Arbeitens und Handelns. Heidelberg: Asanger. |
A. Die Erforschung des Alltags
Kapitel 1 Zielsetzungen und Eigenart dieses Buches
1.1 Gegenstand, Leser und Autor
1.2 Vorbemerkungen zum Inhalt
1.3 Eigenart des Materials und seiner Gewinnung
1.4 Umstände der Entstehung
1.5 Empirie, Theorie, Literatur
Kapitel 2 Eine Erhebung über den beruflichen Alltag
2.1 Die Durchführung der Erhebung
2.2 Die Erhebungsgrößen
2.3 Individuen, Kategorien, Merkmale
2.4 Zusammenfassende Übersicht
2.5 Nicht-Erhobenes
2.6 Tun und Handeln im Ablauf der Zeit
B. Themen- Die Inhalte des Alltags
Kapitel 3 Der Begriff des Themas
3.1 Zugänge zum Themenbegriff
3.2 Abgrenzung von verwandten Begriffen
3.3 Der Themenbegriff in der Fachliteratur
3.4 Eigene Definition des Themas
Kapitel 4 Themen als reale Gegenstände in der Zeit
4.1 Die Realität der Themen
4.2 Zuwendungen, Aufgaben, Ziele
4.3 Grundriß eines Handlungsmodells
4.4 Gegenstände über Zeit
4.5 Zeitablauf und Wirklichkeit
4.6 Kriterien zur Erfassung von Themen
Kapitel 5 Die Vielfalt der Themenwelt
5.1 Einheit und Gliederung längerer Themen
5.2 Einmalige, sich wiederholende und unabschließbare Themen
5.3 Kurzzuwendungen und Sammelformen
5.4 Größere Themen-Komplexe
5.5 Sekundärthemen
Kapitel 6 Der thematische Aufbau der Arbeit
6.1 Hierarchie-Vorstellungen
6.2 Zielhierarchie und Tätigkeitsabfolge
6.3 Grenzen hierarchischer Anordnungen
6.4 Möglichkeiten der hierarchischen Darstellung
6.5 Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Themen
6.6 Das Modell der einheitsstiftenden Beziehungen
Kapitel 7 Die quantitative Erschließung des Themenbestandes
7.1 Zur statistischen Bearbeitung der Erhebungsdaten
7.2 Zahl und Dauer der Themen
7.3 Die innere Aufteilung der Themen
7.4 Die Erstreckung der Themen
7.5 Themen durch Jahr und Tag
7.6 Themen-Verbindungen
7.7 Drei Zusammenfassungen
C. Die Analyse komplexer Arbeitswelten
Kapitel 8 Kategorien und Grenzen beruflicher Arbeit
8.1 Zwei Dimensionen der Arbeit
8.2 Kategorisierung und Einzelfall
8.3 Themen und Arbeitsbereiche
8.4 Der Umfang der Arbeitswelt
8.5 Arbeit und Freizeit
Kapitel 9 Blick in eine individuelle Arbeitswelt
9.1 Das Aufgabenfeld
9.2 Verschiedenartigkeit der Arbeiten
9.3 Arbeitsvollzüge
9.4 Vollzüge und Arbeitsstruktur
9.5 Sozialwelt und Sozialkontakte
9.6 Soziale Gehalte der Arbeit
D. Die Struktur des Tageslaufs
Kapitel 10 Methoden zur Gliederung zeitlicher Abläufe
10.1 Die Zeit und ihre Gliederung
10.2 Abschnitte im Verhaltensstrom
10.3 Einheiten und Abschnitte im Erlebnisstrom
10.4 Möglichkeiten und Grenzen der Erfassung von Abschnitten
10.5 Konsequenzen der Erfassungsgrenze
10.6 Einheiten und Abschnitte des Arbeitstages
10.7 Einheiten, Abschnitte, Themen - Bausteine des Alltags
Kapitel 11 Die Analyse der Tagesstruktur
11.1 Grunddaten aus der Erhebung
11.2 Tagesstrukturen
11.3 Die Zerhackung des Arbeitstages
11.4 Versuch einer Zerhackungsanalyse
11.5 Grundmuster des Tagesaufbaus
11.6 Ablaufmuster, Zerhackung und Tagesstil
Kapitel 12 Struktur, Methode, Entwicklung
12.1 Der Wechsel des Erfassungsrasters
12.2 Die Differenzierung der Beobachtung
12.3 Zusammenschau und Realität
12.4 Entwicklung und Tagesstruktur
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Namenregister
Sachregister
Zusammenfassung
"(Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Kapitel und Unterkapitel, in denen der betreffende Gegenstand ausführlich behandelt wird.)
Vielschichtigkeit von Fragestellung, Berichterstattung und Gegenstand
Dieses Buch handelt vordergründig vom Problem und von der Problematik der Zeitverwendung im (beruflichen) Alltag und ist vor allem aus einem Unbehagen an deren geringer Durchschaubarkeit und Meisterung entstanden (1.1) Aber ein jahrzehntealtes theoretisches und praktisches Interesse an Fragen des Tageslaufes und des menschlichen Handelns hat dazu geführt, daß eine ursprünglich ganz banale Zeiterhebung zu einem differenzierten Instrument ausgebaut und über mehrere Jahre durchgezogen (2.1), vielfältig analysiert und ausgewertet (2.4) und für das Verständnis von Grundfragen menschlichen Erlebens fruchtbar gemacht wurde. In unserer Berichterstattung, die sachlichen und übermittlungstechnischen Gesichtspunkten folgt, werden Darlegungen über die angewandte Methode, über Ergebnisse im konkreten Einzelfall und über gewonnene Erkenntnisse von allgemeiner Bedeutung durchmischt dargeboten und gehen stets Hand in Hand mit grundsätzlichen Erwägungen über die behandelten Phänomene, welche immer auch die Mehrschichtigkeit der Begriffe und Gegenstände nachzuweisen versuchen (1.2). In der hier zu präsentierenden Zusammenfassung werden die genannten Aspekte jedoch auseinandergehalten.
Das vorliegende Werk ist kein Lehrbuch über die Zeitverwendung und enthält kaum praktische Tips. Es will vor allem zum Nachdenken über den eigenen Alltag anregen (1.2) und allenfalls ermuntern zur do it yourself Forschung (1.1). Das scheint wichtig in einer Zeit esoterischer Wissenschaftsauffassung. Die berichtete Untersuchung entspricht keineswegs dem Kanon gegenwärtigen Forschens und verletzt eine ganze Reihe heute heilig erklärter Regeln (1.3). Dafür weiß sie sich verbunden rnit Anliegen und Vorgehensweisen vieler Praktiker wie auch aufgeschlossener und "alternativ" denkender Theoretiker (1.5).
Grundsätzliche Überlegungen
Die vielen Gesichter der Wirklichkeit. Unsere Realität ist sehr komplex. Über den vertrauten Gegensatz von "erlebter" und (wissenschaftlich) "erschlossener" Wirklichkeit hinaus gibt es eine "unmittelbare" Realität der Sinneseindrücke sowie verschiedene Schichten "konstruierter" Wirklich- [<721] keit; und "gemeinsame" unterscheiden sich von privaten Realitäten Die Tatsache, daß Realität nicht nur an uns herangetragen, sondern durch die Art und Weise, wie wir sie erfassen, von uns immer auch mitgestaltet wird, gehört zu den Selbstverständlichkeiten einer Wirklichkeitslehre und macht den Realitätsbegriff nicht suspekter, sondern reicher und interessanter (4.1). Das gilt vor allem für die weniger lapidaren "Gegenstände" geistiger und psychischer Natur, die unser Studienobjekt bilden (3.1); und besonders deutlich zeigt es sich beim Ordnen unserer Welt in Kategorien (8.3) so wie bei der Bildung von Einheiten aus amorphen oder unscharf abgegrenzten Phänomenen, vor allem solchen, die sich über längere Zeit erstrecken und Wandlungen durchmachen (4.4). Im letzten Falle können und müssen wir zwei recht verschiedene, zeitweilig koexistierende Wirklichkeiten ablaufender Prozesse unterscheiden: die (erlebte) Wirklichkeit des im Gangc befindlichen Geschehens selber, die meist auch den Charakter der "Verwirklichung" trägt, und die (teilweise konstruierte) Wirklichkeit des - verarbeiteten und eingeordneten, "Geschichte" gewordenen - Geschehenen. Dieser Doppelcharakter der Realität ablaufender Ereignisse ergibt sich aus der Natur unseres Handelns, Erlebens und Denkens (4.5).
Die Geheimnisse des Zeitablaufs. Eine natürliche,
aber sehr schwer zu fassende Realität des Menschen ist die Zeit. Die
Wirklichkeit des Seienden scheint an dessen Gegenwärtigkeit gebunden;
für real hält man, was jetzt da ist. Aber Gegenwart gründet
weder in einem (zeitlosen) Jetzt-Punkt noch in einem willkürlich abgrenzbaren
"Präsenzbereich", sondern in dem oder den jetzt eben im Gang befindlichen
Prozeß oder Prozessen (4.5). Bei solchen Prozessen bilden sich, zwischen
den durch größere und raschere Umstellungen gesetzten Grenzen,
relativ konstante Abläufe heraus (10.2) und erzeugen das Erlebnis
unterschiedlich ausgedehnter "Gegenwarten" (10.3), die sich, je nach Beobachtungsdistanz
und Fokussierung, in verschiedenen Wirklichkeitsschichten übereinanderlegen
(12.3). Das gilt nicht nur für das Erfahren des eigenen Erlebnisstroms,
sondern auch für das Erfassen des Verhaltensstroms anderer. Beide
"Ströme" werden durch Stabilisierungen und Wechsel in natürliche
Abschnitte gegliedert (10.2/3).
Zeit ist meßhar. Die Basis für die Entwicklung
von Maßeinheiten bilden zwei geophysische Grundelemente, der Tag
und das Jahr. Alle übrigen Einheiten sind willkürlich festgelegt
worden, haben aber - wie vor allem Stunde und Woche - eine massiv sozialisierende
Wirkung erzielt. Dabei lassen sich Messungen absolut oder relativ durchführen.
Alles, was geschieht, beansprucht - unabhängig vom "Zeitpunkt" des
Geschehens - ein bestimmtes Quantum Zeit (Zeit als "Stoff"); es liegt aber
auch fixierbar auf einem universell koordinierten Zeitstrahl (Zeit als
"Rahmen") (10.1). Als Maßeinheit benützen wir in diesem Buch
vorzugsweise eine neu gebildete Größe, die Fünfminutenspanne
(bezeichnet mit D) und ihr Hundertfaches, den "Normalarbeitstag" zu 500
Minuten (bezeichnet als AT) (2.6). [<722]
Der Unterschied zwischen Tun und Handeln.
Hält man sich an den Zeitstrahl und reiht die sich abfolgenden Tätigkeiten
des Menschen aneinander, so erfaßt man dessen unmittelbares "Tun",
den Direktkontakt (oder "Bodenkontakt") mit der Welt (2.6). Dabei lassen
sich allerdings verschiedene Ebenen unterscheiden (6.2); sie reichen von
den Basishandlungen bis zu komplex aufgebauten instrumentellen Ausführungstätigkeiten,
die wir als "Vollzüge" bezeichnen und untersuchen (9.3). Daneben hat
(fast) jedes Tun eine zweite Dimension: es steht in einem inhaltlichen
Zusammenhang; es "geht" ihm um etwas (8.1). Dieser Zusammenhang ergibt
sich aus der Sache, der man sich zuwendet (3.1); sehr oft besteht er in
der beabsichtigten Einflußnahme auf den Gang der Dinge; dann sprechen
wir von "Handeln". Oft bindet er - durch Planung, Absichten, Wiederaufnahmen,
Ergebnisse, Folgen - zeitlich Auseinanderliegendes zu (diskontinuierlichen)
Einheiten (und damit zu weiteren Klassen von "Gegenwarten") zusammen (2.6;
10.3).
Handeln gehört zu den stabilisierenden Elementen
im Zeitablauf. Zwar ist jedes Tun stets Ablenkungen von innen und außen
her ausgesetzt (12.3). Aber schon das Kind versucht bald einmal, bei einer
angefangenen Sache zu bleiben, sie gegen Unterbrechungen zu verteidigen
und später zu ihr zurückzukehren; und daraus entwickelt sich
die gegliederte Handlung Erwachsener (12.4).
Das Handeln wurde von der Psychologie jahrzehntelang
kaum beachtet; nun erlebt es, seit etwas über zehn Jahren, einen Boom
(1.4). Dabei fahren sich die Theoretiker allerdings gerne in zwei Verallgemeinerungen
fest. Einmal unterlegen sie jedem Handeln ein "Ziel" im Sinne eines antizipierten
und angestrebten Endzustandes. Es läßt sich aber zeigen, daß
es viele andere Formen des Handelns gibt (4.2). Wenn schon, so möchten
wir den Zielbegriff breiter definieren als jenen gewünschten Verlauf
der Dinge, zu dessen Realisierung eigenes Mitwirken erforderlich scheint
(4.3). Die zweite Verallgemeinerung besteht in der Vorstellung, alles menschliche
Handeln sei hierarchisch organisiert (6.1). Nach unseren Beobachtungen
erweist auch sie sich als voreilig (6.3). Und (finale) Zielhierarchien
müssen wo es sie gibt - erst noch vom kausal-hierarchisch verketteten
Ausführungsgeschehen abgehoben werden (6.2).
Eine Untersuchung über den beruflichen Alltag
Erhebung. Berufsmann P. hat während mehr als drei Jahren seine eigene Person als "tragbare", omnipräsente Feldstation benutzt und alles registriert, was er - beruflich und paraberuflich - getan hat (1.3). Diese Erhebung und ihre Auswertung wurde als Ein-Mann- und als Ferien- und Wochenend-Job durchgezogen (1.4). Jedesmal, wenn P.'s Arbeit wechselte (ihr Inhalt oder die Vollzugsart, allenfalls auch die Kontaktperson), hielt er das eben Abgeschlossene auf einem Formular fest (2.1). Dabei benutzte er [<723] einen Fünfminutenraster: es wurden nur Arbeiten bzw. Einheiten von rund fünf Minuten oder einem Mehrfachen davon festgehalten und auf fünf Minuten genau auf dem Zeitstrahl lokalisiert (10.4). Handlungsort und allfällige Kontaktpersonen wurden ebenfalls registriert; bei den letzten erzeugten Gruppen sowie "anonym" bleibende Partner und Partnerinnen gewisse Schwierigkeiten (9.5). Zudem wurden eine Reihe dynamischer Größen (insbesondere arbeitsauslösende Faktoren und vorgesehene Arbeiten) erhoben, in diesem Buch aber noch nicht ausgewertet (2.1/2); jedoch unterblieben alle Beurteilungen der Arbeit (2.5). Da Vollständigkeit, Ablauftreue und hinlängliche Meßgenauigkeit angestrebt wurden, war ständige unmittelbare Registrierung unerläßlich; auf das Gedächtnis wurde möglichst wenig rekurriert (10.3). Kamen zwei Arbeiten in raschem Wechsel zur Ausführung, so vermerkte P. "parallel" laufende Einheiten (10.5); diente ein und dieselbe Tätigkeit zwei verschiedenen Themen (5.5) oder wurden zwei Vollzüge gleichzeitig ausgeführt (9.4; 12.3), so unterschied P. "primäre" und "sekundäre" Tätigkeiten.
Auswertung. Einige der Erhebungsgrößen wurden zu Gegenständen detaillierter Auszählung und ausführlicher Untersuchung (2.4). Über den Sinn solcher Auswertungen eines Einzelfalles haben wir uns wiederholt Gedanken gemacht (1.3; 7.0; 11.1). Da auf EDV verzichtet werden mußte (1.5) konnten für die Auszählungen - mit einer Ausnahme - nur Zeitausschnitte (der größte, sich über 476 Kalendertage erstreckende als "Vollerhebungszeit" bezeichnet) oder Stichproben benutzt werden (7.1). Vereinzelt wurden aus dem Primärmaterial sekundäre Datensammlungen (in der Forn von Registern und Karteien) herausdestilliert (2.1). Die Auszählergebnisse wurden jeweils, größerer Aussagekraft und künftiger Vergleichbarkeit zuliebe, umgerechnet auf Werte pro "Normalarbeitsjahr", pro "Arbeitsverpflichtungszeit", pro "durchschnittlichen Wochentag" u.ä. (7.1). Der durchgeführte Vergleich zwischen den Ergebnissen zweier längerer Zeitausschnitte erwies eine erstaunlich gute Übereinstimmung (7.7).
Allgemeine Befunde
Der Tageslauf und seine Struktur. Wie fein die Struktur des Tageslaufs
erfaßt werden soll und kann, bestimmt man mit der Wahl des Beobachtungsrasters.
Durch Rasterwechsel verändert sich in gewissem Ausmaß das qualitative
Bild des Tages; aber die Grundelemente der Strukturbildung bleiben sich
bei jeder Erfassungsschwelle gleich (12.1-3). So wird es beispielsweise
nie zu vermeiden sein, daß natürliche Einheiten, die kürzer
sind als die Zeitspanne der Erfassung, als solche untergehen; sie werden
zusammengezogen zu größeren "Mischeinheiten" (10.5). Je gröber
der Raster, desto größer der Anteil undifferenziert erfaßter
Tätigkeitsperioden (12.1). Die homogenen Einheiten von mindestens
fünf Minuten Dauer - homogen punkto Thematik, Vollzug, Kontaktperson
- nennen wir (im Rah- [<724] men unserer Analyse des Arbeitsverhaltens)
"Arbeitseinheiten", abgekürzt AE (10.5). Sie bilden für uns die
Basiseinheiten. Thematisch geschlossene Arbeiten können allerdings
mehrere Vollzüge gleich hintereinander beanspruchen, und Vollzüge
können mehreren Themen nacheinander dienen; in diesen Fällen
schließen sich AE-Serien zu thematischen oder instrumentellen Sequenzen
zusammen. So kann der Tag auch in thematische oder Vollzugsabschnitte,
oder, bei Verbindung beider Gesichtspunkte, in "Beschäftigungsabschnitte"
gegliedert werden (10.6). Durch sekundäre Rastervergröberung
können Beschäftigungsabschnitte zu prägnanten Tagesübersichten
vereinfacht werden (12.1).
Die besprochenen Abschnitte bilden zeitlich kompakte
(wenn zum Teil auch "verdünnte", d.h. parallel zu anderen verlaufende)
Einheiten oder "Bausteine" des Tages. Es gibt aber auch zeitlich diskontinuierliche
Einheiten. Sie werden durch den gemeinsamen Inhalt zusammengebunden. Wichtigstes
Beispiel ist die am gleichen Tag (teilweise wiederholt) geleistete Arbeit
am gleichen Thema. Wir nennen sie "Tagestätigkeit" oder abgekürzt
TT (10.7).
Wird die Zahl der Einheiten eines Tages (AE, TT
etc.) in Beziehung gesetzt zu dessen Länge, so erhält man das
Maß seiner "Zerhackung". Aus meßtechnischen Gründen müssen
wir in den Nenner allerdings die Wurzel aus der Gesamtdauer setzen. Faßt
man dabei die längeren Einheiten zu einem "Tageskern" zusammen, so
ergibt sich, als weitere Maßzahl, die "Kernzerhackung" (11.3). Aus
dem Abfolgestil der thematischen Abschnitte (abgekürzt TA) kann man
Grundmuster des Tagesaufbaus unterscheid- und berechenbar machen (11.5).
Ganz verschiedene Muster dominieren zumindest bei P. - die normale Werktagsarbeit
und die Arbeit an freien Tagen. Werktage werden vorwiegend bestimmt von
Themendurchmischung und "Themenflucht", während freie Tage durch Themenreihung
und Thementreue charakterisiert werden (11.6).
Die Inhalte des Alltags. Neben den Abschnitten
und Einheiten des Tageslaufs sind die wichtigsten Bausteine des Alltags
die Themen. Unter "Thema" verstehen wir einen Inhalt, mit dem sich eine
Person einmal oder wiederholt für eine gewisse Zeit beschäftigt
oder zu beschäftigen beabsichtigt und den sie als zusammengehörige,
von anderen Inhalten abgehobene Einheit empfindet (3.4). Im Gegensatz zu
Vollzügen, Aufgabenbereichen und anderen kategoriell erfaßten
Größen sind Themen "individuelle" Realitäten (2.3). In
der Literatur ist ein analoger Themenbegriff verschiedentlich unter anderen
Bezeichnungen verwendet worden (3.3). Kurzfristig sind Themen problemlos
zu erfassen; dehnen sie sich über längere Zeit hin, so entstehen
gelegentlich Konstanz- und Identitätsprobleme (4.4); es ist nützlich,
sich dann an Kriterien zu ihrer Abgrenzung zu halten (4.6).
Die Durchsicht von P.'s Themenbestand (2.1; 4.4)
förderte eine große Mannigfaltigkeit verschiedener Themenarten
zu Tage. Zu den wichtigsten [<725] Unterscheidungsmerkmalen gehören
etwa die "Abschließbarkeit" der Themen oder die strukturelle Verbundenheit
ihrer Teile (5.1-3). Die Themenarten lassen sich in einem "Modell der einheitsstiftenden
Beziehungen" anordnen, indem schrittweise Abweichungen von einem "normalen"
Thema registriert und benannt werden (6.6). Quer durch alle Themenarten
geht allerdings die Grundunterscheidung zwischen "Aufgaben" (Inhalten,
bei denen eigenes Mittun erforderlich ist) und bloßen "Zuwendungsgegenständen"
(3.1; 4.3). Unsere statistische Analyse erlaubt den Zusammenzug der Themenarten
in fünf große Hauptgruppen, die sich unter zwei Gesichtspunkten
deutlich voneinander unterscheiden, nämlich nach Ausdehnung und nach
Intensität der Beschäftigung (7.7).
Quantitativ können Themen nach zeitlichen Ausmaßen
und nach innerer (struktureller) Gliederung erfaßt werden. Wie alle
diskontinuierlichen Gegenstände über Zeit haben sie zwei verschiedene
Ausdehnungen: eine "Dauer", d.h. die summierte Zeit effektiver Ausführungstätigkeiten
(von uns ausgedrückt in D oder AT) und eine "Erstreckung", d.h. die
Zeit von der ersten bis zur letzten Beschäftigung damit (hier gemessen
in Kalendertagen); bei der letzten können allerdings kurze Vor- oder
Nachspiele Verzerrungen ergeben. Maße für die innere Gliederung
geben vor allem die Zahl der Arbeitseinheiten, der thematischen Abschnitte,
der Bearbeitungstage (oder "Tagestätigkeiten"), der benützten
Vollzüge ab. Indem man die Maße zueinander in Beziehung setzt,
erhält man interessante Charakteristika der Themen, so besonders die
Bearbeitungsdichte (Gesamtdauer in AT durch Zahl der TT) und die Bearbeitungsfrequenz
(Zahl der TT durch Erstreckung in Tagen) (7.2-4) . Weiter sind Themen zum
Teil in Familien oder Serien verbunden (S.l/2) und können außerdem
größere Komplexe bilden (5.4).
Die Themenzahl pro Tag ist beim Kleinkind sehr groß
und nimmt bis zum Erwachsenenalter offenbar kontinuierlich ab (12.4).
Die strukturelle Analyse der Berufsarbeit. Arbeit ist ein zentrales,
wenn auch in seiner Bedeutung umstrittenes Charakteristikum menschlicher
Existenz (1.2). Hier beschäftigen wir uns vor allem mit der Berufsarbeit
- die wir nach dem "Tausch-Prinzip" definieren - und mit damit verbundenen
Arbeitsleistungen (8.4). Arbeit, mit welcher der Mensch Einkünfte
erzielt, kann wesentlich vielfältiger sein als oft angenommen (4.2).
Bei ihrer Beschreibung und Analyse hat sich die klassische westliche Arbeitspsychologie
jahrzehntelang auf die Ebene der Vollzüge beschränkt. Je komplexer
aber eine Berufstätigkeit ist, desto wichtiger wird auch die Erfassung
und Differenzierung der Inhalte beruflichen Tuns (8.1). Die konkreten Themen
der Arbeit ergeben sich dabei aus (abstrakt formulierbaren) Aufgabenfeldern
und/oder können in solche zusammengefaßt werden; diese Felder
nennen wir "Bereiche" (8.3). Will man die Struktur von Arbeitswelten ergründen,
so muß man für Bereiche und Vollzüge je berufs- und positionsspezifi-
[<726] sche Kategorientabellen benutzen; die oft angestrebte Entwicklung
universell gültiger Tafeln erweist sich als Illusion (8.2).
Ein großer Teil der Arbeit hat soziale Aspekte,
wobei allerdings verschiedene Gesichtspunkte zu unterscheiden sind; auseinanderhalten
muß man zumindest soziale Präsenz, soziale Interaktion, soziale
Zielsetzung, sozialen Gegenstand. Gewisse Arbeitseinheiten (bei P. etwa
die Beratungsgespräche) vereinigen Spitzenwerte aller dieser Aspekte
(9.5/6).
Komplexe Arbeitswelten. Komplexe Arbeitswelten sind vor allem
charakterisiert durch eine Vielzahl recht diverser Bereiche und Themen,
die in zeitlicher Verschränkung zum Zuge kommen (9.2), und/oder durch
komplizierte, nur durch Aufgliederung in viele Teilschritte zu bewältigende
Aufgaben. Bei den letzten ist die Ausführung allenfalls hierarchisch
planbar ("Längsschnittplanung") oder zumindest beschreibbar (6.4).
Oft allerdings besteht das Wesen komplexer Aufgabestellungen gerade darin,
daß das zweckmäßigste Vorgehen erst schrittweise "ertastet"
und erprobt werden muß. Auch erlauben die häufigen "Themenballungen"
meist gar keine logische, sondern bloß eine pragmatische Strukturierung
("Querschnittplanung"). Berufstätige müssen sich darum bemühen,
durch eine ad hoc getroffene, möglichst sinnvolle und rationale Operationenfolge
gleichzeitig mehreren zur Erledigung drängenden Aufgaben gerecht zu
werden. Bei komplexen Arbeitswelten plädieren wir darum für ein
"demokratisches" (anstelle des üblichen hierarchischen) Handlungsmodell
(6.3).
In komplexen Arbeitswelten lassen sich - am besten
durch eine Rollen-Analyse - berufliche Kernbereiche und berufliches Umfeld
unterscheiden, allenfalls auch paraberufliche und persönliche Arbeitsfelder
(9.2). Der Beruf kann dabei fließend ins Privatleben übergehen
und schwer von diesem abzugrenzen sein (8.4), und zwar nicht bloß
hinsichtlich Arbeitszeit (10.1). Auch bei den Ausführungstätigkeiten
gibt es Kernvollzüge einerseits, Zusatz- und Randvollzüge anderseits
(9.4). Die unscharfen Grenzen machen umgekehrt verschiedene Freizeitbegriffe
(8.5) bis hin zu jenem der "sekundären Freizeit" während der
Arbeit selber (9.4) nötig.
Spezifische Ergebnisse
Charakteristika von P.'s Arbeitswelt. Dem Leiter eines Beratungsdienstes stellen sich vielfältige Aufgaben (9.1), die von Jahr zu Jahr - teilweise recht dramatisch - wechseln können, aber doch einen Sockelbestand an größeren, über Zeit stabilen Tätigkeiten aufweisen. In den untersuchten Jahren füllte P. seine "Arbeitsverpflichtungszeit" je zur Hälfte mit der Betreuung beruflicher Kernaufgaben und solcher aus dem Umfeld; über diese Zeit hinaus ging er auch paraberuflichen und persönlichen Arbeitsanliegen nach (9.2). Was die Vollzüge betrifft, machten "Reden und Schreiben" mindestens drei Viertel der offiziellen Arbeitszeit aus (9.3). Die Hälfte seiner [<727] Zeit verbrachte er in Zusammenarbeit mit anderen (9.5), und ebenfalls die Hälfte verwendete er für soziale Aufgaben; aber da die beiden Aspekte nicht deckungsgleich sind, ergab es sich, daß rund 70% seiner Arbeit auf die eine oder andere Weise sozial bestimmt waren (9.6). Hinsichtlich Ausführung kann man eine Reihe typischer Vollzugsabfolgen konstruieren, dabei füllten "Kernvollzüge" rund 60% seiner "Arbeitsverpflichtungszeit". Knapp drei ganze Arbeitstage gingen pro Jahr durch Warten, erfolglose Versuche, Fehlerkorrektur etc. verloren (9.4).
Die Struktur von P.'s Arbeit. In P.'s Arbeitswelt kommen jährlich
rund 1500 Themen vor, allerdings nur ein Drittel von ihnen "reguläre",
die anderen in dieser oder jener Form abweichend, worunter etwa 900 "Zwischenthemen"
von sehr kurzer Dauer (7.5). Berücksichtigt man auch Themenverbindungen
und -komplexe, so reduziert sich die jährliche Zahl thematischer Gebilde
auf rund 700, wovon zur Hälfte "Bauschutt" (7.6). Reguläre Themen
beanspruchen allerdings am meisten Arbeitszeit, nämlich drei Viertel
der Gesamtdauer. Sie sind unterschiedlich lang, dauern aber im Durchschnitt
einen halben Tag (7.2). Doch die zeitliche Dominanz solcher Blöcke
im Arbeitsjahr spiegelt sich leider im einzelnen Tag nicht wider, da sich
auch größere Themen oft in kleine Tagesportionen aufbröckeln.
So kommt es, daß ein Drittel aller thematischen Bausteine des Tages,
der TT, nur die minimale Länge von 5 Minuten aufweisen und mehr als
zwei Drittel die Grenze von 20 Minuten nicht überschreiten (7.5).
Pro durchschnittlichen Wochentag bewältigte
P., bei zehn Stunden Gesamtarbeitszeit, rund 20 Tagestätigkeiten (7.5)
in gut 40 Arbeitseinheiten von durchschnittlich einer Viertelstunde Dauer
(11.1). Dieser Grad von "Zerhackung" bewegte sich an (oder schon fast jenseits)
der Grenze von P.'s Wohlbefinden (11.3). Die von der Sache her wünschbare
und von P. subjektiv gewünschte Konzentration auf große und
dringliche Themen (sowie die Kontinuität ihrer Bearbeitung) war selten
möglich, einmal weil der Tag durch viel kleines Geröll überschwemmt
wurde, und zweitens weil die Bedingungen der Arbeit zu einer bewegten Durchmischung
der Themen und gelegentlich zu einer wilden "Flucht" von Thema zu Thema
führten (11.6). Allerdings gab es Lockerungen während alternativer
Arbeitssituationen; vor allem an freien Tagen ließ sich eine erfreulichere
Arbeitsform realisieren (11.2/4/6). [<728]"
Standort Alltag.
*
Menschenbild, Anthropologie, Wertproblem und Metaphysik in der GIPT * Anpassen-und-Gestalten * Lenken * Entwicklungsschnittpunkte im Leben * Midlifecrisis? * Grundwissen Zeit * Entwicklungspsychologie * Arbeitslosen-Typologie * Sinnfragen: Lebenssinn 1 * Lebenssinn 2 (mit 100 Jahre Leben Meditation)
Überblick Programm Politische Psychologie in der IP-GIPT.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org z.B.
<Alltag site:www.sgipt.org> |
Dienstleistungs-Info.
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Die Bausteine des Alltag. Zur Psychologie des menschlichen Arbeitens und Handelns von Urs Pulver. Ein Buchhinweisvon Rudolf Sponsel. Reihe: Ökologie, Ökopsychologie und politische Umweltpsychologie. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/politpsy/umwelt/alltag.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
noch nicht endkorrigiert:irs 23.05.02