(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=25.08.2001 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 31.01.20
Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen Mail:_sekretariat@sgipt.org_
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Medizinische Psychosomatik, Psychopathologie und Psychiatrie, hier zum Thema Zwang und Zwangsmaßnahmen, Betreuung und Unterbringung, und hier speziell zu Ludwig II.:
Die Schloßbauwut
und das Finanzdebakel der "Zivilliste"
(Hof & Kabinettskasse)
Querverweis: Geld
im Deutschen Reich Überblick
Ludwig II.
Kommentar
und Psychographische Einordnung des Finanzdebakels aus heutiger
Sicht
Die Zivilliste (Hof- oder Kabinettkasse) Ludwigs II. umfaßte in den 1880iger Jahren rund 4,5 Millionen Mark. Ein Arbeiter hatte damals einen Jahresverdienst von ca. 650 Mark. Es ist zwar schwierig, eine genaue Schätzung des heutigen Barwertes dieser Summen vorzunehmen, aber als grobe Schätzung und Faustregel kann man den Faktor 100 nehmen. Das entspräche, um sich einen Begriff von den Größenordnungen zu machen, heute in etwa 65.000 DM Jahresverdienst für einen Arbeiter und einer Hofkasse von ungefähr 450 Millionen Mark.
Durchschnittliche Jahresverdienste 1871-1913 (Quelle)
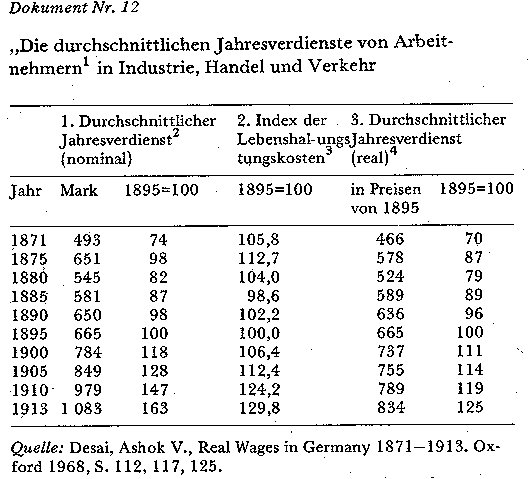
Obwohl es sich um alljährliche Riesensummen handelte, gelang es Ludwig II. bei seiner Schloßbauwut und unermeßlichen Prunksucht, orientiert an den französischen Sonnenkönigen, innerhalb relativ kurzer Zeit, genau in 15 Jahren - 1869 Baubeginn Schloß Linderhof und Neuschwanstein - , in große finanzielle Bedrängnis zu geraten, so daß es 1884 zu einer Krise der Zivilliste (Hof- oder Kabinettkasse) kommt. Rechnen wir die Summen der 15 Jahre auf heutigen Barwert um, so hatte er in dieser Zeit rund 7 Milliarden Mark zur Verfügung und soweit ausgegeben, daß die Kassen nicht nur leer waren, sondern die Gläubiger, darunter viele Handwerker, nicht mehr bezahlt werden konnten, so daß sogar zivil- gerichtliche Pfändung drohte. Finanzminister Riedel muß zur Abwendung der Pfändung bei Banken eine Anleihe von 7,5 Millionen Mark aufnehmen, das entspräche nach meinen Schätzungen heute ungefähr 750 Millionen Mark.
Briefwechsel Finanzminister
Riedel mit Ludwig
Erster Brief am
19.4.1884 an den Hofsekretär
nach Quellen von Hacker, Rupert (1966, 1972 dtv). Ludwig II. von Bayern in Augenzeugenberichten. München: dtv, S. 314 ff:
"Die Lage der k. Kabinettskasse ist eine sehr ernste, so ernst, daß ich, seitdem ich mich näher mit derselben beschäftigte, in der Tat von schweren Sorgen fast niedergedrückt bin. Wenn nicht baldigst die vorhandenen Schuldverbindlichkeiten getilgt werden, so ist zu befürchten, daß Hunderte, ja vielleicht noch mehr Existenzen dem ökonomischen Ruine verfallen und dieser Umstand allein bringt schon eine große Gefahr, die berechtigten Klagen der Betroffenen nicht bloß in ganz Bayern, sondern weit über dessen Grenzen hinaus einen Widerhall finden werden, welcher durch kein Mittel von den Stufen des Thrones ferne zu halten sein dürfte, was in einer Zeit wie die gegenwärtige, wo die sozialen Verhältnisse mehr und mehr unterwühlt werden, doppelt bedenklich erscheint.
Dazu kommt aber noch ein weiterer, höchst mißlicher Umstand. Nach bayerischen Gesetzen kann die Zivilliste vor Gericht verklagt und folgerichtig wenigstens teilweise auch gerichtlich beschlagnahmt werden.
Nun wird zwar jeder treue Untertan möglichst vor Herbeiführung einer gerichtlichen Einschreitung zurückschrecken Allein bei manchen werden die Gefühle der Loyalität durch die Not zurückgedrängt werden, und andere werden den Ausweg ergreifen, ihre Forderungen an Wucherer oder Ausländer abzutreten, welche Loyalitätsrücksichten nicht kennen. [...] Der Fortgang der gerichtlichen Prozedur kann in keinem Falle von Staats wegen gehemmt werden.
Der Finanzminister
nennt in seinem Bericht auch die Maßnahmen, die zur Abwendung dieser
Gefahr ergriffen werden müssen:
- Diese Maßregeln
können nach meiner Meinung nur in der Aufnahme einer größeren,
entsprechend rasch zu tilgenden Schuld, in der planmäßigen Wegfertigung
der vorhandenen Gläubiger und in der strengen Vermeidung neuer Schulden
bestehen.
In Durchführung
dieser Überlegungen vermittelt Riedel am 1. Juni 1884 eine Bankanleihe
von 7 1/2 Millionen Mark zur Bezahlung der Gläubiger. Da die Rückzahlung
des Darlehens die Zivilliste bis zum Jahr 190l belasten muß, wird
die Zustimmung der höchsten Agnaten des königlichen Hauses eingeholt.
Inzwischen geht der Ausbau der Königsschlösser in unvermindertem
Tempo weiter. Bereits im Sommer 1885 wird ein neuer Schuldenstand in Höhe
von über 6 Millionen Mark festgestellt, so daß jetzt insgesamt
fast 14 Millionen Mark Schulden vorhanden sind. Ludwig glaubt, die Krise
durch ein Machtwort aus der Welt schaffen zu können. Am 29. August
1885; wendet er sich wieder an Finanzminister Riedel:
- Mein
königlicher Wille ist es, daß die von Mir unternommenen Bauten
nach Maßgabe Meiner getroffenen Anordnungen angemessene Fortsetzung
und Vollendung finden. Dieses Mein Vorhaben erleidet aber eine wesentliche
Hemmung infolge des ungünstigen Standes Meiner Kabinettskasse. Ich
beauftrage Sie, Herr Minister, die nötigen Schritte zur Regelung der
Finanzen zu tun und so Meine Unternehmungen zu fördern.
In seiner
Antwort vom 3. September legt Riedel dem König eindringlich die Notwendigkeit
dar, die Kabinettskasse durch strenge Sparmaßnahmen zu sanieren.
Er weist darauf hin, daß nach den gesetzlichen Vorschriften der Finanzminister
keinen Einfluß auf die Verwaltung des königlichen Vermögens
nehmen könne, bemerkt aber abschließend:
- Ungeachtet der
vorstehend allerehrerbietigst dargelegten Erwägungen hat der treugehorsamst
Unterzeichnete, von der Ansicht ausgehend, daß die dermaligen Zustände
der Kabinettskasse, soweit sie bekannt geworden und in vielen Zeitungsblättern
namentlich des Auslandes und demzufolge in allen Schichten der Bevölkerung
besprochen werden, eine große Gefahr für Euerer Majestät
erhabene Person und den Thron in sich bergen, und erfüllt von dem
sehnlichsten Wunsche, den Allerhöchsten Interessen in gewissenhafter
Weise zu dienen, sich schon jetzt während der ganzen Zeit angestrengst
abgemüht, um einen entsprechenden Ausweg zur Beseitigung der Verlegenheiten
der Kabinettskasse zu finden.
Alles Bestreben war jedoch vergebens; auch das angestrengteste Nachdenken vermochte über die Tatsache, daß die der Kabinettskasse gestellten Aufgaben die Mittel derselben übersteigen, nicht hinwegzukommen, und der treugehorsamst Unterzeichnete kann bei dem besten Willen andere Schritte zur Besserung nicht bezeichnen, als die schleunigste Durchführung, der oben angedeuteten Untersuchungen und die strengste Vermeidung jeder Ausgabe, für welche nicht eine planmäßige Deckung vorliegt.
Über die Reaktion des
Königs auf dieses Schreiben berichtet Minister Lutz in den späteren
Landtagsverhandlungen:
- Der letzte Bericht
hatte zunächst die Wirkung, daß dem Herrn Finanzminister ein
Verweis darüber zuteil wurde, daß er in einem direkten Bericht
an Seine Majestät sich zu wenden gewagt hat.
Fernerhin haben Seine Majestät einzelne Schritte angeordnet, aus welchen die Absicht zu entnehmen war, den Finanzminister zu beseitigen. Das gab zu einer Vorstellung an Seine Majestät desjenigen Inhalts Veranlassung, daß es den übrigen Ministern nicht möglich sein würde, nach Entlassung des Finanzministers die Geschäfte fortzuführen.
Hierauf wurde den Ministern bedeutet, Seine Majestät sehen es als eine Majestätsbeleidigung an, daß, wenn Allerhöchstdieselben einen Minister entlassen wollen, nun auch die ührigen daraus Veranlassung nehmen, ihrerseits die Entlassung zu verlangen.
- Freiherr von
Lutz, der sich bisher immer nur reserviert ausgesprochen hatte und alle
Vorgänge in der Kabinettskasse ignorieren wollte, zumal er sich nicht
berufen fühlte, ohne Auftrag eine Sache zu besprechen, die lediglich
die Privatangelegenheiten Seiner Majestät berührte, kam infolge
dieses Königlichen Auftrages in die Notwendigkeit, aus seiner Reserve
herauszutreten.
Eingedenk des obenerwähnten Befehles Seiner Majestät, die Minister hätten sich in diesen Angelegenheiten nicht direkt an den König zu wenden, wählte Herr von Lutz die Form eines an den provisorischen Leiter der Kabinettskasse Klug zu richtenden ausführlichen Memorandums.
In dem
Schreiben, das Lutz am 6. Januar 1886 an Hofsehretär Klug richtet,
erörtert der Minister zunächst die Höhe der vorhandenen
Schulden sowie der von Ludwig darüber hinaus zum Weiterbauen gewünschten
Gelder, wobei er auf eine Summe von insgesamt zwanzig Millionen Mark kommt,
und fährt dann fort:
- Ich halte es nun für ganz unmöglich,
diese Beträge mittelst eines Anlehens bei Privaten aufzubringen [...].
Vorschüsse aus Staatsfonds sind selbstverständlich auf dem einfachen
Wege des Zugriffs ohne gesetzliche Ermächtigung undenkbar. [...] Es
bleibt sonach fürs erste nur noch die Frage übrig, ob Seine Majestät
nicht an das bayerische Volk appellieren sollten und ob es nicht möglich
sei, vom Landtage die Bewilligung der von Seiner Majestät dem König
gewünschten Summe von circa zwanzig Millionen Mark oder doch der zur
Schuldentilgung erforderlichen sechs Millionen Mark zu erlangen. [. . .]
Nachdem mir der eingangs erwähnte Befehl Seiner Majestät zugegangen
war, habe ich die hier aufgeworfene Frage wiederholt mit sämtlichen
Ministern besprochen; auch habe ich an manchem geeigneten Ort, wo volles
Vertrauen am Platze ist, neuerdings die Fühlhörner ausgestreckt
und Erkundigungen eingezogen. Das Resultat unserer Erkundigungen und Beratungen
ist das, daß sämtliche Minister der festen und unumstößlichen
Überzeugung sind, es müsse jeder Versuch, den Landtag zur Willigung
irgendeiner Summe über den Betrag der Zivilliste hinaus zu bewegen,
mit einer Niederlage enden, durch welche das Ansehen der Krone auf das
schwerste geschädigt würde.
Nachdrücklich
weist Lutz darauf hin, daß ohne die Tilgung der neu entstandenen
Schulden gerichtliche Schritte der Gläubiger gegen die Kabinettskasse
zu befürchten seien, welche sogar zur Beschlagnahmung der königlichen
Besitztümer führen könnten. Eine solche Katastrophe werde
jedoch zu vermeiden sein,
- [. . .] wenn
Seine Majestät in Gnaden geruhen wollen, den Ausbau der begonnenen
Schlösser und deren Einrichtung auf einige Zeit zu sistieren, durch
einen geschäftskundigen Mann [. . .] ein präzises Verzeichnis
der kontrahierten Schulden herstellen, deren Betrag, wo dies nötig,
auf das richtige Maß festsetzen, über Art und Zeit der Rückzahlung
verhandeln und prüfen zu lassen, wo und in welchem Maße bei
den Hofstäben Ersparungen gemacht werden können, und dadurch
verstärkt Mittel zur Heimzahlung der Schulden zu erlangen.
Dieser Weg wird, ich bin es überzeugt, zur Ordnung der Verhältnisse der Kabinettskasse führen, trotz der Größe der vorhandenen Lasten, aber er ist, so schmerzlich er auch ist und so große Opfer er seitens Seiner Majestät bedingt, der einzige der zum Ziel und aus den ernsten Bedrängnissen führt, die unser aller Herz jetzt beschweren.
Auch diese Ratschläge
haben nicht die erhoffte Wirkung. Freiherr von Bruck meldet am 17. Januar
1886:
- Das Memorandum
des Ministers von Lutz befindet sich seit dem 8. I[aufenden] M[onats] in
den Händen Seiner Majestät . Dasselbe hat zwar einen Sturm der
Entrüstung entfesselt, aber keine Entscheidung gebracht.
-
Ich binde Ihnen auf die Seele, dafür zu sorgen, daß es jetzt
in Wahrheit endlich vorwärtsgeht und Sie das Verlangte herbeischaffen,
und zwar in kürzester Zeit. Ich verlasse Mich darauf, daß Sie
schleunigst das herbeischaffen, wodurch jenes Äußerste ganz
entschieden vermieden wird, und verlange ausdrücklich von Ihnen, daß
Sie es so einrichten, daß in allerkürzester Zeit dies wenigstens
feststehen wird, daß in Folge der Besorgungen das Bewußte auf
keinen Fall eintritt. Das Übrige aber, womit Mir einzig in Wahrheit
gedient ist, soll rasch darauf in Folge Ihrer Bemühungen kommen.
Ich erwarte also von Ihnen, daß durch richtige Manipulation von Ihrer Seite das Vergreifen am Königlichen Eigentum zur Unmöglichkeit werde. Sie haben es also entschieden so einzurichten. Dies muß feststehen.
Seinen Flügeladjutanten
Graf Dürckheim-Montmartin fordert der König am 28. Januar zur
Gewaltanwendung auf:
-
Wenn es [. . .] nicht gelingt, eine bestimmte Summe (etwa in vier Wochen)
herbeizuschaffen, so wird Linderhof und Herrenchiemsee, mein Eigentum also,
gerichtlich beschlagahmt! Wenn dies nicht rechtzeitig verhindert wird,
werde ich mich entweder sofort töten oder jedenfalls das verfluchte
Land, in welchem so Schauderhaftes geschah, sofort und für immer verlassen.
Ich fordere Sie nun auf, mein lieber Graf, und lege Ihnen dringend an das
Herz, ein Kontingent zustande zu bringen, welches fest und treu zu mir
steht, sich durch nichts einschüchtern läßt und das, wenn
es wirklich zum Äußersten kommen sollte und die nötige
Summe nicht fließt, das rebellische Gerichtsgesindel hinauswirft.
Ich verlasse mich darauf, daß Sie dies auf geschickte Art und unter
der Hand zustande bringen, denn Minister, Gendarmerie, mit der hier nichts
anzufangen ist, Sekretäre (Klug, Schneider) dürfen nichts davon
erfahren, das sind Beamte, die Furcht haben vor der Kammer, Gesetzesbestimmungen
und öffentlichen Meinung, sind folglich alte Weiber und keine königstreuen
Unrtanen, wie es sein soll.
Dürckheim beschwört
den König, einen solchen Gedanken aufzugeben, da die Ausführung
dieses Plans »jdie denkbar schwersten Folgen für die Allerhöchste
Autorität und für die Allerhöchste Person Euer Majestät
nach sich ziehen müßte ...«"
Keine der Vorschläge
aus dem Kreise der Regierung oder seiner Vertrauten kann den König
beeinflussen, so daß Ludwig der II. mit seinen Ideen immer mehr der
Realität und der Verantwortlichkeit entrückt:
- "Es wurde Hesselschwerdt
nach Regensburg geschickt, um bei Seiner Durchlaucht dem nunrnehr verstorbenen
Fürsten Maximilian von Thurn und Taxis ein Anlehen von zwanzig Millionen
aufzunehmen, und durch Vermittlung Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs
Ludwig in Bayern sollte Hesselschwerdt die Hilfe Seiner Majestät des
Kaisers von Österreich zu erlangen suchen. Nach Stockholm zu Seiner
Majestät dern König von Schweden und Norwegen wurde ein Flügeladjutant
zu gleichem Zwecke gesendet, und ebenso sollte in Brasilien der Versuch
eines Anlehens gemacht werden. Andere Personen sollten nach Brüssel,
nach Konstantinopel zum Sultan und nach Teheran zum Schah gesendet werden;
und sei kein Geld aufzutreiben, so wurde befohlen, Leute zu werben um bei
den Banken in Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Paris einzubrechen. Gleichzeitig
wurden vier Personen beauftragt, je zwanzig Millionen herbeizuschaffen,
doch durften diese nichts voneinander wissen, so daß man auf einmal
achtzig Millionen zu erhalten hoffte. Charakteristisch ist, daß auf
mehreren solchen Befehlszetteln nur die Zahl angegeben ist ohne den Beisatz
des Wortes »Million«, welcher sich von selbst zu verstehen
schien.
Aufträge
zur Vermittlung von Darlehen erhalten unter anderen Prinz Ludwig Ferdinand,
ein Vetter des Königs, ferner Flügeladjutant Graf Dürckheim
und Hofsekretär Klug, oft aber auch Lakaien oder Stalldiener wie der
Marstallfourier Karl Hesselschwerdt, der damals das besondere Vertrauen
des Königs genießt. Daß Hesselschwerdt manche dieser Aufträge
nur zum Schein ausführt, berichtet Graf Dürckheim:
- Im Januar oder
Februar 1886 kam Hesselschwerdt zu mir und brachte mir mündlich den
Befehl des Königs, nach England zu reisen, um den Herzog von Westminster
zu veranlassen, daß er ihm zehn Millionen leihe. Ich nahm mir vor,
mich über verschiedene Anhaltspunkte zu orientieren, deren ich bedurfte,
um dem Könige schriftlich auseinanderzusetzen daß und warum
diese Reise (wie alle ähnlichen) nichts nützen, dagegen nur dem
Ansehen seiner Krone schaden würde - mit einem Worte, ihm Gegenvorstellungen
zu machen, und sagte daher zu Hesselschwerdt: »Es ist gut, melden
Sie Seiner Majestät, daß Sie mir den Auftrag ausgerichtet haben
und daß ich morgen selbst in der Sache an Seine Majestät schriftlich
berichten werde.« Darauf antwortete mir Hesselschwerdt: »Herr
Graf werden entschuldigen, aber ich kann heute nichts melden, ich bin nämlich
eigentlich in Neapel!«
»Wieso?« fragte ich.
»Ja«, erwiderte er, »der König hat mich nach Neapel geschickt, aber das nutzt doch nichts, dorthin zu reisen, darum bin ich hiergeblieben; ich habe aber gesagt, ich ginge hin und käme Mittwoch zurück, daher kann ich vorher dem Könige nichts melden!«
Eine ähnliche Episode
erzählt Graf Lerchenfeld:
- Ludwig II. hat
in jener Zeit immer wieder selbst gesagt, er müsse zugrunde gehen,
wenn er nicht mehr bauen könnte. Diese Vorstellung war bei ihm so
sehr zur fixen Idee geworden, daß er im Winter 1886 einige seiner
Vertrauten Bediensteten nach Frankfurt a. M. mit dem Auftrag sandte, bei
Rothschild einzubrechen und die für Bauten nötigen Millionen
zu rauben. Die Leute fuhren auch nach Frankfurt, unterhielten sich dort
einige Tage und fuhren dann wieder nach Hause. Schon im Bahnhof in München
wurden sie von anderen Emissären des Königs erwartet, die den
Auftrag hatten, die Rothschildschen Millionen ihnen abzunehmen und dem
Könige zu bringen. Sie berichteten dann, alles sei vortrefflich vorbereitet
gewesen, nur ein unglücklicher Zufall habe das Unternehmen vereitelt,
das nächste Mal werde es sicher gelingen.
Die Verschuldung
des bayerischen Königs, über die schon 1885 Nachrichten an die
Öffentlichkeit dringen, erregt überall erhebliches Aufsehen.
Presseartikel und Broschüren, die zunächst außerhalb Bayerns,
dann auch in Bayern selbst erscheinen, behandeln die Geldnot des Königs
und die möglichen Wege einer Lösung. Dabei wird auch schon Kritik
an der Person des Königs laut. Am 23. März (1886, R. S.) berichtet
das vielgelesene »Bayerische Vaterland«:
...
- Die Verhältnisse
der Kabinettskasse beschäftigen seit geraumer Zeit die in- und ausländische
Presse in einer Weise, daß diese Angelegenheit längst nicht
mehr als Privatsache angesehen werden kann und eine sehr ernsthafte Bedeutung
bekommen hat; denn nicht bloß die Blätter, alle Welt spricht
davon, und wie und was alle Welt davon spricht, ist für das bayerische
Volk weder schmeichelhaft noch angenehm."
|