(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=06.01.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 07.01.23
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Erleben und Erlebnis bei Heidegger_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Erleben
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Allgemeine Psychologie, Bereich Erleben, und hier speziell zum Thema:
Erleben und Erlebnis bei Heidegger
Das Erleben erlebt. Das könnte ein Heidegger sein nach dem Muster
Das Nichts nichtet.
S.247: "Aber in der Phänomenologie gibt es keine Definitionen."
Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen
Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung Hauptseite *
|
welche ihre Gedanken untereinander austauschen wollen, etwas voneinander verstehen; denn wie könnte denn, wenn dies nicht stattfindet, ein gegenseitiger Gedankenaustausch (...) möglich sein? Es muß also jedes Wort (...) bekannt sein und etwas, und zwar eins und nicht mehreres, bezeichnen; hat es mehrere Bedeutungen, so muß man erklären, in welcher von diesen man das Wort gebraucht. ..." Aus: Aristoteles (384-322) Metaphysik.
11. Buch, 5 Kap., S. 244
|
| Leider verstehen viele Philosophen, Juristen, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftler auch nach 2300 Jahren Aristoteles immer noch nicht, wie Wissenschaft elementar funktionieren muss: Wer wichtige Begriffe gebraucht, muss sie beim ersten Gebrauch (Grundregeln Begriffe) klar und verständlich erklären und vor allem auch referenzieren können, sonst bleibt alles Schwall und Rauch (sch^3-Syndrom). Wer über irgendeinen Sachverhalt etwas sagen und herausfinden will, der muss zunächst erklären, wie er diesen Sachverhalt begrifflich fasst, auch wenn dies manchmal nicht einfach ist. Wer also über Gewissheit etwas sagen und herausfinden will, der muss zunächst erklären, was er unter "Gewissheit" verstehen will. Das ist zwar nicht einfach, aber wenn die Philosophie eine Wissenschaft wäre und und die PhilosophInnen Aristoteles ernst nehmen würden, dann hätten sie das in ihrer 2300jährigen Geschichte längst zustande bringen müssen. Im übrigen sind informative Prädikationen mit Beispielen und Gegenbeispielen immer möglich, wenn keine vollständige oder richtige Definition gelingt (Beispiel Gewissheit und Evidenz). Begriffsbasis Damit werden all die Begriffe bezeichnet, die zum Verständnis oder zur Erklärung eines Begriffes wichtig sind. Bloße Nennungen oder Erwähnungen sind keine Lösung, sondern eröffenen lediglich Begriffsverschiebebahnhöfe. Die Erklärung der Begriffsbasis soll einerseits das Anfangs- problem praktisch-pragmatisch und andererseits das Begriffsverschiebebahnhofsproblem lösen. |
Bd.58-Gesamt-Zusammenfassung Heidegger Phänomenologie
Die grundlegenden Mängel und Widersprüchlichkeiten der Phänomenologie erkennt auch Heidegger nicht, wie die Analyse des Bandes 58 belegt. Heidegger begreift wie die meisten PhänomenologInnen nicht, dass man auch zur phänomenologischen Analyse eine Sprache braucht, die man nicht "ausschalten" kann. Es gibt keine voraussetzungslose Wissenschaft und daher muss man seine Voraussetzungen ausweisen und erklären, aber Voraussetzungsanalyse, Sprache und Methode werden von Heidegger nicht zur Verfügung gestellt. Das steht in völligem Kontrast und Widerspruch zu seinem fundamentalistischen Anspruch, allen anderen Wissenschaften vorgeordnet zu sein. Völlig daneben sind auch seine homunkulesken Formulierungen (... die Gegenwart springt ...), wenn er allgemein-abstrakte Sachverhalte wie autonom-handelnde Subjekte behandelt.
Erleben und Erlebnis werden von Heideggeser nicht erklärt, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung, Fußnote oder Literaturhinweis. In Bd. 58 sagt er S. 247 (nach 247 Seiten !) zwar: "Es ist eine Notwendigkeit den Begriff des H58.247.e1Erlebens ursprünglich zu bestimmen.", aber er löst diese selbst so genannte Notwendigkeit nicht ein. In H58.247.D1 formuliert Heidegger ein bemerkenswertes Bekenntnis: "in der Phänomenologie gibt es keine Definitionen."
Fazit58:
- Zwischenbilanz erleben, erlebt, Erlebnis bis Seite 35.
- Endebilanz erleben, erlebt, Erlebnis Seite 244-263.
Heidegger-Band-58
Fundstellen Band 58 erleb 162, erleben 35 (1 Pseudo), erlebt 15, Erlebnis... 104
Heidegger, Martin (1919/1920) Gesamtausgabe II. ABTEILUNG: VORLESUNGEN
1919-1944 BAND 58 GRUNDPROBLEME DER PHÄNOMENOLOGIE (1919/20). Frankfurt:
Klostermann.
https://heidegger.ru/wp-content/uploads/2019/12/Band-58.pdf
Bd.58-Fundstellenkürzel - Einführung in die Phänomenologie
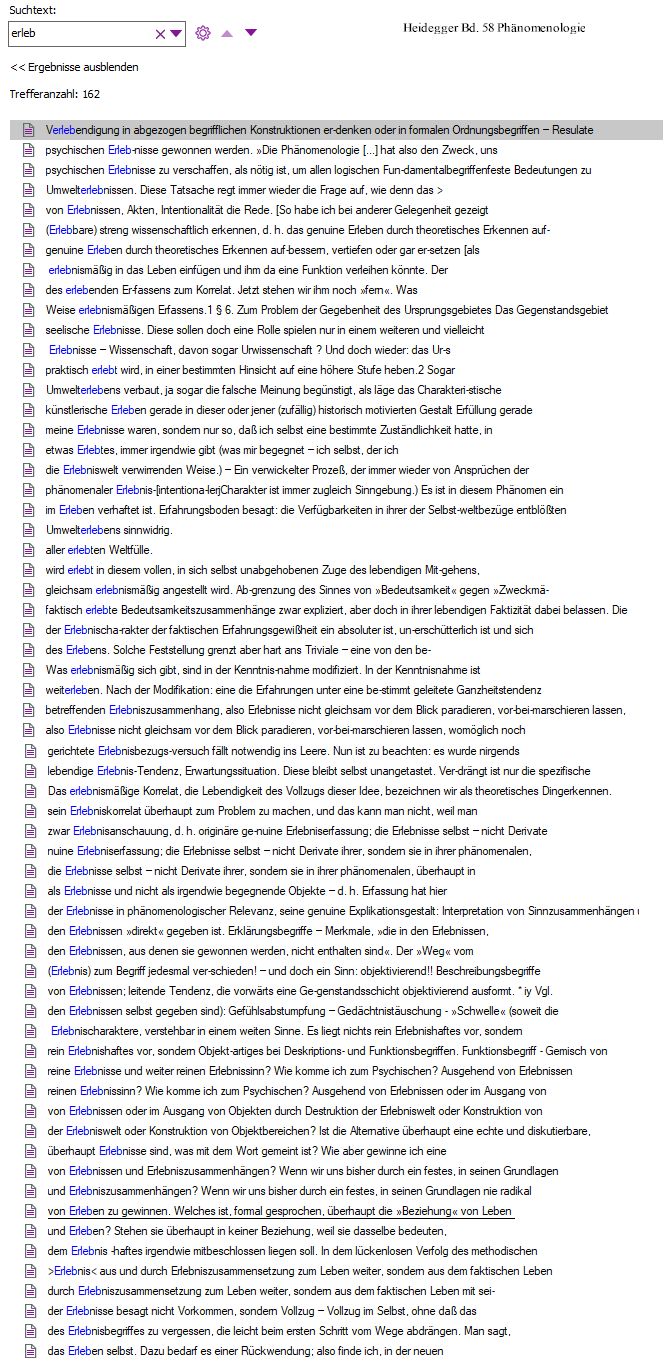

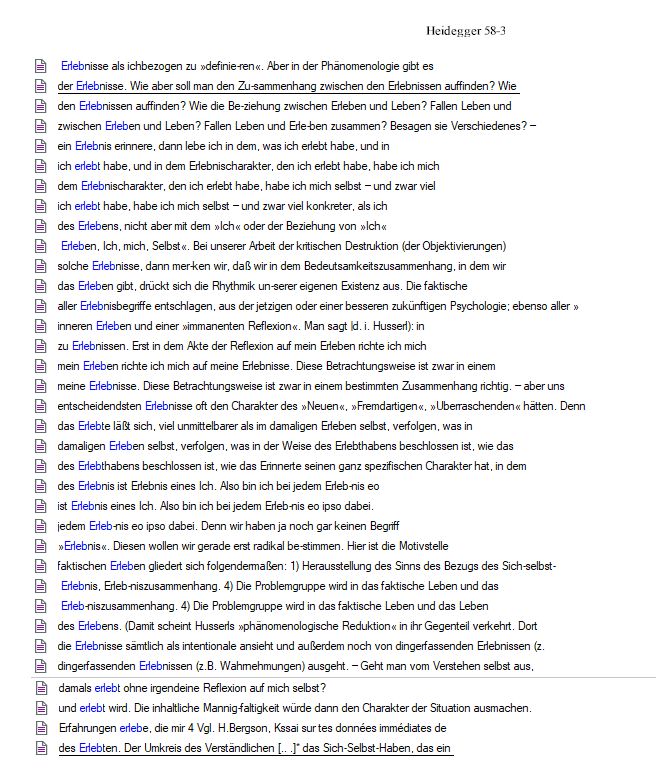
Die ersten Fundstellen "erleb" der Reihe nach in Bd. 58: Einführung in die Phänomenologie
- Pseudo S.2 "Verlebendigung"
H58.14: "Es soll ein deskriptives Verständnis der psychischen
H58.14.E1Erlebnisse
gewonnen werden. »Die Phänomenologie [...] hat also den Zweck,
uns ein so weitreichendes deskriptives (nicht etwa ein genetisch-psychologisches)
Verständnis dieser psychischen H58.14.E2Erlebnisse
zu verschaffen, als nötig ist, um allen logischen Fundamentalbegriffen
feste Bedeutungen zu geben«1. »Die eben erörterten Motive
der phänomenologischen Analyse, sind [...] nicht wesentlich von denjenigen
verschieden, welche aus den erkenntnistheoretischen Grundfragen entspringen.«8
Wir sehen die Tatsache, daß Gegenstände sich geben in einer
Mannigfaltigkeit von Umwelterlebnissen.
Diese Tatsache regt immer wieder die Frage auf, wie denn das >an sich<
der Objektivität zur Vorstellung kommen, also gewissermaßen
doch wieder subjektiv werden mag; »was das heißt, der Gegenstand
sei >an sich< und in der Erkenntnis >gegeben<«9. Bemerkenswert:
die Einsicht in die nicht wesentliche Verschiedenheit des deskriptiven
(quellen-[>15]
gebundenen) Motivs und des Erkenntnistheoretischen; ferner: die Deskription
steht im Dienste von systematisch-logischen Zielen (philosophische), letzeres
ist die eigentliche Ausprägung der Tendenz, in die die Problematik
genommen wird das Transzendentale, die Fruchtbarkeit und eigentlich bewegende
Funktion der Tendenzen für die wissenschaftliche Problematik. Der
Nachdruck ruht auf dem Gegenständlichen der Objektivität - nicht
so: wie im Kleinkram sich ein Objektives gestalte -, im Prinzip desselben."
- Kommentar58.14: Beim ersten Gebrauch von Erlebnisse erklärt Heidegger
nicht, was er darunter versteht, auch nicht durch Querverweis, Anmerkung,
Fußnote oder Literaturhinweis.
H58.16: "Für Kantianer war der II. Band [RS: E. Husserl, Logische
Untersuchungen. Zweiter Theil: Untersuchungen zur
Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Halle 1901] erst recht
Psychologie, war da doch ständig von H58.16.E1Erlebnissen,
Akten, Intentionalität die Rede."
- Kommentar58.16: Auch die dritte Erwähnung versieht Heidegger nicht
mit einer Erklärung, er verweist allerdings auf Husserls Logische
Untersuchungen 2. Teil. Dort gibt es zu Erlebnis 561 Fundstellen, damit
bleibt offen, auf welchen Erlebnisbegriff Heidegger abzielt.
- KommentarH58.19f: Auch hier klärt Heidegger nicht, was er unter
erlebbar bzw. Erleben versteht.
H58.26: "Der >Ursprung< ist nicht ein letzter einfacher Satz,
ein Axiom, aus dem alles abzuleiten wäre, sondern ein ganz Anderes;
nichts Mystisches, Mythisches, sondern etwas, dem wir in immer strenger
werdender Betrachtung, die sich auf diesem Wege immer zugleich selbst erhält,
nahezukommen suchen und zwar auf verschiedenen Zugängen und zwar
näherkommen in einer wissenschaftlichen, urwissenschaftlichen Methode
und nur in ihr. Nicht etwas, das man sonst noch in anderer Weise H58.26.e1erleben,
H58.26.E1erlebnismäßig
in das Leben einfügen und ihm da eine Funktion verleihen könnte.
Der Ursprung und das Ursprungs-gebiet haben eine ganz ursprüngliche
Weise des H58.26.e2erlebenden Erfassens
zum Korrelat. Jetzt stehen wir ihm noch »fern«.
Was diese »Ferne« zum Gegenstand der Phänomenologie heißt
und was »Nahebringen«, »Näherkommen« heißt,
sollen wir verstehen lernen. Wir stehen dem Gegenstand der Phänomenologie
sogar so fern, daß wir noch gar nicht wissen, wo er liegt eine
räumliche Redeweise, ihr Sinn aber ist jetzt schon roh verständlich.
Die berühmten und »berüchtigten«
»unmittelbaren Gegebenheiten« der Phänomenologie und phänomenologischen
Wissen-[>27]
schaft sind »zunächst« »bekanntermaßen«
nie und nirgends gegeben, wir mögen das Leben in seiner aktuellen
Strömungsrichtung nach allen Dimensionen durchsuchen. Vielleicht ist
das Ursprungsgebiet uns jetzt noch nicht gegeben aber wenn die Phänomenologie
weiter ist? Auch dann nicht und nie. Ja, wäre sie absolut vollendet,
sie wäre dem aktuellen strömenden Leben an sich doch völlig
verborgen.
1. Ursprungsgebiet nicht im Leben an sich (dessen
Grundaspekt »Selbstgenügsamkeit«, der es zugleich fraglich
macht, ob überhaupt ein Ursprungsgebiet des Lebens zugänglich
wird).
2. Ursprungsgebiet nur radikaler wissenschaftlicher
Methode zugänglich, überhaupt gegenständlich nicht in anderer
Weise H58.26.E2erlebnismäßigen
Erfassens."
- KommentarH58.26: Auch in den vier Fundstellen der Seite 26 erklärt
Heidegger erleben, erlebendes Erfassen, Korrelat und erlebnismäßiges
Erfassen nicht.
H58.28: "Dann war bei der Betrachtung der »phänomenologischen
Strömungen« von Verengung die Rede, Verkehrtheit der Einschränkung
auf Psychologie, seelische H58.28.E1Erlebnisse.
Diese sollen doch eine Rolle spielen nur in einem weiteren und vielleicht
prinzipiell anderen Ausmaß. Es wurden abgewiesen wiederum weltanschauliche
Verstiegenheiten, die strenge Einhaltung der forschend-wissenschaftlichen
Einstellung zum Prinzip erhoben."0
- KommentarH58.28: seelische Erlebnisse werden zwar erwähnt, aber
nicht erklärt.
H58.29: "Leben - Geistesgeschichte H58.29.E1Erlebnisse
Wissenschaft, davon sogar Urwissenschaft ? Und doch wieder: das Ursprungsgebiet
soll nicht gegeben sein; es sei erst zu gewinnen."
- KommentarH58.29: Erlebnisse werden zwar erwähnt, aber nicht erklärt.
H58.35: "In all diesen Wissenschaften leben die Menschen und zwar
systematisch erkennend: das, was naiv-praktisch H58.35.e1erlebt
wird, in einer bestimmten Hinsicht auf eine höhere Stufe heben.2 Sogar
vom Menschen selbst, der das Leben lebt, gibt es und will es eine Wissenschaft
geben: vom Psychischen. Das Leben wird gelebt, insofern die Lebenden in
ihm aufgehen in irgendeiner Richtung."
- KommentarH58.35: "naiv-praktisch erlebt"
wird zwar erwähnt, aber nicht erklärt, schon gar nicht der Unterschied
zwischen erleben und naiv-praktischem erleben.
_____
Die Fundstellen erleben, erlebt, Erlebnis... S. 240-263
240: "13. Kritische Destruktion - Ausdrucks-
und Ordnungshegriffe
In der Betrachtung des faktischen Lebens zeigte sich, wie sich, zugleich
mit den unabgehobenen Bestimmtheiten, Abgrenzungen objektartiger Ausformungen
ergeben. Das heißt: Das faktische Leben gibt sich in einer bestimmten
Deformation. Diese Ausformung in Objektsgebilde muß rückgängig
gemacht wer-den. Deshalb sagt man dauernd »nicht« bei phänomenologi-schen
Beschreibungen. Das ist der Grundsinn der Hegeischen Methode der Dialektik
(Thesis, Antithesis, Synthesis). Damit gewinnt die Negation eine schöpferische
Kraft, die die treibende Kraft der Ausdrucksbegriffe ist, im Gegensatz
zu den Ordnungsbegriffen. Alles Verstehen vollzieht sich in der Anschauung.
Daher rührt der deskriptive Charakter des phänomenologischen
Arbeitens. Aber was soll beschrieben werden? Faßt man Beschreibung
nun als Objektsbeschreibung, d.h. als Merkmalszusammenfügung bzw.
Merkmalsabhebung oder Momenteheraushebung, und wendet sie auf »Erlebnisse«
an, so objektiviert man diese, macht sie zu Objekten. Die Beschreibung
muß stets durch die Absicht des Verstehens geleitet sein.
Die ausgezeichnete Art der phänomenologischen
Erkenntnis [241] wird in der bisherigen Phänomenologie mit »Wesens-Erkenntnis«
oder »eidetische Erkenntnis« bezeichnet. Aber der Sinn des
Eidetischen ist zu stark abgetrennt und mit der Idee der generalisierenden
Verallgemeinerung verknüpft worden. »Wesen« wird mit »Gattung«
gleichgesetzt. Vom Verstehen her bekommt der Wesensbegriff einen anderen
Sinn.
Auch die phänomenologische Evidenz ist
eine andere als die mathematische Evidenz, mit der man sie gleichgesetzt
hat. Die mathematische Evidenz ist eine Ordnungsevidenz. In der
Philosophie gibt es keine Definitionen, die Objekte ein für alle Mal
bestimmen.
14.
Kritik der Psychologie ihrer Einstellungsrichtung
ihrer Begriffsbildung
Die genannten Eigentümlichkeiten der Phänomenologie wollen
wir nun näher besprechen. Wir beziehen unsere Betrachtungen zurück
im Sinne der »dialektischen« Methode der Negation, bei der
der erste Schritt destruktiv ist auf eine faktisch bestehende Wissenschaft,
die Psychologie.
Wir hatten früher unbestimmt gelassen, ob die
Psychologie Philosophie ist oder eine Einzelwissenschaft. Wir wollen uns
auch jetzt lediglich auf die heutige faktisch bestehende Psychologie beziehen
und untersuchen:
- 1) Welche Einstellungsrichtung sie hat.
2) Wo die Bruchstellen liegen, wo sie ins »objektivierende« Fahrwasser gerät und also von ihrer ursprünglichen Richtung abbiegt.
3) Welche Motive diese Abbiegung veranlaßt haben.
- 1) Beobachtungsrichtung der Psychologie,
2) Begriffsbildung der Psychologie. [>242]
Dabei bleiben wir zunächst in derjenigen Unklarheit, in der sich die Psychologie selbst befindet.
[Man muß sich die folgenden, sehr gedrängten Ausführungen an konkreten Beispielen, etwa Müller, Stumpf, Külpe und seine Schüler, Th.. Lipps u. a. m., klar machen.]
- Kommentar58.242: Das sind keine ordentlichen Literaturhinweise und
geht sogar noch über den Hochstaplerzitierstil
in der Psychologie hinaus.
1) Einstellungs- oder Beobachtungsrichtung
Die Psychologen unterscheiden eine »objektive« und eine
»subjektive« Beobachtungsart. »Objektive« Beobachtung
ist die Beobachtung der Versuchsperson durch den Forscher (Versuchsleiter);
sie bezieht sich auf das Benehmen, äußere Verhalten etc. der
Versuchsperson. »Subjektive« Beobachtung ist die Selbstbeobachtung,
die die Versuchsperson anstellt (auf Anweisung des Versuchsleiters) und
worüber sie berichtet. »Objektiv« ist z. B. Zahl der Fehler
und Treffer, Zeit der Einprägung (von Worten bei Gedächtnisexperimenten),
Reaktionszeit. Trotz aller objektiven Beobachtung kann man die Selbstbeobachtung
nicht entbehren. Man muß versuchen, alle »störende Wirkungen«
auszuschalten. D.h. man unterscheidet zwischen dem »natürlichen«
ungehemmten Zustand bzw. Verhalten der Versuchsperson und dem »gekünstelten«
Zustand, welcher durch den Einfluß der Selbstbeobachtungsabsicht
bei der Versuchsperson zustande kommt. Es gibt eine »hemmende Wirkung
der Selbstbeobachtung« (z. B. bei Assoziationsexperimenten: Beobachtet
die Versuchsperson, ob und wie bei ihr die Antwortreaktion auftritt, so
tritt eine gewisse Spannung und Unentschiedenheit bei ihr ein. Sie kann
z.B. das Auftreten inneren Sprechens bei der Antwortreaktion hervorrufen
oder hindern durch ihren Willen.) Es gibt ferner »suggestive Einflüsse«.
Man glaubt unter diesem Einfluß zu sehen, was psychisch nicht vorhanden
ist. Oder es gibt »Störungen der Verteilung der Aufmerksamkeit«:
Die Aufmerksamkeit der Versuchsperson ist nicht auf ihre Aufgabe konzentriert.
Was ist nun z. B. der Sinn der »hemmenden Wirkung der Selbstbeobachtung«.
Zugrunde liegt die Idee, den »psychischen Vor-[>243] gang«
zu objektivieren, ihn in seiner »Reinheit« darzustellen, d.
h. ihn aller Bedeutsamkeit für das Subjekt, d. h. alles lebendigen
Subjektbezugs zu entkleiden.
2) Begriffsbildung
Die Psychologen unterscheiden Beschreibungsbegriffe und Erklärungs-
oder Funktionsbegriffe. Ein Begriff ist für sie (wie für jede
Objektswissenschaft) ein Zusammenhang von Merkmalen. Die Merkmale der
Beschreibungsbegriffe sind nur in unmittelarer Anschauung gewonnen; dahin
gehören alle Begriffe der Klassifikation. (Einteilung der H58.243.E1Erlebnisse
in intellektuelle und emotionale Akte). Die Sphäre der psychischen
Phänomene wird hierbei als klassifizierbar vorausgesetzt. Funktionsbegrifie
dagegen enthalten Merkmale, die nicht unmittelbar anschaulich gegeben sind,
z.B. Begriffe wie: »Schwelle«, »Gedächtnistäuschung«,
»Gefühlsabstumpfung« etc. Es handelt sich hier um (theoretische)
Substruktionen, wie in der Physik (»Brechungsindex«, »Wellenlänge«
etc.).
Von der H58.243.E2Erlebnissphäre
im eigentlichen Sinn, von den Gestalten des Lebens selbst ist keine Rede
mehr, das lebendige Leben ist zerstört. Durch die Methode der »inneren
Beobachtung« (»immanenten Wahrnehmung« etc.) wird ebenso
das Beobachtete objektiviert wie in den Naturwissenschaften. Daran ändert
auch nichts, daß die H58.243.E3Erlebnisse
auf ein »Ich« bezogen werden; denn das geschieht doch auch
nur innerhalb der Klassifikation der »faktischen« Zusammenhänge,
d. h. ihrer Objektivierung. Manche »phänomenologischen«
Beschreibungen sind von diesem Fehler nicht frei, z. B. Husserls Deskriptionen
über das »reine Ich«. Das Ursprungserkennen muß
den Weg der Objektivierung vermeiden. Es kann die H58.243.E4Erlebnisse
direkt dem faktischen Leben entnehmen, ohne den Umweg über die Psychologie
zu machen.
- KommentarH58.243: Die Behauptung wird nicht eingelöst. Wie entnimmt
man die Erlebnisse dem faktischen Leben direkt?
Das Leben läuft sich in seinem eigenen Ausdruckszusammenhang
tot; d. h. die Ausdruckszusammenhänge, isoliert be-[244]trachtet,
verlieren ihren eigentlichen Charakter und werden zu Objekten.
Daher muß die Objektivierung, die theoretische Ausformung gewisser
Lebensgestaltungen, von der Phänomenologie rückgängig gemacht
werden. Die Objektivierung hat, echt vollzogen, ihren eigenen Wert. Es
besteht aber die Gefahr der vorschnellen Objektivierung. Es ist nicht so,
daß diese Objektivierung falsch oder unrichtig wäre, das Ursprungsverstehen
dagegen richtig. Hier gibt es keine solche Alternativen. Die Norm des phänomenologischen
Verstehens ist nicht Wahrheit im Sinne von »Richtigkeit« oder
Falschheit, sondern Ursprünglichkeit. Objek-tivierung ist eine Abtrift,
eine Abbiegung in einem bestimmten Stadium, auf einer bestimmten Stufe
der phänomenologischen Forschung, daher unfruchtbar für die Phänomenologie.
H58.244f: "Wir hatten die Psychologie als eine Ausprägung heutigen
Geisteslebens genommen, als einen Versuch, sich theoretisch der Selbstwelt
zu bemächtigen. Wir fragen: Welche Momente sind an ihr unecht, von
der Ursprungsforschung aus gesehen? Wir schränkten unsere Betrachtung
ein auf die Erfahrungsrichtung und die Begriffsbildung der Psychologie.
Die Begriffsbildung ist bestimmt durch die Erfahrungsrichtung selbst. Mit
Erfahrungsrichtung meinen wir nicht die Probleme der immanenten Reflexion.
Die sind nicht fundamental. Aber der Psychologe sieht selbst gewisse
Gefahren vor sich, er fürchtet, daß ihm sein Gegenstand unter
seinen methodischen Veranstaltungen, ihn zu erfassen, zerfließt.
Er spricht von der störenden, verdrängenden und suggerierenden
Wirkung der psychologischen Beobachtung. Die psychologische Beobachtung
erscheint hierbei als ein zweiter psychischer Vorgang, der auf den ersten,
zu beobachtenden, einwirkt. Hier liegt nun eine Unklarheit des Sinnes vor.
Es liegt das Bestreben zu Grunde, einen objektiven Geschehenszusammenhang
zu gewinnen, d. h. eine reine Objektivität, ein Korrelat theoretischen
Verhaltens. Damit aber ist abgewichen von dem Problem der Erfassung der
Selbstwelt. Was die psychologische Begriffsbildung betrifft, so ist man
sich jetzt allgemein über die Notwendigkeit der Beschreibung psychischer
Phäno-[>245]mene: einig; obwohl sie nur als eine Vorstufe der »Erklärung«
angesehen wird. Der Sinn dieser Beschreibung geht auf ein Ordnungschaffen,
auf eine Klassifikation der psychischen Phänomene aus. Man beabsichtigt
nicht die Zuriickführung der Erscheinungen auf eine Seelensubstanz
und dergleichen, sondern rein die Phänomene als solche will man beschreiben,
ordnen, klassifizieren; etwa so:
- Erscheinungen Funktionen
Farbe , Töne... etc.
So sehr man bei dieser Beschreibung auf konkrete Phänomene zurückgeht, so sehr ist durch diese Klassifikation schon die Ordnungstendenz leitend geworden. Es besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen den Beschreibungsbegriffen und den Funktionsbegriffen (Erklärungsbegriffen). Denn alle diese Begriffe sind nicht durch Vergegenwärtigung aus der Mannigfaltigkeit von H58.245.E1Erlebnissen gewonnen, sondern durch In-Beziehung-Setzen von H58.245.E2Erlebnissen und
- KommentarH58.245E1: Wie gewinnt man denn ein Erlebnis aus der Mannigfaltigkeit
von Erlebnissen? Hier wäre ein Beispiel, wie man das phänomenologisch
richtig macht, zu fordern.
- KommentarH58.245E1: Ja und? (Wobei Gedächtnisfehler besser
wäre als Gedächtnistäuschung). Aber: Für was soll das
ein Argument sein? Es ist ein völlig legitimes Interesse der PsychologInnen,
die Veränderung von Erinnerungen über die Zeit zu erforschen,
was z.B. in der Aussagepsychologie
eine große praktische Rolle spielt.
Man geht also, ohne sich über den Grundcharakter
der zu betrachtenden Sphäre klar zu werden, von der theoretischen
Haltung aus. Die »H58.245.E7Erlebnisse«
findet man am Wege, man greift sie in roher Weise auf. (»H58.245.E8Erlebnisse
sind Empfindungen des Ich«, Th. Lipps) Aber man versäumt,
zuerst den Begriff des H58.245.e1Erlebens
überhaupt zu gewinnen. Ich muß das unklar Gemeinte in einen
Zusammenhang bringen, in dem es Sinn hat, von einem H58.245.e1Erleben
zu sprechen."
- KommentarH58.245: Was ist denn der "Grundcharakter"? Was Erlebnisse
"sind", muss wenigstens erklärt werden, wenn es nach Heidegger schon
keine Definitionen in der Phänomenologie gibt (H58.247) definiert
werden. Das aber macht Heidegger bisher an keiner untersuchten Stelle.
Erlebnisse findet man zwar auch "am Wege", aber in der experimentellen
Forschung geht man systematisch und methodisch vor.
Wir können uns nicht beruhigen bei der Alternative: Objekte H58.247.E1Erlebnisse; oder bei jenem Gemisch von Ausdrucks- und Objektbegriffen, die in der Psychologie infolge des »psychophysischen Zusammenhangs« üblich sind. Auch das genügt nicht, alle H58.247.E2Erlebnisse als »ichbezogen« anzusehen und das »Ich« in ihnen unmittelbar für vorfindbar zu halten. Jenes »reine Ich«, jener »Ichpunkt« läuft nur leer mit, leistet nichts zur Erfassung der H58.247.E3Erlebnisse, ist ungeeignet zur Rolle des Selbst. Muß überhaupt das »Ich« in jedem Erlebnis vorfindbar sein? Gibt es nicht auch »exzentrische« H58.247.E4Erlebnisse? (Man könnte ja daran denken, H58.247.E5Erlebnisse als ichbezogen zu »definieren«. Aber in der Phänomenologie gibt es keine H58.247.D1Definitionen.)
| KommentarH58.247.D1: Ein bemerkenswertes Bekenntnis: "in der Phänomenologie gibt es keine Definitionen." |
Das »reine Ich« leistet nichts für die Erkenntnis
des lebendigen Zusammenhangs der H58.247.E6Erlebnisse.
Wie aber soll man den Zusammenhang zwischen den H58.247.E7Erlebnissen
auffinden? Wie die Beziehung zwischen H58.247.e1Erleben
und Leben? Fallen Leben und H58.247.e2Erleben
zusammen? Besagen sie Verschiedenes?
- KommentarH58.247.E6: Was soll das sein, das "reine Ich"? Den Zusammenhang
findet man durch Erfahrung und Wissen. Die Tatsache, dass jemand ein Bedürfnis
befriuedigen konnte, verschafft ihm Erleichterung, Genugtun, Zufriedenheit.
Das ist der Zusammenhang. Schaltet man alle Erfahrung Wissen aus, ist das
nichts mehr und dann gibt es natürlich auch keinen Zusammenhang mehr.
Nein, Leben und Erleben fallen nicht zusammen. Lebden ist viel mehr, weiter,
umfassender als Erleben - jedenfalls in der Psychologie.
Unser Ausgangspunkt ist auch hier wieder das faktische Leben. Wenn
ich mein Leben »betrachte«, mich an ein H58.247.E8Erlebnis
erinnere, dann lebe ich in dem, was ich erlebt
habe, und in dem H58.247.E9Erlebnischarakter,
den ich H58.247.e3erlebt
habe, habe ich mich selbst und zwar viel konkreter, als ich »mich«
habe, wenn ich auf mein leeres »Ich« (künstlich) eingestellt
bin. (Es ist möglich, daß Natorp in seiner »Allgemeinen
Psychologie« dies meint, wenn er sagt, die Psychologie beschäftige
sich nur mit dem Inhalt des H58.247.e4Erlebens,
nicht aber mit dem »Ich« oder der Beziehung von »Ich«
zum »Inhalt«; vgl. Natorp, Allgemeine Psychologie I, Kap. II)2
Die Genesis des Ursprungsverstehens geht nun so vor [>248] sich, daß
ich mich in dem Erinnerten selbst habe. Damit komme ich zu dem Problem
des Mich-selbst-Habens. »Ich selbst« bin ein Bedeutsamkeitszusammenhang,
in dem ich selbst lebe.
- KommentarH58.248-Natorp: Weder Natorp noch die Behauptung Natorps belegt
Heidegger.
- KommentarH58.248-Selbstwelt: Was soll das denn sein, die "Selbstwelt?"
Allgemeine behauptende Mutmaßungen, ohne Beispiele wertlos.
16. Kritik der »transzendentalen Problematik«
das Begriffspaar: »Form Inhalt«
Wir suchen nach dem Grundsinn der Methode, in dem das Leben sich als
Leben lebendig erfaßt. Es besteht die Notwendig-keit der Zurückleitung
auf die Grunderfahrung des faktischen Lebens von sich selbst. Dieser Weg
über die Selbstwelt hat nichts zu tun mit der Psychologie. Das Problem
der Psychologie fällt aus unserer Betrachtung heraus; wir werden nicht
von der Psychologie bestimmt in unseren Begriffsbildungen und unserem Gegenstandsbegriff.
Man kann von der Wissenschaft von der Selbstwelt aus durch transzendentale
Betrachtungen zeigen, daß das psychologische Subjekt auf ein nichtpsychologisches
zurückweist. (Das ist der heute übliche Weg der Transzendentalphilosophie,
die von Kant ausging.) Wir aber schließen uns keiner Wissenschaft
an. Daraus entspringt uns die Gefahr, daß wir mit Begriffen aus dem
täglichen Leben arbeiten müssen, wie »Leben, H58.248.e1Erleben,
Ich, mich, Selbst«. Bei unserer Arbeit der kritischen Destruktion
(der Objektivierungen) sind diese Begriffe nicht eindeutig festgelegt,
sondern sie deuten nur hin auf gewisse Phänomene, sie zeigen in ein
konkretes Gebiet hinein, sie haben daher einen bloß formalen Charakter
(Sinn der »formalen Anzeige«), Die Untersuchung des formalontolo-[>249]gischen
Gerüstes dieser Begriffe ist wichtig; doch präjudiziert das Formale
nichts über die Dinge. Es besteht eine erste Gefahr darin, daß
bei der klaren Fassung der formalen Ideen diese für die Sachen selbst
genommen werden. Eine zweite Gefahr des reinen Formbegriffes ist, daß
er auf seinen Gegensatz, den reinen Materialbegriff führt. Damit gerät
das mit dem Materialbegriff Gemeinte (unvermerkt) in eine theoretische
Funktion."
H58.247: "Es ist eine Notwendigkeit den Begriff des
H58.247.e1Erlebens
ursprünglich zu bestimmen.
|
2H58.250: " 18. Die »weltliche« Richtung des faktischen Lebens
Im faktischen Leben leben wir immer in Bedeutsamkeitszusammenhängen, die ein selbstgenügsames Ausmaß haben, d. h. die zu sich selbst in ihrer eigenen Sprache sprechen. Versetzen wir uns, lebendig mitgehend, in solche H58.250.E1Erlebnisse, dann
- KommentarH58.250: Bedeutungszusammenhanänge sind keine Homunkuli,
die zu sich selbst sprechen, sondern ein konstruierter allgemein-abstrakter
Begriff. Sofern sie in Beziehung zueinander stehen, kann dies nur durch
Denkem, Exploration und Experiment herausgefunden werden, alkso die die
von der Phänomenologie abgelehnten empirischen Wissenschaft.
- KommentarH58.250-selbst-haben: Was soll denn das heißten "sich
selbst haben?
In der Art und Weise, wie sich das H58.250.e1Erleben
gibt, drückt sich die Rhythmik unserer eigenen Existenz aus. Die faktische
Lebenserfahrung ist im wörtlichen Sinn »weltlich gestimmt«,
sie lebt immer in eine »Welt« hinein, sie befindet sich in
einer »Lebenswelt«.
- KommentarH58.250-Rhythmik: Das ist eine unbelegte Behauptung und zudem
unklar, was damit überhaupt gesagt werden soll.
Ich muß mich bei dieser Betrachtung aller H58.250.E2Erlebnisbegriffe
entschlagen, aus der jetzigen oder einer besseren zukünftigen Psychologie;
ebenso aller »erkenntnistheoretischen« Grundanschauungen über
»Wirklichkeit« etc. Ich frage nun, wie ich in der konkreten
Erfahrung selbst lebe, wie ich dabei beteiligt bin (Weise des »Vollzugs«).
| KommentarH58.250-selbst-lebe: die Frage beruht auf der Begriffsbasis: konkret, Erfahrung, selbst, lebe, dabei beteiligt sein (Weise des »Vollzugs«). |
- KommentarH58.250-immanente Reflexion: was soll das denn sein, etwa
während des "inneren Erlebens"? Wieso sollte man in der "natürlichen
Einstellung" - die auch nicht erklärt wird - nicht zu Erlebnissen
kommen? Zerstört die Reflexion nicht das natürliche Erleben?
Auch hier bleibt völlig offen, was eigentlich gemeint ist und wie
man das macht.
H58.247: "Es ist eine Notwendigkeit den Begriff des
H58.247.e1Erlebens
ursprünglich zu bestimmen.
|
H58.251: "9. Das Vertrautsein mit sich selbst
Das »weltliche« Erfahren zeigt ein gewisses Vertrautsein
von mir selbst zu ihm. Die Begriffe »ich, mich, selbst« sind
hier noch ganz formal. Man kann gegen diesen Charakter am Leben, des
»Mir-Vertraut-Seins«, nicht einwenden, daß doch gerade
meine wertvollsten und entscheidendsten H58.251.E1Erlebnisse
oft den Charakter des »Neuen«, »Fremdartigen«,
»Uberraschenden« hätten. Denn gerade darin kommt zum Ausdruck,
daß ich mir immer irgendwie vertraut bin, daß hier eine bestimmte
Hemmung, ein Zurückgeworfenwerden aus dem Stadium der Vertrautheit
mit mir selbst vorliegt. "
H58.252: " Der Grundcharakter des faktischen Lebens, daß
ich mich im Erfahren selbst ausgedrückt finde, wird deutlicher sichtbar,
wenn sich das faktische Leben seiner selbst erinnert. In der Erinnerung
hebt sich die Artikulation des Lebens und seiner Bezüge auf mich selbst,
und dadurch wird der Charakter des Erfahrens sichtig. In der Erinnerung
an das H58.252.e1Erlebte
läßt sich, viel unmittelbarer als im damaligen H58.252.e2Erleben
selbst, verfolgen, was in der Weise des H58.252.e3Erlebthabens
beschlossen ist, wie das Erinnerte seinen ganz spezifischen Charakter hat,
in dem es mir vertraut ist.
- KommentarH58.252-Hommunkulus faktisches Leben: Das faktische Leben
ist kein Homunkulus, kein autonomes handelndes Subjekt, das sich selbst
erinneren kann, sondern ein allgemein-abstrakter Begriff. Ein Wesen mit
Gedächtnis kann sich erinnern, z.B. an ein Stück Leben. Was soll
heißen: "was in der Weise des Erlebthabens beschlossen ist,"?
der phänomenologischen Forschung
Der Psychologe wird sagen, daß seien alles vage Begriffe; es gäbe nicht Präzises wie »Erinnerungsrückstände, Einprägungs-und Reproduktionsziele« etc. Aber wir lassen uns nichts von ihm hereinreden. Wir haben andere Maßstäbe von Strenge als er. Man darf sich aber auch nicht die Aufgabe der phänomenologischen Lebenserforschung erleichtern, indem man sagt: Jedes H58.252.E1Erlebnis ist H58.252.E2Erlebnis eines Ich. Also bin ich bei jedem H58.252.E3Erlebnis eo ipso dabei. Denn wir haben ja noch gar keinen Begriff von einem »H58.252.E4Erlebnis«. Diesen wollen wir gerade erst radikal bestimmen."
| H58.252-Begriff Erlebnis liegt noch nicht vor: "Denn wir haben ja noch gar keinen Begriff von einem »H58.252.E4Erlebnis«. Diesen wollen wir gerade erst radikal bestimmen." Ein klares Eingeständnis. S. 247 wurde das Ziel formuliert und auf S. 252 bekennt Heidegger, dass wir noch gar keinen Begriff von einem Erlebnis haben. |
H58.253: "21. Gliederung der Problematik des Sich-selbst-Habens
Unser Problemkreis des Sich-selbst-habens im faktischen H58.253.e1Erleben
gliedert sich folgendermaßen:
1) Herausstellung des Sinns des Bezugs des Sich-selbst-habens.
2) Herausstellung des Sinns des dabei gehabten Selbst Phänomen
der Situation.
3) Der ganze Problemkomplex (1), (2) erfährt eine Steigerung:
das phänomenologische Verstehen selbst sondert sich in die einzelnen
Strukturformen: Motiv, Tendenz, H58.253.E1Erlebnis,
H58.253.E2Erlebniszusammenhang."
H58.254: "22. Die Stufen des phänomenologischen Verstehens
So finden wir die folgenden Schritte der phänomenologischen Methode:
1) Zunächst, wenn man vorurteilslos mit der
Betrachtung anfängt, ist sie ein Hinweisen auf eine bestimmte Sphäre
des faktischen Lebens.
2) Damit verknüpft sich ein erstes Fußfassen
in der Lebenserfahrung, gleichgültig welche im einzelnen betrachtet
wird. Dies Fußfassen ist kein Stehenbleiben, sondern ein Mitgehen,
ich werde dabei von der Strömung des Lebens mitgerissen. Es ist das
unmittelbare Mitmachen des H58.254.e1Erlebens.
(Damit scheint Husserls »phänomenologische
Reduktion« in ihr Gegenteil verkehrt. Dort mache ich gerade nicht
mit, nehme keine Stellung, übe epoch [Epoche].
Doch ist dies nur die negative Seite der Sache. Man kann die phänomenologische
Reduktion nur dann so charakterisieren, wenn man von vornherein die H58.254.E1Erlebnisse
sämtlich als intentionale ansieht und außerdem noch von dingerfassenden
H58.254.E2Erlebnissen
(z.B. Wahrnehmungen) ausgeht.
Geht man vom Verstehen selbst aus, so kommt man gerade zur Forderung
des »Mitmachens« der persönlichen Lebenserfahrung mit
größter Lebendigkeit und Innerlichkeit).
3) Es folgt das Vorschauen, Vorausspringen der phänomenologischen
Intuition in die Horizonte, die in der Lebenserfahrung selbst gegeben sind,
in die Tendenzen und Motive, die in [>255] der Lebenserfahrung liegen.
Das ist nicht erlernbar. Es ist entscheidend für das produktive Sehen
der Phänomene selbst.
4) Dann kommt die Artikulation des Gesehenen, das
Herausheben der einzelnen Momente des Phänomens.
5) (Es ist noch einzuschalten:) die Interpretation
der Phänomene.
6) Endlich folgt die eigentliche Gestaltgebung des
phänomenologisch Geschauten, die die Zerrissenheit der articuli wieder
zusammenfügt. Hier tritt die Phänomenologie in enge Beziehung
zur Kunst.
Im Verlauf (des »Mitgehens« oder) der
»Artikulation« arbeitet die phänomenologische Methode
schon mit Hilfe einer kritischen Destruktion
der Objektivierungen, die immer bereit sind, sich den Phänomenen anzusetzen.
Damit scheint das anschauliche Verhalten verlassen und ein diskursives
Denken an seine Stelle zu treten. Ich sage ja vor allem, daß das
Phänomen das und das nicht ist. Dies kann nur in der Art und Weise
einer Argumentation, gewissermaßen dialektisch vollzogen werden.
Wir stoßen hier auf das Problem des Verhältnisses der Anschauung,
des reinen Verstehens und des dialektischen Ausdrucks in Begriffen.
Wir wollen nun versuchen, den Prozeß des phänomenologischen
Verstehens selbst durchzuführen. Wir wollen sehen, wie wir in unserer
faktischen Lebenserfahrung uns selbst haben.
Die Abgrenzung gegen die »wissenschaftliche«
Erkenntnis der Selbstwelt, die Psychologie, hatten wir vollzogen.
Wir fragen also: Wenn ich mit einer faktischen Lebenserfahrung
selbst mitgehe, die ursprünglich »weltlich« gerichtet
ist, wie habe ich da mich selbst, obwohl mein Selbst ganz in dieser Erfahrung
aufgeht, sich in ihr spiegelt, mit ihr mitgeht?
Am besten sieht man das, wenn eine gewisse Distanz
zwischen der betrachteten Erfahrung und der jetzigen besteht. (Am besten
nehme man ein für mich besonders bedeutsames H58.255.E1Erlebnis.)
Was habe ich damals erlebt ohne irgendeine
Reflexion auf mich selbst?"
- KommentarH58.255-Stufen-phänomenologischen-Verstehens: Es wird
nicht klar, inwiefern hier das in H58.253 formulierte Ziel des Sich-selbst-Habens
befördert wird. Auch bleibt völlig unklar, was das mit dem H58.247
formulierten Hauptziel, einen phänomenologischen Begriff des Erlebens
zu finden, zu tun hat.
H58.259: "Hier besteht wieder eine Gefahr, in Objektivierung zu
verfallen. Man ist versucht, aufzuzählen, was von mir in diesem Moment
gerade erfahren und H58.259.e1erlebt
wird. Die inhaltliche Mannigfaltigkeit würde dann den Charakter der
Situation ausmachen. Weiter käme man zu »letzten Daten«
und schließlich zur raumzeitlichen Bestimmung der Situation (bestimmte
Stelle des objektiven Raums in einem bestimmten objektiven Zeitpunkt).
Aber die Gehaltsform hat ihren letzten Sinn in der Lebenserfahrung selbst.
Raum und Zeit haben in ihrer ursprünglichen Form in der Sphäre
des Lebens, als Bedeutsamkeiten, ihre Funktion in der Situation. (Von der
»objektiven« Raum-Zeit-Form aus gesehen ist das die ins volle
Leben (zurück-)transponierte Form.) Das Problem der Zeit ist mit dem
der Situation verbunden.
Man verdankt Bergson4 die entscheidende Leistung
der Abscheidung der »durée concrète« von der
objektiven »kosmischen« Zeit. Wir können darauf nicht
näher eingehen.
Es gibt Situationen, in denen ich Erfahrungen H58e1erlebe,
die mir [>260] verborgen sind (»Schicksal«, »Fügung«).
Sie können mir absolut unverständlich sein. Trotzdem kann ich
mich selbst in dieser Situation auf das klarste verstehen. Situation
ist eben der eigentümliche Charakter, in dem ich mich selbst habe,
nicht den Inhalt des H58e2Erlebten.
Der Umkreis des Verständlichen [.. .]* das Sich-Selbst-Haben, das
ein Prozeß des Gewinnens und Verlierern der Vertrautheit mit dem
Leben ist. "
Anmerkung: Das Buch hat noch drei Seiten, bis 263, aber H58e2Erlebten war die letzte Fundstelle.
Heidegger-Band-59 [In Arbeit]
Heidegger, Martin (1919/1920) Gesamtausgabe II. ABTEILUNG: VORLESUNGEN
1919-1944 BAND 59 PHÄNOMENOLOGIE DER ANSCHAUUNG UND DES AUSD RUCKS.
Frankfurt: Klostermann.
https://heidegger.ru/wp-content/uploads/2019/12/Band-59.pdf
erleb 237, erleben 52, erlebt(e,en,es) 8, Erlebnis 168.
defin 3, definiert 1, definieren 0, Definition 2.
Im Inhaltsverzeichnis
- b) Leben als Erleben und das Problem
des Irrationalen (das H59.IV.E1Erlebnisproblem)
23
a) In welcher Tendenz geht Natorp an den H59.IV.E2Erlebniszusammenhang heran ? 112
b) Welches ist der Einheits- und Mannigfaltigkeitscharakter des H59.IV.E3Erlebniszusammenhangs? 115
ZWEITER TEIL Zur Destruktion des H59.IV.E4Erlebnisproblems
c) Wie verhält sich das Ich im H59.IV.E5Erlebniszusammenhang? 122
12f: "§ ? . Lebensphilosophie und Kulturphilosophie -
die beiden Hauptgruppen der Gegenwartsphilosophie
Die heute stark betonte, aber nicht eindeutige Einstellungsrich-
tung auf die Lebenswirklichkeit, Lebensförderung und Le bens
steigerung sowie die üblich gewordene und viel gepflegte Rede
[>13]
von Leben, Lebensgefühl, H5912f.E1Erlebnis
undH5912f.r1Erleben
sind die vielfäl-
tig motivierten Merkzeichen unserer geistigen Lage. Es kann
sich hier nicht darum handeln, den reichen Motivzusammen
hang, wie er sich von der Aufklärung her ausgebildet hat, in
seiner Konkretion auch nur anzudeuten. Ein Hinweis auf die
Momente, aus denen die Problematik der heutigen Philosophie
sich vorwiegend bestimmt, sei gegeben."
Heidegger-Lexikon [In Arbeit]
Kein Sachregister
Fundstellen: erleb 8, erleben 2, erlebt 1, Erlebnis... 5
Literatur (Auswahl)
Links(Auswahl: beachte)
- Gesamtausgabe: https://heidegger.ru/
- https://heidegger.ru/wp-content/uploads/2019/12/Band-58.pdf
- https://heidegger.ru/wp-content/uploads/2019/12/Band-59.pdf
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Destruktion
Nach meinem Eindruck Variante der Reduktion / Epoche. Begrifflichkeiten werden durch Destruktion oder Reduktion von Fremdelementen gereinigt und der phanämenologische Kern freigelegt.
Heidegger Lexikon:
"Destruktion Begriff und Sache der Destruktion sind in Heideggers früher phänomenologischer
Arbeit bis zu SuZ methodischer Schlüssel Die Destruktion ist vielmehr der eigentliche
Weg, auf dem sich die Gegenwart in ihren eigenen Grundbewegtheiten
begegnen muss (62: 368) Auch im Zusammenhang mit der Rekonstruktion des
Vergangenen spielt die Destruktion eine maßgebliche hermeneutische Rolle
Durch die Begegnung mit der Geschichte springe der Gegenwart die Frage entgegen,
wie weit sie selbst um Aneignung radikaler Grunderfahrungsmöglichkeiten
und deren Auslegung bekümmert ist (62: 368) Damit legt die Destruktion
auch die jeweilige hermeneutische Situation frei.
- Kommentar: Die Gegenwart ist kein Homunkulus,
der sich als autonomes Subjektiv selbständig bewegen kann, sondern
eine geistige Kontruktion. Die Gegenwart kann auch nicht springen. Das
ist
Sch^3-Sprache
jenseits aller Wissenschaft.
Destruktion leistet einen Abbau, um den überlieferten Begriffsbestand der
Denkgeschichte auf seinen Ursprung, bzw seine Grunderfahrungen zurückfüh-[>]
ren Zugleich wird auf diesem Wege die Aufklärung der Unangemessenheit der
Begriffe an das Dasein vollzogen (17: 117f ) Dieses werde in der Denkgeschichte
selbst verbaut. ...."
__
Nationalsozialist
Heidegger war begeisterter Nationalsozialist, Antisemit und glühender Verehrer Hitlers; Parteimitglied seit 1.5.1933. Das Ausmaß seines Antisemitismus wurde 2014 mit der Veröffentlichung seiner "Schwarzen Hefte" überdeutlich:
- https://heidegger.ru/wp-content/uploads/2019/11/96-%C3%9CBERLEGUNGEN-XII-XV.pdf
- https://heidegger.ru/wp-content/uploads/2019/12/Band-97.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger_und_der_Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Tr%C3%A4ger_des_Goldenen_Parteiabzeichens_der_NSDAP
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt [brach 1933 - Voltaire sei Dank - den Kontakt zu Heidegger]
__
Standort: Erleben und Erlebnis bei Heidegger.
*
Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse
Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung *
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS) Erleben und Erlebnis bei Heidegger. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/Heidegger.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert:
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
03.01.2023 Angelegt. Bd. 58 gesichtet und erfasst.