Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT DAS=07.09.2001
Anfang_Fiedler IPt PS Teil 7-9 _ Überblick_Rel. Aktuelles_Rel. Beständiges_Titelblatt_Konzept_Archiv_ Region_Service-iec-verlag_Mail:_sekretariat@sgipt.org_Zitierung & Copyright_
__Anmeldung _
Willkommen in der Buchbesprechungs- & Rezensions-Abteilung der GIPT, Kapitel 7-8 und Schluß:
"Integrative Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen"
Fiedler, Peter (2000). Integrative
Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen. Göttingen:
Hogrefe.
373
Seiten. ISBN 3-8017-1355-5 DM 69.00 Eingang des Rezensionsexemplars
am 3.3.2000.
Rezension in 10 Teilen von Rudolf Sponsel, Erlangen (09.00-11/ 01)
Fiedler_3 Teil
7 _ Teil
8 _ Teil
9
Fiedler_2: _Teil
4 _ Teil
5 _ Teil
6
Fiedler_1: Teil
0 _ Teil
1 _ Teil
2 _ Teil
3 _ Anhang:
Materialien,
Belege, Querverweise
Teil 7 Differenzielle Indikation: Störungsspezifische Psychotherapie
Peter Fiedler verspricht (S. 158): "In diesem Kapitel werden konkrete
Behandlungsansätze für die unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen
vorgestellt (störungsspezifische Indikation). Dazu wird auf bereits
bestehende störungsspezifische Behandlungskonzepte zurückgegriffen.
Die vorgenommene Auswahl wird zwangsläufig nicht die Vielfalt der
heute bereits vorhandenen Behandlungsansätze berücksichtigen
(können). Sie wird hier eingeschränkt erfolgen, und zwar mit
Blick auf ätiologische Überlegungen, die wir den Störungsbildern
jeweils voranstellen werden. Wir folgen damit jenen Voraussetzungen, wie
sie in Kapitel 4 für die schulunabhängige integrative Ableitung
therapeutischer Maßnahmen empfohlen wurden, nämlich denen einer
ätiologietheoretisch
begründete Differenzialindikation. Diesen Vorgaben entsprechend
sollen therapeutische Schwerpunkte so weit wie möglich im Sinne einer
multimodular aufgebauten Psychotherapie festgelegt und begründet
werden." Weiter heißt es zutreffend:
| "Obwohl die Behandlungskonzepte spezifisch für jeweils einzelne Persönlichkeitsstörungen gelten, erfordern sie dennoch und zusätzlich eine individuelle Anpassung an den jeweils gegebenen Einzelfall. Ob und wie die Konzepte einsetzbar sind, hängt u.a. vom psychosozialen Funktionsniveau der Patienten ab, vom Ausmaß der sozialen Einbindung und des sozialen Rückhalts zur Zeit der Therapie - weiter davon, ob eine beruflich-existenzielle Grundsicherung vorhanden ist oder nicht, ob die Therapie ambulant oder stationär durchgeführt werden soll, von der Vertrautheit des Therapeuten mit dem vorliegenden Störungsbild, sowie von vielen anderen Aspekten mehr, die in den vorhergehenden wie nachfolgenden Kapiteln zur Sprache kommen." |
| Spätestens an dieser Stelle müssen wir uns aber fragen, wehalb Peter Fiedler nicht gleich eine richtige und konsequente idiographische Position bezieht? |
Wie man schon an der Formulierung sieht, ist "Persönlichkeitsstörung" etwas von der Realität des Menschen, von seiner und der Behandlungs-Situation Abhobenes, Abstrahiertes. Natürlich wird man für jede Behandlung Abstraktionen vornehmen müssen. Die entscheidende Frage ist indessen, wie weit man geht und ob man sich von solch dubiosen Klassifikations-Konzepten, wie sie diagnostisch fehlgeleitet im ICD und DSM aufbereitet worden sind, verführen und leiten lassen soll? Am ICD und DSM und analogen Systemen ist gut, daß man begonnen hat, orientierende operationale Kriterien zu entwickeln und schlecht bis katastrophal, daß man diese Kriterien kombinatorisch vermantscht in Störungsklassen hineinpackt (für die Borderline-Störung gibt z. B. nach vormals 56 nunmehr 126 Typenkombinationen und kein Mensch weiß, wie solche Kombinatorikspiele zustande kommen und begründet werden). Dahinter steckt natürlich auch das Forschungsinteresse nach der Vereinfachung der Welt und die nicht selten oberflächlich- empirische Therapieforschung.
Und Peter Fiedler setzt auch noch ein drauf: "Des Weiteren ist es günstig,
störungsinhärente
Aspekte nicht zu vernachlässigen: z.B. die Komorbidität mit spezifischen
psychischen Störungen (somatoforme Störungen, Ängste, Phobien,
dissoziative und Traumastörungen usw.) oder das bei bestimmten Persönlichkeitsstörungen
gegebene Risiko der Entwicklung psychischer Störungen (häufig
Depression, Suizidalität; seltener Schizophrenie). Gerade mit Blick
auf diese zusätzlichen Aspekte zeigen Forschungsarbeiten zum Verlauf
und zur Prognose, dass es beträchtliche Unterschiede gibt, wie
persönlichkeitsgestörte Patienten auf die Behandlung ansprechen
( - Kapitel 3; vgl. auch Shea, 1993)."
| Und genau weil das so ist, sollte man überhaupt Abschied nehmen von realitätsfernen Klassifikationen (Probleme der Typologie hier) und Subsumptionen und stattdessen eine solide idiographische Konzeption aufbauen. Dazu scheint die Wissenschaft nicht willens oder fähig. Nun ja, sie sitzen an ihren Schreibtischen und Computern, aber von richtiger klinischer Arbeit mit richtigen Menschen im richtigen Leben haben sie oft keine Ahnung. Aber 'beforschen' wollen sie uns. Warum nicht? Aber in Gotten Namen: was? Konstrukte und Fiktionen, die es gar nicht gibt? |
Es folgt nun die Besprechung der Borderline- Persönlichkeitsstörung
(BPS). Hier wird das ganze diagnostische Chaos wiederum deutlich. Was nun
genau eine BPS ist, bleibt unklar. Zwei Haupttypen - Nicht- und Traumatisierte
- werden unterschieden, womit das Problem auf den inzwischen noch schwierigeren
Traumatisierungsbegriff verschoben wird.
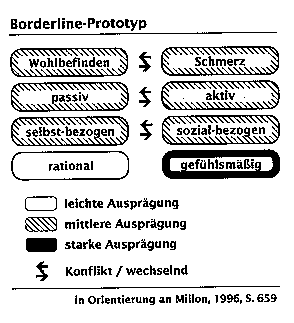 |
|
Peter Fiedler kommt sodann auf das äußerst umstrittene und schwierige Gebiet der Identitätsstörungen zu sprechen.
Bei den meisten Betroffenen sind wegen der genannten Auffälligkeiten
im emotionalen Erleben deutliche Störungen in der Wahrnehmung ihres
Selbst und Anderer sowie Störungen in der Identitätsfindung vorhanden.
Wegen der affektiven Dysregulation sind eine gesteigerte Feindseligkeit
gegen sich selbst und andere (selbst- und fremddestruktive Tendenzen),
dissoziative Störungen und Amnesien sowie Konversionsstörungen
boobachtbar. Die Probleme der Identitätsstörungen sind vielfältig:
Unvermittelt auftauchende Nahziele und kurzfristige Bedürnisbefriedigung
können nicht zu Gunsten weiter gespannter Zielvorstellungen oder zu
Gunsten der Etablierung stabiler Beziehungsfor[163]men und einer Kongruenz
mit tragfähigen Wertvorstellungen aufgegeben bzw. zurückgestellt
werden (Herpertz, 1999). Die Folge sind: sich häufig ändernde
Ausbildungsziele und Anstellungen, wechselnde Bezugsgruppen und Intimpartner.
Spontane und fluktuierende Gefühlsorientierung interferiert auf diese
Weise mit dem Aufbau einer stabilen Selbstidentität und dauerhafter
Wertbestände, von denen aus Verhalten verlässlicher gesteuert
werden könnte.
Auch Millon (1996; -> Prototyp) unterstellt in seiner
Zusammenschau bisheriger Forschungsergebnisse eine Dominanz der Gefühlsorientierung
gegenüber einem an rationaler Vernunft orientiertem Handeln, woraus
sich Konflikte und Ambivalenzen in den drei übrigen Polaritäten
ergeben: einerseits eine starke Ambivalenz und Inkonsistenz hinsichtlich
des Erlebens von positiven und negativen Emotionszuständen (Schmerz
vs. Wohlbefinden), eine Schwierigkeit in der Vorhersagbarkeit des Verhaltens
(schwankend zwischen aktiv und passiv), sowie schließlich starke
Konflikte hinsichtlich der Getühle, Erwartungen und Einstellungen
gegenüber sich selbst wie gegenüber anderen.
Selbstschädigendes Verhalten und Störungen der Impulskontrolle
Wenn Traumatisierung für das bisherige Leben von Borderline-Patienten
eine Verantwortlichkeit trägt, bleibt aus lernpsychologischer Sicht
zu beachten, dass das Trauma "reinszeniert" werden kann. Da Patienten gelernt
haben, sich an traumatische Situationen anzupassen, tendieren viele dazu,
misstrauisch zu sein, keine klaren Signale zu geben und in Momenten, in
denen die Realität der therapeutischen Beziehung ihnen keine Sicherheit
bietet, aggressiv zu reagieren - dies vor allem dann, wenn z.B. heikle
oder bedrohliche Themen angesprochen werden oder wenn es zu Kränkungen
kommt (Benjamin, 1995).
Eines der großen Geheimnisse bei der Verarbeitung
traumatischer Erfahrungen besteht darin, dass solange, wie das Trauma als
sprachloser Stressor erfahren wird, der Körper fortfährt, die
Erfahrungen festzuhalten und auf konditionierte Stimuli so zu reagieren,
als kehre das Trauma wieder (Van der Kolk, 1999). Insbesondere Patienten,
die auf sexuelle Missbrauchserfahrungen zurück blicken, sind nicht
selten jene, die am ehesten in der Gefahr stehen, von unerfahrenen Therapeuten
erneut missbraucht zu werden.
Es scheint sogar so, dass Dissoziationen
(ähnlich einer konditionierten Reaktion) recht leicht gelernt
werden können. Sind sie einmal konditioniert, kann Stress automatisch
bzw. autoregulativ zu Dissoziationsphänomenen führen,
z.B. zu Tranceähnlichem Verhalten, zu Depersonalisation und zu Erinnerungsverlust
(Fiedler, 1999 a). In diesem Zustand fühlt sich die Person abgestumpft
und beziehungslos. Bezugspersonen (gelegentlich sogar die Therapeuten)
tendieren in solchen Situationen vorschnell dazu, erheblich frustriert
darüber zu sein, wenn ein Patient plötzlich (willentlich oder
unwillentlich) unfähig erscheint, angemessen zu reagieren und "verantwortlich"
zu handeln." (S. 163)
Zusammenfassend wird die BPS charakterisiert:
|
|
Es folgt nun in Anlehnung an Millon eine erste allgemein-modellhafte Therapiezielorientierung (fett-kursive Hervorhebung von mir):
"7.1.2 Erste therapeutische Ziele
Aus Millons Polaritätenprofil ( - oben) ergeben sich einige grundlegende
Ziele für die Psychotherapie: einerseits eine Stabilisierung
und kognitive Differenzierung der Emotionsregulierung, andererseits
eine Integration oder Suche nach Balancierung der unklaren und konfligierenden
Entitäten Schmerz, Aktivität und Beziehung. In der therapeutischen
Arbeit müssen also alle vier Dimensionen unseres Bedürfnis-Circumplex
beachtet werden. Bei Borderline-Patienten heißt dies zusammengefasst:
Aufbau einer stabilen psychischen Struktur mit dem Ziel tragfähiger
Normen, Werte und Lebensleitlinien, die es ermöglichen, den Betroffenen
eine grundlegende Sicherheit im Umgang mit bestehenden Konflikten und Ambivalenzen
zurück zu geben.
Im Bedürfnisraum- Modell deuten sich weitere konkrete Ziele an,
was die zukünftige Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen angeht
( -> Abbildung 7.1): Für einige Patienten könnte es sich
lohnen, gezielt Kompetenzen im Bereich stabiler und zwischenmenschlich
enger Beziehungen zu entwickeln (Loyalität, Anhänglichkeit, Intimität
usw.). Für andere Patienten stellt sich möglicherweise die Frage,
ob zukünftige Lebensperspektiven nicht besser mit mehr Zurückhaltung
gegenüber engen zwischenmenschlichen Beziehungen und durchaus mehr
auf sich allein gestellt entwickelt und gelebt werden sollten."
| Da es sich um ein Therapiebuch handelt, hätte ich erwartet, daß ausführlich ätiologie- bezogene Therapiemethoden und Interventionen beschrieben werden, wie man das nun praktisch macht, Identitätsstörungen, Selbstschädigendes Verhalten, Störungen der Impulskontrolle, Beziehungsstörungen, Rollenfluktuation und Starre affektiv-kognitive Schemata zu verändern. Darüber erfahren wir fundiert in Fallbeispielen wenig bis nichts. Es werden aber eine ganze Reihe von - auch angeeigneten - verhaltenstherapeutischen Methoden erwähnt, woraus hervorgeht, was Peter Fiedler unter "Integrativer" Psychotherapie versteht: störungsspezifische Verhaltenstherapie. Die eigentliche integrative psychotherapeutische Arbeit bleibt ein Geheimnis. Sehr positiv ist zu vermerken, daß ausdrücklich auf die Gefahren des False- Memory- Syndroms (S. 175f) hingewiesen wird. Weniger günstig erscheint, daß die Begriffe sehr alltagssprachlich und unscharf verwendet werden (z. B. angemessene Rollenwechsel versus unangemessene bei der histrionsischen Störung, 250f). |
Es folgen analoge Darstellungen der anderen Persönlichkeitsstörungen
(dissoziale, schizotypische, schizoide, zwanghafte, dependente, selbstunsichere-
und ängstlich vermeidende, paranoide, negativistische, histrionsische,
narzisstische). Die Praxis-, Fall- und integrative Methodenferne
durchzieht das ganze Buch und vor allem auch dieses Kapitel, immerhin das
7. und vorletzte (wird im Schlußteil noch kritisch erörtert).
Zum Abschluß möchte ich noch kurz auf den Abschnitt über
die paranoide Persönlichkeitsstörung eingehen, um zu sehen welche
"integrativen" Psychotherapiemöglichkeiten für die Behandlung
von Wähnen, Wahn, Argwohn, Mißtrauen gesehen werden. Hier wird
leider nur festgestellt, daß die Therapieschulen Psychoanalyse, Interpersonelle
Psychotherapie, Verhaltenstherapie und Kognitive Therapie sich darin einig
seien, es käme auf eine vertrauensvolle Beziehung an,
auf deren Basis und dann der Schwerpunkt Konfliktberatung und pychosoziales
Konfliktmanagement entwickelt werde.
| Dies führt zu einer in Therapiekonzepten oft beobachtbaren Paradoxie: um eine Störung zu beseitigen wird ein Verhalten gefordert, dessen Nichtbeherrschung gerade mit zu dieser Störung gehört, womit sich die Katze sozusagen zirkulär in den Schwanz beißt. Wie soll eine vertrauensvolle Beziehung bei einer paranoiden Grundstörung auf den Weg gebracht werden? Paranoid bedeutet doch per definitionem mißtrauisch, argwöhnisch, wähnen, starrsinnig, schwer beeinflußbar. |
Hier zitiert Peter Fiedler (S. 237, fette Hervorhebungeb von mir) den Verhaltenstherapeuten Turkat, der sich gegen den verbreiteten Behandlungspessimismus bei paranoiden Störungen wendet:
"Turkat schlägt vor, eine vertrauensvolle
therapeutische Arbeitsbeziehung aufzubauen, die durch eine ruhig-sachliche,
formale und respektvolle Art der Kooperation
bestimmt werde. Ziel sei es prinzipiell, für maladaptive Interaktionseigenarten
alternative Perspektiven zu finden, die zunächst überhaupt nicht
zugleich den Zielen und Wunschvorstellungen der Patienten zuwider laufen
müssten. Vielmehr seien die Gründe für das Misslingen
bisheriger Problemlösungsversuche zum Behandlungsthema zu machen.
Eine daran anknüpfende, sachliche Suche nach alternativen Lösungen
für zwischenmenschliche Probleme beinhalte nämlich überhaupt
keine direkte Kritik der vorhandenen (paranoiden) Einstellungen. Problem-Lösungssuche
für alltägliche Krisen und Konflikte sei für die meisten
Patienten eher erwünschtes Therapieziel.
Die angestrebte Suche nach Handlungsalternativen
selbst ließe sich gar nicht ohne inhaltliche Bezugnahme auf Wunschvorstellungen,
Einschränkungen, zu erwartende Kritik und Normierung der Bezugspersonen
und Konfliktpartner entwickeln. Bei der sachlichen Entwicklung von Lösungsmustern
für zwischenmenschliche Krisen sei die kontinuierliche Bezuguahme
auf erwartbare Konsequenzen sehr entscheidend, realistische und
sozial vertretbare Perspektiven zu entwickeln. Die paranoiden Konstruktionen
der Betroffenen - und das bleibe durchgängig zu beachten - würden
dabei nur en passant thematisch werden, dann mit Blick auf mögliche
Konsequenzen durchaus hinterfragbar sein. Andererseits bräuchte in
diesem Zusammenhang nicht auf die Eigenarten des persönlichen Stils
eingegangen werden, zumal es vorrangig um die Entwicklung sozial erfolgreicher
(d.h. angemessener) Problemlösungsversuche und damit um die Entwicklung
besserer Handlungsmöglichkeiten gehe."
Zusammenschau
der erwähnten oder empfohlenen Methoden
| Peter Fiedler führt im einzelnen nicht aus, wie genau was gemacht wird. Das ist manchmal kein großes Problem, weil über veröffentlichte Therapieprogramme nachschlagbar; teilweise aber schon, weil die - gewöhnlich Verhaltenstherapie - Programme selbst manchmal oberflächlich sind und auf die eigentlichen Kernprobleme gar nicht und nicht genügend eingehen. Es sagt sich z. B. so leicht, Selbstwertgefühl aufbauen oder Schuldgefühle abbauen. Ja, aber wie geht denn das? Und was vor allem ist das spezifisch "Integrativ" Psychotherapeutische? Hier bleibt dieses große Inhaltskapitel die Antwort weitgehend schuldig. Das Kapitel entwirft mehr so eine Art "Leitlinien", ohne wirklich praktisch substanziell zu sein. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, das Kapitel auf die erwähnten bzw. empfohlenen "Methoden" - es sind oft nur Worte und Namen - durchzusehen. Dabei kamen eine ganze Menge heraus, wobei aber leider oftmals ziemlich im Dunkeln bleibt, wie das nun wirklich praktisch genau funktioniert und das das spezifisch "Integrative" sein soll. Das (VT-) Vokabular spricht jedenfalls für sich - wovon sich jede LeserIn selbst überzeugen kann: |
Erläuterung: "a < b" heißt hier: b umfaßt a, b ist
die allgemeinere Methode, a Spezfikation von b; alphabetisch sortiert.
10
20
30
40
50 (da stützen = unterstützen)
60
Teil 9 Zusammenfassende Würdigung
[F28]
[F29]
[F30]
[F31]
Anwendungen, Beispiele, Fälle
"Briefdiagnostik" Über 100 Briefe zum Buch PS erhalten 15 ff und Bin ich ein Luftwesen? 196 f
Fallbeispiel Psychosoziales Konfliktmanagement nach Suzidversuch 212f (3/4 Seite)
Beispiel Gruppeneingangsinformation nach Renneberg & Fydrich 223f (18 Zeilen)
Fallbeispiel Histrionsich, narzisstisch; Suizidversuch nach Trennungsdrohung 253f (3/4 Seite)
Fallbeispiel Supervision, Teil 1 255 (1 1/2 Seiten)
Fallbeispiel Teil 2 Depressiver, narzisstischer Kollege, 262-268
Fallbeispiel (Epilog), Teil 3 Therapie als Supervision 270-271
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte des Autors
Ausgewählte Veröffentlichungen des Autors auf seiner Homepage Zur Homepage von Peter Fiedler: https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/AE/klips/mitarbeiter/fiedler/index.html
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Rezension in 10 Teilen, hier ab Kapitel 7 (Teil8):Fiedler, Peter (2000). Integrative Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen. Internet Publikation für Allgemeine und Integrativerapie. IP-GIPT.Erlangen: https://www.sgipt.org/lit/r_fiedl3.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. In Streitfällen gilt der Gerichtsstand Erlangen als akzeptiert.
Ende _Fiedler IPt PS Teil 7-9 _ Überblick_Rel. Aktuelles_Rel. Beständiges_Titelblatt_Konzept_Archiv_ Region_Service-iec-verlag_Mail:_sekretariat@sgipt.org__
__Anmeldung _
Endkontrolle: noch nicht erfolgt.