(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=10.03.2002 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 15.03.17
Impressum: Dipl-Psych. Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org__Zitierung & Copyright
___ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Die Arbeitswertlehre von Karl Marx
5.5.1818 Trier - 14.3.1883 London
Gleich zur
Wertdefinition.
von Rudolf Sponsel,
Erlangen * Erstausgabe 10.3.2, Letztes Update 11.3.2
_

Bildnis aus dem Kapital I. 1867 |
Karl Marx ist im 20. Jahrhundert der wohl weltweit einflußreichste und auch umstrittendste Ökonom durch seine enge Vermischung von ökonomischer Wissenschaft, moralisch- politischer Weltanschauung und revolutionären Handlungsanweisungen: "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern". Diese Vermischung war der größte und verwirrendste wissenschaftliche Fehler, der die Wissen- schaft letztlich auf ein Propaganda- Instrument politischer Interessen zuspitzte. Dennoch ist sein Werk sehr wichtig für die Kultur-, Politik- und Sozialgeschichte, das immer noch eine Auseinandersetzung erfordert und verdient. |
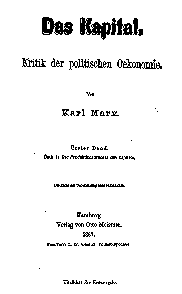 |
Vorbemerkung: Marxens Wert-Analyse
von Waren beruht auf den Klassikern der (englischen) Nationalökonomie
von Adam Smith und David
Ricardo. Der Fehler der Klassiker (Smith, Ricardo, Marx) besteht hauptsächlich
in der falschen Annahme, der Wert einer Sache (Wirtschaftsgutes) ließe
sich objektiv bestimmen. Diese ökonomische Lehre wurde
durch die sog. Grenznutzentheorie, die
die Subjektivität und Wandelbarkeit der ökonomischen Werte m.E.
zu Recht annimmt, überwunden. Die Arbeiten der Klassiker und insbesondere
von Karl Marx ist - neben vielen anderen Leistungen - aber schon deshalb
nach wie vor sehr wichtig und wahrscheinlich zeitlos aktuell, weil die
Kern- und Gretchenfrage, um die es in der Politischen - im Gegensatz zur
rein wissenschaftlichen - Ökonomie geht durch die Schöpfung des
Mehrwert-Begriffs
einfach auf den Punkt zu bringen ist: Wer soll wie viel vom Mehrwert
haben? Diese Frage ist aber keine rein ökonomische und
nur bedingt wissenschaftliche, nämlich dann, wenn es z.B. darum geht,
zu untersuchen, welche Mehrwertverteilung zu stabilen politischen
Systemen (Aristoteles'sche
Staatslehre) führt. Anders formuliert:
| Mit Hilfe der Arbeit entsteht Gewinn und damit stellt sich die politische und ethische Frage nach seiner gerechten Verteilung. |
Nach der 4. Auflage Hamburg 1890, herausgegeben von Friedrich Engels, hier nach der Ausgabe der Europäischen Verlagsanstalt 1968:
Das Kapital, Bd. I
Erstes Buch
Der Produktionsprozeß des Kapitals
Erster Abschnitt
Ware und Geld
____
Erstes Kapitel
Die Ware
"1. Die zwei Faktoren der Ware: Gebrauchswert
und Wert (Wertsubstanz, Wertgröße)
Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine 'ungeheure Warensammlung' [EN-S49-1], die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware.
Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z.B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, ändert nichts an der Sache. [EN-S49-2] Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt, ob unmittelbar als Lebensmittel, d.h. als Gegenstand des Genusses, oder auf einem Umweg, als Produktionsmittel.
Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier usw., ist unter doppeltem Gesichtspunkt zu betrachten, nach Qualität und Quantität. Jedes solches Ding ist ein Ganzes vieler Eigenschaften und kann daher nach verschiedenen Seiten nützlich sein. Diese verschiedenen Seiten und daher die mannigfachen [>50] Gebrauchsweisen der Dinge zu entdecken, ist geschichtliche Tat. [EN-S50-3] So die Findung gesellschaftlicher Maße für die Quantität der nützlichen Dinge. Die Verschiedenheit der Warenmaße entspringt teils aus der verschiedenen Natur der zu messenden Gegenstände, teils aus Konvention.
Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert. [EN-S50-4] Aber diese Nützlichkeit schwebt nicht in der Luft. Durch die Eigenschaften des Warenkörpers bedingt, existiert sie nicht ohne denselben. Der Warenkörper selbst, wie Eisen, Weizen, Diamant usw., ist daher ein Gebrauchswert oder Gut. Dieser sein Charakter hängt nicht davon ab, ob die Aneignung seiner Gebrauchseigenschaften dem Menschen viel oder wenig Arbeit kostet. Bei Betrachtung der Gebrauchswerte wird stets ihre quantitative Bestimmtheit vorausgesetzt, wie Dutzend Uhren, Elle Leinwand, Tonne Eisen usw. Die Gebrauchswerte der Waren liefern das Material einer eignen Disziplin, der Warenkunde. [EN-S50-5] Der Gebrauchswert verwirklicht sich nur im Gebrauch oder der Konsumtion. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns zu betrachtenden Gesellschaftsform bilden sie zugleich die stofflichen Träger des - Tauschwerts.
Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen [EN-S50-6], ein Verhältnis, das beständig mit Zeit und Ort wechselt. Der Tauschwert scheint daher etwas Zufälliges und rein Rela[>51]tivcs, ein der Ware innerlicher, immanenter Tauschwert (valeur intrinsèque) also eine contradictio in adjecto. [EN-S51-7] Betrachten wir die Sache näher.
Eine gewisse Ware, ein Quarter Weizen z.B. tauscht sich mit x Stiefelwichse oder mit y Seide oder mit z Gold usw., kurz mit andern Waren in den verschiedensten Proportionen. Mannigfache Tauschwerte also hat der Weizen statt eines einzigen. Aber da x Stiefelwichse, ebenso y Seide, ebenso z Gold usw. der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen x Stiefelwichse, y Seide, z Gold usw. durch einander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Es folgt daher erstens: Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Zweitens aber: Der Tauschwert kann überhaupt nur die Ausdrucksweise, die "Erscheinungsform" eines von ihm unterscheidbaren Gehalts sein.
Nehmen wir ferner zwei Waren, z.B. Weizen urd Eisen. Welches immer ihr Austauschverhältnis, es ist stets darstellbar in einer Gleichung, worin ein gegebenes Quantum Weizen irgendeinem Quantum Eisen gleichgesetzt wird, z.B. 1 Quarter Weizen = a Ztr. Eisen. Was besagt diese Gleichung? Daß ein Gemeinsames von derselben Größe in zwei verschiednen Dingen existiert, in 1 Quarter Weizen und ebenfalls in a Ztr. Eisen. Beide sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Jedes der beiden, soweit es Tauschwert, muß also auf dies Dritte reduzierbar sein.
Ein einfaches geometrisches Beispiel veranschauliche dies. Um den Flächeninhalt aller gradlinigen Figuren zu bestimmen und zu vergleichen, löst man sie in Dreiecke auf. Das Dreieck selbst reduziert man auf einen von seiner sichtbaren Figur ganz verschiednen Ausdruck - das halbe Produkt seiner Grundlinie mit seiner Höhe. Ebenso sind die Tauschwerte der Waren zu reduzieren auf ein Gemeinsames, wovon sie ein Mehr oder Minder darstellen.
Dies Gemeinsame kann nicht eine geometrische, physikalische, chemische oder sonstige natürliche Eigenschaft der Waren sein. Ihre körperlichen Eigenschaften kommen überhaupt nur in Betracht, soweit selbe sie nutzbar machen, also zu Gebrauchswerten. Andererseits aber ist es grade die Abstraktion von ihren Gebrauchswerten, was das Austauschverhältnis [>52] der Waren augenscheinlich charakterisiert. Innerhalb desselben gilt ein Gebrauchswert grade so viel wie andre, wenn er nur in gehöriger Proportion vorhanden ist. Oder, wie der alte Barbon sagt:
"Die eine Warensorte ist so gut wie die andre, wenn ihr Tauschwert gleich groß ist. Da existiert keine Verschiedenheit oder Unterscheidbarkeit zwischen Dingen von gleich großem Tauschwert." [EN-S52-8]
Als Gebrauchswerte sind die Waren vor allem verschiedner Qualität, als Tauschwerte können sie nur verschiedner Quantität sein, enthalten also kein Atom Gebrauchswert.
Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Jedoch ist uns auch das Arbeitsprodukt bereits in der Hand verwandelt. Abstrahieren wir von seinem Gebrauchswert, so abstrahieren wir auch von den körperlichen Bestandteilen und Formen, die es zum Gebrauchswert machen. Es ist nicht länger Tisch oder Haus oder Garn oder sonst ein nützlich Ding. Alle seine sinnlichen Beschaffenheiten sind ausgelöscht. Es ist auch nicht länger das Produkt der Tischlerarbeit oder der Bauarbeit oder der Spinnarbeit oder sonst einer bestimmten produktiven Arbeit. Mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der nützliche Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden also auch die verschiednen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit.
Betrachten wir nun das Residuum der Arbeitsprodukte. Es ist nichts von ihnen übriggeblieben als dieselbe gespenstige Gegenständlichkeit, eine bloße Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit, d.h. der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung. Diese Dinge stellen nur noch dar, daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz sind sie Werte - Warenwerte. [>53]
Im Austauschverhältnis der Waren selbst erschien
uns ihr Tauschwert als etwas von ihren Gebrauchswerten durchaus unabhängiges.
Abstrahicrt man nun wirklich vom Gebrauchswert der Arbeitsprodukte, so
erhält man ihren Wcrt, wie er eben bestimmt ward. Das Gemeinsame,
was sich im Austauschverhältnis oder Tauschwert der Ware darstellt,
ist also ihr Wert. Der Fortgang der Untersuchung wird uns zurückführen
zum Tauschwert als der notwendigen Ausdrucksweise oder Erscheinungsform
des Werts, welcher zunächst jedoch unabhängig von dieser Form
zu betrachten ist.
Es könnte scheinen, daß, wenn der Wert einer Ware durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitsquantum bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto wertvoller seine Ware, weil er desto mehr Zeit zu ihrer Verfertigung braucht. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Die gesamte Arbeitskraft der Gesellschaft, die sich in den Werten der Warenwelt darstellt, gilt hier als eine und dieselbe menschliche Arbeitskraft, obgleich sie aus zahllosen individuellen Arbeitskräften besteht. Jede dieser individuellen Arbeitskräfte ist dieselbe menschliche Arbeitskraft wie die andere, soweit sie den Charakter einer gesellschaftlichen Durchschnitts- Arbeitskraft besitzt und als solche gesellschaftliche Durchschnitts- Arbeitskraft wirkt, also in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt, um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität der Arbeit darzustellen. Nach der Einführung des Dampfwebstuhls in England z.B. genügte vielleicht halb so viel Arbeit als vorher, um ein gegebenes Quantum Garn in Gewebe zu verwandeln. Der englische Handweber brauchte zu dieser Verwandlung in der Tat nach wie vor dieselbe Arbeitszeit, aber das Produkt seiner individuellen Arbeitsstunde stellte jetzt nur noch eine halbe gesellschaftliche Arbeitsstunde dar und fiel daher auf die Hälfte seines frühern Werts. [> 54]
Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit, oder die zur Herstellung eines Gebrauchswerts gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, welche seine Wertgröße bestimmt.[EN-S54-9] Die einzelne Ware gilt hier überhaupt als Durchschnittsexemplar ihrer Art. [EN-S54-10] Waren, worin gleich große Arbeitsquanta enthalten sind, oder die in derselben Arbeitszeit hergestellt werden können, haben daher dieselbe Wertgröße. Der Wert einer Ware verhält sich zum Wert jeder andren Ware, wie die zur Produktion der einen notwendigen Arbeitszeit zu der für die Produktion der andren notwendigen Arbeitszeit. "Als Werte sind alle Waren nur bestimmte Maße festgeronnener Arbeitszeit. [EN-S54-11]
Die Wertgröße einer Ware bliebe daher konstant, wäre die zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit konstant. Letztere wechselt aber mit jedem Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit. Die Produktivkraft der Arbeit ist durch mannigfache Umstände bestimmt, unter anderen durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe der Wissenschaft und ihrer technologischen Anwendbarkeit, die gesellschaftliche Kombination des Produktionsprozesses, den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der Produktionsmittel, und durch Naturverhältnisse. Dasselbe Quantum Arbeit stellt sich z.B. mit günstiger Jahreszeit in 8 Bushel Weizen dar, mit ungünstiger in nur 4. Dasselbe Quantum Arbeit liefert mehr Metalle in reichhaltigen als in armen Minen usw. Diamanten kommen selten in der Erdrinde vor, und ihre Findung kostet daher im Durchschnitt viel Arbeitszeit. Folglich stellen sie in wenig Volumen viel Arbeit dar. Jacob bezweifelt, daß Gold jemals seinen vollen Wert bezahlt [>55] hat. [20] Noch mehr gilt dies vom Diamant. Nach Eschwege hatte 1823 die achtzigjährige Gesamtausbeute der brasilischen Diamantgruben noch nicht den Preis des 1 1/2jährigen Durchschnittsprodukts der brasilischen Zucker- oder Kaffeepflanzungen erreicht, obgleich sie viel mehr Arbeit darstellte, also mehr Wert. Mit reichhaltigeren Gruben würde dasselbe Arbeitsquantum sich in mehr Diamanten darstellen und ihr Wert sinken. Gelingt es, mit wenig Arbeit Kohle in Diamant zu verwandeln, so kann sein Wert unter den von Ziegelsteinen fallen. Allgemein: Je größer die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels erheischte Arbeitszeit, desto kleiner die in ihm kristallisierte Arbeitsmasse, desto kleiner sein Wert. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit, desto größer die zur Herstellung eines Artikels notwendige Arbeitszeit, desto größer sein Wert. Die Wertgröße einer Ware wechselt also direkt wie das Quantum und umgekehrt wie die Produktivkraft der sich in ihr verwirklichenden Arbeit. [EN-S55-1*].
Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein. Es ist dies der Fall, wenn sein Nutzen für den Menschen nicht durch Arbeit vermittelt ist. So Luft, jungfräulicher Boden, natürliche Wiesen wildwachsendes Holz, usw. Ein Ding kann nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Ware zu sein. Wer durch sein Produkt sein eigenes Bedürfnis befriedigt, schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware. Um Ware zu produzieren, muß er nicht nur Gebrauchswert produzieren, sondern Gebrauchswert für andre, gesellschaftlichen Gebrauchswert. Und nicht nur für andre schlechthin. Der mittelalterliche Bauer produzierte das Zinskorn für den Feudalherrn, das Zehntkorn für den Pfaffen. Aber weder Zinskorn noch Zehntkorn wurden dadurch Ware, daß sie für andre produziert waren. Um Ware zu werden, muß das Produkt dem andern, dem es als Gebrauchswert dient, durch den Austausch übertragen werden. [EN-S55-11a]. Endlich kann kein Ding Wert sein, ohne Gebrauchsgegenstand zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bildet daher keinen Wert."
[EN-S49-1] Karl Marx, "Zur Kritik der Politischen Oekonomie", Berlin 1859, pag. 3.1*
[EN-S49-2] "Verlangen schließt Bedürfnis ein; es ist der Appetit des Geistes, und so natürlich wie Hunger für den Körper ... die meisten (Dinge) haben ihren Wert daher, daß sie die Bedürfnisse des Geistes befriedigen." (Nicholas Barbon, "A Discourse on coining the new money lighter. In answer to Mr. Locke's Considerations etc.", London 1696, p.2, 3.)
[EN-S50-3] "Dinge haben einen intrinsick vertue" (dies bei Barbon die spezifische Bezeichnung für Gebrauchswert), "der überall gleich ist, so wie der des Magnets, Eisen anzuziehen" (l.c.p.6). Die Eigenschaft des Magnets, Eisen anzuziehn, wurde erst nützlich, sobald man vermittelst derselben die magnetische Polarität entdeckt hatte.
[EN-S50-4] "Der natürliche worth jedes Dinges besteht in seiner Eignung, die notwendigen Bedürfnisse zu befriedigen oder den Annehmlichkeiten des menschlichen Lebens zu dienen." (John Locke, "Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest", 1691, in „Works", edit. Lond. 1777, v. II, p.28.) Im 17. Jahrhundert finden wir noch häufig bei englischen Schriftstellern „Worth" für Gebrauchswert und „Value" für Tauschwert, ganz im Geist einer Sprache, die es liebt, die unmittelbare Sache germanisch und die reflektierte Sache romanisch auszudrücken.
[EN-S50-5] In der bürgerlichen Gesellschaft herrscht die fictio juris, daß jeder Mensch als Warenkäufer eine enzyklopädische Warenkenntnis besitzt.
[EN-S50-6] "Der Wert besteht in dem Tauschverhältnis, das zwischen einem Ding und einem anderen, zwischen der Menge eines Erzeugnisses und der eines anderen besteht." (Le Trosne, "De l'Intéret Social", [in] "Physiocrates", éd. Daire, Paris 1846, p.889.)
[EN-S51-7] "Nichts kann einen inneren Tauschwert haben." (N. Barbon, l.c.p.6), oder wie Butler sagt:
"Der Wert eines Dings ist grade so viel wie es einbringen wird." [19]
[EN-S52-8] "One sort of wares are as good as another, if the value be equal. There is no difference or distinction in things of equal value ... One hundred pounds worth of lead or iron, is of as great a value as one hundred pounds worth of silver and gold." 1* (N. Barbon, l.c.p.53 u. 7.). 1* "... Blei oder Eisen im Werte von einhundert Pfund Sterling haben gleich großen Tauschwert wie Silber und Gold im Werte von einhundert Pfund Sterling."
[EN-S54-9] Note zur 2. Ausg. "The value of them (the necessaries of life) when they are exchanged the one for another, is regulated by the quantity of labour necessarily required, and commonly taken in producing them." "Der Wert von Gebrauchsgegenständen, sobald sie gegeneinander ausgetauscht werden, ist bestimmt durch das Quantum der zu ihrer Produktion notwendig erheischten und gewöhnlich angewandten Arbeit." ("Some Thoughts on the Interest of Money in general, and particularly in the Public Funds etc.", London, p.36, 37.) Diese merkwürdige anonyme Schrift des vorigen Jahrhunderts trägt kein Datum. Es geht jedoch aus ihrem Inhalt hervor, daß sie unter Georg II., etwa 1739 oder 1740, erschienen ist.
[EN-S54-10] "Alle Erzeugnisse der gleichen Art bilden eigentlich nur eine Masse, deren Preis allgemein und ohne Rücksicht auf die besonderen Umstände bestimmt wird." (Le Trosne, l.c.p.893.)
EN-S54-11] K. Marx, 1.c.p.6. 1* 1* Siehe Band 13 unserer Ausgabe, S. 18
[EN-S55-11a] Note zur 4. Aufl. - Ich schiebe das Eingeklammerte ein, weil durch dessen Weglassung sehr häufig das Mißverständnis entstanden, jedes Produkt, das von einem andern als dem Produzenten konsumiert wird, gelte bei Marx als Ware. - F.E.
[EN-S55-1*] 1.Auflage folgt: Wir kennen jetzt die Substanz des Werts Es ist die Arbeit. Wir kennen sein Größenmaß. Es ist die Arbeitszeit. Seine Form, die den Wert eben zum Tausch-Wert stempelt, bleibt zu analysieren. Vorher jedoch sind die bereits gefundenen Bestimmungen etwas näher zu entwickeln.