(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=30.08.2006 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: 05.04.15
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen * Mail:_sekretariat@sgipt.org__ Zitierung & Copyright
Anfang Placebo__Überblick _ Rel. Aktuelles _ Rel. Beständiges _Titelblatt _Konzept _Archiv _Region __ Service-iec-verlag _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet-Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Bücher und Literatur, Bereich Präsentationen, und hier speziell zum Thema:
Buch-Präsentationen in der IP-GIPT
Placebo
Heilung, Hoffnung und Arzt-Patient-Beziehung
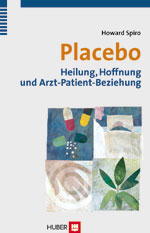
Bibliographie * Verlagsinfo * Inhaltsverzeichnis * Leseprobe * Hauptergebnisse * Bewertung * Links * Literatur * Querverweise *
Bibliographie: Spiro, Howard (2005). Placebo. Heilung, Hoffnung und Arzt-Patient-Beziehung. Aus dem Englischen von Irmela Erckenbrecht. Bern: Huber. 320 S., Gb mit Schutzumschl. ISBN: 3-456-84234-1. EURO 28.95 / CHF 49.90. erschienen 13-10-2005. [Verlags-Info]
Verlagsinfo:
"Der weltweit bekannte Gastroenterologe Howard Spiro setzt sich in diesem
Buch mit dem Placeboeffekt in all seinen Facetten auseinander und diskutiert
mögliche Erklärungen seiner Wirksamkeit. Dabei verschweigt er
auch die ethischen Probleme des Placeboeinsatzes nicht. Als Kern der Placebowirkung
identifiziert er ein von Arzt und Patient gemeinsam besiegeltes Loyalitätsversprechen.
Damit kann er zwischen einem ethisch gerechtfertigten und einem unverantwortlichen
Einsatz von Placebos unterscheiden.
Die Bedeutung der Beziehung zwischen Arzt und
Patient erklärt auch die Erfolge komplementärmedizinischer Methoden,
die hier ausführlich diskutiert werden – von der Meditation bis zur
Massage, von der Glaubensheilung bis zur traditionellen Volksmedizin, von
der Kräuterheilkunde bis zur Homöopathie. Spiro zieht eine klare
Grenze zwischen dem Kranksein als subjektivem Erleben (illness), das durch
Placebos beeinflusst werden kann, und strukturellen Veränderungen,
die dem Placeboeffekt widerstehen. Damit gibt er der Persönlichkeit
des Arztes ihre entscheidende Bedeutung für den Prozess des Heilens
zurück.
«Dieses Buch liefert
wesentliche Erkenntnisse über das Versprechen, das die Alternativmedizin
kranken Menschen anbieten kann. Es ist ein wichtiger und aktueller Beitrag
von einem der bedeutendsten Gastroenterologen und Kliniker unserer Zeit.»
Joseph Jacobs, National Institutes of Health"
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7
1 Einführung 11
2 Placebos in Forschung und Therapie 25
3 Der Arzt 41
4 Pillen und Verfahren 57
5 Der Patient und seine Krankheit 67
6 Was Placebos leisten können 95
7 Placebos bei Schmerzen 117
8 Autonomie und Verantwortung 133
9 Einwände gegen Placebos 145
10 Placebos und Alternativmedizin 167
11 Alternative Formen der Heilung 191
12 Warum Ärzte Placebos nicht mögen 221
13 Mögliche Wirkungsweisen von Placebos 239
14 Loyalität in der Beziehung zwischen Arzt und Patient 261
15 Das Placebo-Versprechen 273
Zitierte Werke 295
Andere Literatur 311
Register 315
Leseprobe:
"Die Wandlung der modernen Medizin
Es gab eine Zeit, in der es so aussah, als gelänge
es der Synthese aus sozialen, psychischen und körperlichen Einflüssen,
die man mit dem Begriff «psychosomatische Medizin» zusammenfasste,
Ärzten eine allgemein anerkannte, zugleich ganzheitlich als auch naturwissenschaftlich
geprägte Sicht des kranken Menschen zu lehren. Die psychosomatische
Medizin entsprang einer breiteren, vormals erfolgreichen Bewegung, der
Sozialmedizin. In den 1920er Jahren gründeten und förderten Milton
Winternitz, Dekan der Yale University School of Medicine, und James Rowland
Angell, Präsident der Yale University, das Institute of Human Relations.
Erklärtes Ziel war es, Sozialwissenschaften und Psychologie in die
medizinische Lehre zu integrieren und werdende Ärzte zum Blick über
die körperlichen Symptome ihrer Patienten hinaus zu ermutigen. Das
Gebäude, das sie schufen, überdauerte sie, beherbergt heute aber
ein genetisches Labor. Alles, was von den Träumen jener Jahre übrig
blieb, ist der alte, über dem Haupteingang eingravierte Name des Instituts.
Das Scheitern dieser sozialmedizinischen
Vision unterstreicht die Mängel des modernen Medizinmodells sowie
den Wert des postmodernen Ideals von der ärztlichen Tätigkeit.
Früher einmal sahen sich Ärzte als Praktiker am Krankenbett,
später als Kliniker in einem Krankenhaus; jetzt lernen sie,
wie Wissenschaftler oder wenigstens [<16] wie Techniker in einem
Labor zu handeln. Praktiker sehen den Patienten als Ganzes, dessen Teile
in Harmonie miteinander zu bringen sind, Kliniker konzentrieren sich auf
Krankheiten und biologische Störungen, sehen kranke Menschen auf ihren
Intensivstationen als Fälle an. In der ärztlichen Praxis kann
diese Sichtweise zu Missverständnissen führen, vor allem, wenn
der Arzt viel zu sehr mit technischen Dingen beschäftigt ist, um der
zuhörende Heiler zu sein, den wir uns alle wünschen.
Die wissenschaftliche Labormedizin,
wie sie die medizinische Ausbildung in den letzten fünfzig Jahren
beherrschte, macht den Arzt zum Wissenschaftler, der sich eher mit den
Windungen und Faltungen von Aminosäuren befasst, als den ganzen Patienten
im Blick zu haben. Krankheiten haben ihren Ursprung in den Zellen - ein
Ansatz, den Rudolf Virchow, der große Pathologe des 19. Jahrhunderts,
als Zellpathologie bezeichnete. Die Gentechnik zeigt, wie nah die medizinische
Wissenschaft der von ihm vorausgesehenen Zelltherapie gekommen ist. Betrachten
wir z. B. die Behandlung eines Magengeschwürs, die heute wesentlich
einfacher ist als früher, weil inzwischen freiverkäufliche Substanzen
zur Verfügung stehen, die die Produktion von Magensäure blockieren
können. Noch spezifischere Mittel hemmen die «Protonenpumpe»
in der Zelle, und Antibiotika versprechen, die Rückkehr des Geschwürs
zu verhindern. Den täglichen Stress zu reduzieren und die Ernährung
so zu verändern, dass Geschwüre ausheilen und in Zukunft nicht
wiederkehren, ist viel schwieriger, als Pillen und Tropfen zu schlucken.
Kein Wunder, dass die Medizin sich auf biologisch nachweisbare, organische
Läsionen und die mit ihnen verbundenen biochemischen und immunologischen
Abweichungen konzentriert. Schließlich sind sie leichter zu beheben
als die sozialen, kulturellen und ökonomischen Faktoren, die zu so
vielen gesundheitlichen Problemen führen. Dieser «Reduktionismus»
ist in der medizinischen Praxis noch immer allgegenwärtig.
Moderne Ärzte wollen
die Störung hinter der Krankheit finden und suchen danach vor allem
in den Körperzellen. Wissenschaftler in Gestalt von Ärzten sehen
viel, hören aber selten zu. Die Patienten dagegen haben sich nicht
verändert; sie wollen in erster Linie wieder gesunden, und die meisten
würden gern ausführlicher mit ihren Ärzten reden. In der
Rolle des Patienten halten sich die meisten von uns für einzigartig,
zumindest aber für mehr als bloß eine Ansammlung von Symptomen
oder einen weiteren medizinischen Fall.
Natürlich besteht das
Leben aus sehr viel mehr als nur der Medizin. Es könnte von Arroganz
zeugen, wenn Ärzte meinen, jemand, der zu ihnen kommt, um sich wegen
eines bestimmten Symptoms behandeln [<18] zu lassen, könnte mehr
wollen als eine auf dieses Symptom zugeschnittene Behandlung. Von meinem
Friseur möchte ich, dass er mir die Haare schneidet, aber nicht auch
noch gleich den Bart rasiert, bloß weil er meint, ich würde
damit jünger aussehen. Ärzte müssen vorsichtig sein, wenn
es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, die zu übernehmen
sie niemand gebeten hat.
Moderne und postmoderne Medizin
Die moderne Medizin begann mit dem Erfolg
von. Pasteurs Impfstoff gegen Tollwut und der Entwicklung eines Antitoxins
gegen Diphtherie; die weiteren Erfolge im Krieg gegen diverse Bakterien
sind der Grund, warum die medizinische Sprache häufig von militärischen
Metaphern gekennzeichnet ist. Nachdem man mit Salvarsan ein wirksames Mittel
gegen Syphilis gefunden hatte, hofften die Ärzte auf weitere Wunderwaffen,
mit denen sich Krebs, Herzerkrankungen und sogar gewöhnliche Erkältungskrankheiten
besiegen ließen. Der derzeit wütende Krieg gegen H. pylori als
Ursache von Magengeschwüren kann als neueres Beispiel gelten: Wenn
man solche Geschwüre mit Antibiotika heilen kann, braucht man über
die Stressfaktoren, die das Geschwür wachsen ließen, nicht zu
reden.
Die moderne Medizin oder Biomedizin
war bei der Behandlung vieler akuter Störungen so erfolgreich, dass
es Ärzten schwer fällt, sich und anderen einzugestehen, dass
sie Patienten mit chronischen Problemen, die eines ganzheitlicheren Ansatzes
bedürfen, weniger gut helfen können. Rheuma, Allergien, Rückenbeschwerden,
Bauchschmerzen und Bluthochdruck sind irgendwo zwischen Krankheit und Kranksein
angesiedelt. Es sind Probleme, bei denen man mit alternativen medizinischen
Methoden gute Erfolge erzielen kann.
Der in Kapitel 11 noch näher
erläuterte Flexner-Report aus dem frühen 20. Jahrhundert bescherte
der Biomedizin eine Vorrangstellung, kanalisierte die medizinische Praxis
in entsprechend geprägte Hauptrichtungen und grenzte alternative Beiträge
(darunter viele weibliche Einflüsse in der Medizin) aus. Die zunehmende
Spezialisierung in den letzten vierzig Jahren hat es Ärzten zusätzlich
erschwert, Patienten mit Beschwerden zu behandeln, die sich mit Röntgenapparaten,
Computertomographiegeräten und anderen Maschinen nicht bildlich darstellen
lassen. Der alternativen Medizin ist dadurch eine noch bedeutendere Rolle
zugekommen: Sie spricht Probleme an, für die die wissenschaftliche
Medizin keine Lösungen findet
Die Postmoderne steht für
die Auflehnung gegen das beherrschende [<18] Thema und Bewusstsein des
20. Jahrhunderts: dass die westliche Zivilisation der ganzen Welt die Richtung
weisen soll. In den 1960er Jahren erlebten wir das Erstarken der Frauenbewegung,
den Kampf der Schwarzen um Gleichberechtigung und den schwindenden Glauben
an viele Institutionen. Die Ursprünge des Postmodernismus liegen im
literarischen Dekonstruktivismus, der dazu aufrief, weniger darüber
nachzudenken, was gesagt wird, sondern mehr darauf zu achten, was nicht
gesagt wird, also zwischen den Zeilen eines Textes ebenso zu lesen wie
in den Zeilen selbst. Zu den Folgen dieser Revolte gehörten Multikulturalismus
und Vielfalt - eine wichtige Quelle der alternativen Medizin. Die postmoderne
Medizin muss in diesem breiteren sozialen Kontext gesehen werden. Sie wirkt
neu, ist aber in Wirklichkeit eine Rückkehr zu alten Ideen, die in
den USA z. T. bis in die egalitäre Ära von Andrew Jackson zurückgehen.
Das von der Vernunft zur Intuition geschwungene Pendel wird mit Sicherheit
irgendwann wieder zurückschlagen. Noch nicht allgemein als Teil der
postmodernen Bewegung erkannt, ist die alternative Medizin allmählich
gewachsen, ohne ein einheitliches Regelwerk zu entwickeln - dies allein
deshalb, weil Gesundheit und nicht Krankheit ihr Thema ist. Gesundheit
aber ist so schwer zu definieren, dass es knifflig werden kann, wenn Ärzte
auf Gesundheit, nicht auf Krankheit abzielen.
Gesundheit und Krankheit
In postmodernen Berichten über Heilungsprozesse
haben sich Krankheit (disease) und Kranksein (illness) aneinander
angeglichen. «Es geht mir besser», ist gleichbedeutend mit:
«Ich bin kuriert.» In Wirklichkeit sind beide aber äußerst
unterschiedlich - eine Tatsache, die an vielen Konflikten zwischen modernen
und postmodernen Ärzten ursächlich beteiligt ist. Für moderne,
naturwissenschaftlich ausgerichtete Medizinerinnen und Mediziner sind Behandlung
(cure) und therapeutische Betreuung (care) zweierlei, und
Heilung
ist ein Begriff, der größtenteils außerhalb schulmedizinischer
Kreise gebraucht wird. Dem Begriff heilen haftet etwas Mystisches
an, wenn damit gemeint ist, «Körper, Geist und Seele zu helfen».
Ich möchte diesen Gebrauch nicht herabwürdigen, aber «heilen»
ist nicht das Gleiche wie das, was die moderne Medizin unter «behandeln»
(cure) versteht.
Der Konflikt zwischen alternativer
Medizin und Schulmedizin geht auf den unterschiedlichen Umgang mit Krankheit
und Kranksein zurück. Die moderne Medizin bewährt sich bei akuten
Problemen wie [<20] Lungenentzündungen und Knochenbrüchen,
ist aber oft hilflos, wenn es um von Schmerz und Niedergeschlagenheit begleitete
Beschwerden wie Arthritis oder stressbedingte Verdauungsstörungen
geht. Die auf Krankheiten fixierte moderne Medizin und die auf Gesundheit
zielende alternative Medizin sind an gegensätzlichen Polen angesiedelt;
das Medizinstudium trainiert zukünftige Ärzte darauf, bei Patienten
Krankheiten zu entdecken, obgleich diese eigentlich nach Gesundheit streben.
Während ich die Feuerwand
zwischen der Schulmedizin, in der ich ausgebildet wurde, und den ergänzenden
alternativen Praktiken, die zwischenzeitlich sogar verboten waren, immer
weiter durchbreche, wächst meine Gewissheit, dass nicht der spezifische
Behandlungprozess oder eine bestimmte Technik dem Patienten hilft, sondern
die Zeit, die sein Arzt mit ihm verbringt. Technik oder Zeit - auch für
die Psychotherapie ist diese Frage wichtig. Placebos waren unter diesem
Gesichtspunkt nämlich nicht eine weitere Spielart der alternativen
Medizin, sondern ein Surrogat für viele andere Ansätze, die letztlich
ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ich glaube, dass diese Ansätze nichts
Spezifisches haben und viele begeisterte Anhänger einer bei der Heilung
erfolgreichen Technik diese zu Unrecht für spezifisch halten. Psychiater,
die sich von der Psychoanalyse abgewendet haben, fragen sich, ob ihre mühsam
erlernten Techniken und Fertigkeiten tatsächlich so wichtig sind,
wie sie einmal glaubten, oder ob es nicht vielmehr die mit dem Patienten
verbrachte Stunde - oder halbe Stunde! - war, die den Erfolg brachte. Ähnlich
ernste Fragen stellen sich angesichts der hinter einigen alternativen Methoden
stehenden Therapieansätze. Dennoch, manchmal träume ich davon,
dass die psychosomatische Medizin meiner Jugend zur verhaltenstherapeutisch
geprägten Medizin des neuen Millenniums werden könnte. Ärzte
müssten schon sehr verbohrt sein, um zu verkennen, dass eine Massage
ebenso hilfreich sein kann wie eine intensive Auseinandersetzung mit der
eigenen Vergangenheit.
Die Beschäftigung mit
Placebos hat mich mit volksmedizinischen Praktiken, dem Gesundbeten und
anderen Heilkünsten in Berührung gebracht, die manchen medizinischen
Zirkeln bis heute als anrüchig gelten. Ja, Andrew Weil hat Placebos
irgendwo sogar einmal als heimliche Schande der Medizin bezeichnet. Placebos
erinnern Ärzte ebenso wie manche Methoden der alternativen Medizin
an die unsicheren Grenzen der medizinischen Arbeit; ethnomedizinische Berichte
über das Heilen in anderen Kulturen bezeugen, wie unterschiedlich
verschiedene Völker Krankheit erklären und Kranksein definieren
-Erklärungen und Definitionen, die westliche Vorstellungen, vom ärztlichen
Handeln durchaus bereichern können. [<20]
Wissenschaft, die Grundlage der Medizin
Die Wissenschaft bleibt die Grundlage der modernen Medizin. Wenn ich Placebos und ihre Wirkungen beschreibe, werde ich auf festem wissenschaftlichem Boden stehen, gleichzeitig aber auch die Ansprüche alternativer Ansätze mit einbeziehen. Die medizinische Praxis wird durch die Spannungen zwischen Wissenschaft und Intuition oftmals verzerrt; die Beschäftigung mit Placebos war in diesem Zusammenhang für mich wie eine Linse, die mir half, einige Ursachen dieser Verzerrungen schärfer zu sehen.
Voraussagbarkeit und Reproduzierbarkeit
Lassen Sie mich betonen, wie wichtig bei der Beurteilung
von Placebos und alternativer Heilansätze ein rationaler, skeptischer
Ansatz ist. Einzelne Beobachtungen lassen sich leicht aus dem Kontext reißen
und als Sprungbretter für ungerechtfertigte Schlussfolgerungen nutzen.
In einem Beitrag über die Akupunktur schrieb z. B. der inzwischen
verstorbene, damals in Irland lebende Ungar Peter Skrabanek treffend: «Worum
es geht, ist das komplexe Problem der Abgrenzung zwischen Wissenschaft
und Quacksalberei, zwischen ehrlicher Suche nach Wahrheit und skrupelloser
Ausbeutung menschlichen Leids.»
Alles kann so gedreht werden,
dass es logisch klingt, Wer sich von Wundern oder magischen Vorgängen
beeindrucken lässt, wirft die oft mühsamen und schwerfälligen
wissenschaftlichen Prinzipien leicht über Bord. Wissenschaftliche
Prinzipien müssen aber auch auf das Unbekannte anwendbar sein, also
auch auf Placebos und zunächst nur plausibel erscheinende Phänomene.
Beobachtung und Erklärung
Berichten über einzelne Behandlungserfolge
begegnet die Medizin mit Geringschätzung. Was jedoch einmal geschehen
ist, kann auch wieder geschehen. Wissen entsteht, indem man Probleme klassifiziert
und Hypothesen überprüft. Anstatt die unerklärten Erfolge
von Placebos verächtlich abzutun, müssen Ärzte der Frage,
wann und wie Placebos kranken Menschen helfen können, systematisch
auf den Grund gehen.
Bis vor kurzem wussten die
meisten Ärzte nicht, wie genau Aspirin [<21] gegen Schmerzen wirkt,
trotzdem verschrieben sie es und nahmen es auch selbst ein. In den 1960er
Jahren erfuhren sie, dass Aspirin die Schwelle für die Schmerzwahrnehmung
erhöht, in den 1970er Jahren, dass es die Prostaglandin-Synthetase
hemmt, und in den 1980er Jahren, dass die Substanz aus Zellmembranen stammt.
Ihre Kenntnisse über die Wirkungsweise von Aspirin wurden also immer
spezifischer, ihre Verschreibungspraxis jedoch blieb unverändert.
Und selbst postmoderne Ärzte empfehlen Aspirin für sehr viel
mehr als bloß zur Schmerzlinderung. Ärzte versuchen, ihr Handeln
auf die wissenschaftliche Medizin zu stützen. Falls sich herausstellt,
dass Placebos Schmerzen lindern können, weil sie z. B. endogene Endorphine
stimulieren, bleibt dennoch die Frage, warum das Wissen darüber, warum
sie wirken, ihren Einsatz eher rechtfertigen soll als das Wissen, dass
sie wirken.
Wer etwas beobachtet, hat
dafür nicht unbedingt gleich eine Erklärung. Wer Einzelberichte
über erfolgreiche Placebo-Wirkungen klassifiziert, hat damit noch
nicht ihre Wirkweise erklärt. Warum sollen wir sie aber nicht beschreiben
dürfen, auch wenn wir noch nicht wissen, wie sie wirken? Hätten
Ärzte sich nicht auf ihre klinische Erfahrung verlassen, sondern auf
eine Erklärung geharrt, wie genau Penicillin gegen Lungenentzündungen
wirkt, hätten sie viele Jahre warten müssen. Auf Röntgenaufnahmen
konnten sie nachvollziehen, dass Penicillin manche Lungenentzündungen
praktisch über Nacht zum Verschwinden bringt, während es gegen
andere (virale} Entzündungen machtlos ist. Auch Placebos wirken nicht
bei allen Patienten, also hätten sie schließen können,
dass Penicillin ein Placebo sei. Sie hätten sich weigern können,
es weiterhin zu verschreiben, hätten ihre Patienten leiden oder sterben
lassen können. So wichtig wie damals das Finden von Unterscheidungsmerkmalen
für verschiedene Arten von Lungenentzündungen, so wichtig ist
heute eine genauere Analyse, wann Placebos wirken und wann nicht. Eine
biologische Erklärung wäre wünschenswert, doch zu wissen,
dass gesundheitliche Besserung auf Glaube beruht, würde dadurch die
Frage, ob man Patienten bei der Verschreibung von Placebos hinters Licht
führt, nicht überflüssig und das Lügen nicht ehrenhafter
machen.
Alles, was die Aufmerksamkeit
der Betroffenen von ihrem Schmerz ablenkt, kann hilfreich sein. Noch ehe
meine Tochter Carolyn Psychiaterin wurde, meinte sie, dass ich beim Zahnarzt
auch ohne Novocain auskommen würde, wenn ich meine Aufmerksamkeit
von meinem Mund auf andere Dinge lenken würde. Die Technik funktionierte,
und außerdem wusste ich, dass der Schmerz nicht lange andauern würde.
Diese Umlenkung der Aufmerksamkeit, manchmal [<22] mit Hilfe der Fantasie,
wird von vielen der Therapien, auf die ich in diesem Buch eingehen werde,
unterstützt.
Neugier
Verbotene Fragen sollte es nicht geben. Wenn etwas durch das vorherrschende wissenschaftliche Paradigma nicht erklärt werden kann, ist dies kein Grund dafür, es entweder zu ignorieren oder einfach zu glauben. Herz- und Gentransplantationen und die neuen Erkenntnisse der Neurobiologie verführen uns dazu, unsere Energien auf das naturwissenschaftliche Terrain zu beschränken. Doch auch in den Grenzregionen zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten, dem Messbaren und dem Unmessbaren, dem Rationalen und dem Intuitiven gibt es viel zu sehen und zu lernen. Placebos erinnern uns daran, dass vieles von dem, was Ärzte tun, nicht auf Vernunft gestützt ist und dies auch gar nicht zu sein braucht. Placebos lenken den Blick auf die jeweiligen Rollen von Ärzten und Patienten im Heilungsprozess.
Wer dieses Buch lesen sollte
Das Nachdenken über Placebos und ihre Wirkungsweisen
hat mir klar gemacht, worum es in der schulmedizinischen Ausbildung und
Praxis geht. Zukünftige Ärzte büffeln Naturwissenschaften,
um in ihrem Medizinstudium voranzukommen. Wenn sie endlich in einer Uniklinik
am Krankenbett stehen, lernen sie, Patienten mit schweren Erkrankungen
fachgemäß zu behandeln. Viele von ihnen spezialisieren sich
dann auf ein Fachgebiet, in dem möglichst viel Hightech eingesetzt
wird, weil ihnen dies das Gefühl gibt, ihre Patienten besonders effektiv
behandeln zu können. Nachdem sie ein Jahrzehnt oder mehr in Kliniken
mit der Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu tun hatten, treten sie
hinaus in eine Welt, in der sich die Menschen krank fühlen und sich
um ihre Gesundheit Sorgen machen - und in der es für die Hälfte
der Klagen, die sie zu hören bekommen, keine medizinischen Ursachen
gibt. Sie stellen fest, dass sie für den Umgang mit Kranksein und
Schmerz schlecht vorbereitet sind - es sei denn, es gelingt ihnen, die
Beschwerden mit Hilfe der erlernten Technologien in Krankheiten zu verwandeln.
Wegen der Bedeutung von Placebos als nicht-technologischem Bindeglied zwischen
Arzt und Patient emp-[<23]fehle ich jungen Menschen, die mit dem Medizinstudium
beginnen, neben organischer Chemie und Physik auch Kunstgeschichte und
Ethnologie zu studieren.
Dieses Buch zielt also darauf
ab, Laien einen Einblick in die Unwägbarkeiten der Medizin zu geben,
und zwar der Schulmedizin ebenso wie der so genannten alternativen Medizin.
Medizinische Interessengruppen haben uns viele Fortschritte beschert, die
Öffentlichkeit aber auch dazu erzogen, für die meisten Krankheiten
rasche Behandlungserfolge zu erwarten und zu glauben, selbst die Krankheit
des Todes ließe sich überwinden, wenn man nur genug Geld und
Ressourcen zur Verfügung stelle. Aus diesem Grund verlangen Patienten
für zu viele kleine Beschwerden zu viele Untersuchungen. Vielleicht
kann die Lektüre dieses Buches der Laienöffentlichkeit helfen,
medizinische Ungewissheit auch im eigenen Fall besser zu ertragen. [<24]
2. Placebos in Forschung und Therapie
Das Placebo-Drama hat vier
Akte: ein Arzt gibt einer
kranken Person eine inaktive Substanz,
daraufhin stellt sich der Placebo-Effekt ein: die Symptome bessern
sich. Die hinter den Kulissen stattfindende, für die Besserung verantwortliche
Placebo-Reaktion
wird vom Publikum nur wenig beachtet und selten mit Applaus bedacht. Ich
glaube, dass die Placebo-Reaktion im Wesentlichen durch eine Veränderung
in der Wahrnehmung des Patienten verursacht wird. Arzt, Placebo und Patient
bringen zusammen die Linderung der Symptome zustande, die wir den Placebo-Effekt
nennen. Als Placebos üblich sind meist oral einzunehmende Medikamente
(Tabletten oder Lösungen), aber auch Operationen und Spritzen; ja
selbst diagnostische und therapeutische Verfahren können Placebos
sein. Viele Patienten fühlen sich besser, nachdem sie ein Placebo
bekommen haben, was nicht heißt, dass ihre Krankheit (falls vorhanden)
sich gebessert hat, denn eine Linderung der Symptome muss mit der Heilung
einer Krankheit nicht identisch sein."
...
"Placebos als Therapie
Weil sie pharmakologisch gesehen nicht wirksam
sind, hat man Placebos als «chemische Hilfsmittel der Psychotherapie
... ohne eigene pharmakologische Eigenschaften» bezeichnet. Shapiros
Definition ist spezifischer. Für ihn sind Placebos «alle Therapieformen
(oder Komponenten einer Therapie), die entweder absichtlich wegen
ihrer nicht-spezifischen psychologischen oder psychophysiologischen Wirkung
oder
unabsichtlich wegen einer angenommenen spezifischen Wirkung auf einen
Patienten, ein Symptom oder eine Krankheit eingesetzt werden, in Wirklichkeit
aber ohne spezifische Wirkung sind» (Shapiro, 1964).
Andere sprechen übereinstimmend
von der starken psychologischen Wirkung «jeglichen therapeutischen
Verfahrens ..., auch wenn es objektiv für die behandelte Krankheit
kein echtes Wirkungspotenzial besitzt.» Howard Brody spricht darüber
hinaus vom «symbolischen Effekt» von Placebos.
Tatsächlich sind therapeutisch
eingesetzte Placebos in der Lage, Schmerzen und andere (in Kapitel 1 beschriebene)
Symptome zu lindern. Die für ihre Wirkung verantwortlichen Mechanismen
mögen bis heute ungeklärt sein, vom ärztlichen Standpunkt
aus gesehen ist jedoch die medizinische Absicht wichtig, auch wenn das
echte Medi[<35]kament des einen Arztes für den anderen ein typisches
Placebo sein kann. Da er zur Wirkung von Placebos eine feste Meinung hat,
ist die Absicht des Arztes für etwaige Definitionen ebenso wichtig
wie für den Patienten, der am Zustandekommen des Placebo-Effekts einen
großen Anteil hat."
Hauptergebnisse
Wie Placebos genau wirken teilt uns Spiro nicht mit, aber er nennt eine Reihe von Faktoren (Stichworte kursiv fett), die für den Placeboeffekt günstig sind:
- Die Macht der Imagination (S. 240)
- Der Glaube an die Wirkung (S. 240) > Frank 2.2.
- Die Macht der Hoffnung (S. 240; S. 250) > Frank 2.1.
- Erwartungshaltung (S. 250). > Frank 2.3.
- Die Wirkung der Konditionierung (S. 242), die zwar die Entwicklung einer Störung erklärt, aber nicht den Placeboeffekt. Später führt Spiro aus, dass mit dem Arzt und der Medikamentengabe bestimmte - positive wie negative - Assoziationen verbunden sein können.
- Suggestionen und empfänglich machen dafür (S. 248, S. 274).
- Compliance (S. 251).
- Katharsis (S. 281)
- Die richtigen Worte (S. 283) > Frank 4.3.
- Deutung, eine Erklärungstheorie im Verständnishorizont der PatientIn (S. 289); > Frank 3.4.
- Empathisches Zuhören > Frank 4.2.
- Ein heilender Kontext > Frank.
- Ablenkung durch Konzentration auf anderes (S. 291).
Wie
sollte und könnt man den Placeboeffekt in der Heilkundepraxis nutzen
?
Wie man das genau machen kann, ist mir nicht
klar geworden; wohl, dass man den Placeboeffekt nutzen und auch bewußt
anwenden sollte. Der Autor äußert gegen Ende seines Buches im
Kap. 15 "Das Placebo-Versprechen" (S. 289):
"Ich hoffe, dass Placebos eines Tages auch als
Symbole ärztlicher Hilfsbereitschaft überflüssig werden.
Sobald Ärzte - und auch Pflegende - erkennen, dass sie kraft ihrer
Persönlichkeit, durch Suggestion und Überzeugung, Worte und kleine
Taten viele ihrer Patienten trösten und positiv beeinflussen können,
werden inaktive Medikamente nicht mehr notwendig sein. Denn in dieser fernen
Zukunft werden kranke Menschen sich auch eigenständig über alternative
Behandlungsmöglichkeiten informieren, und eine breite Aufklärung
wird uns allen zu der Erkenntnis verhelfen, dass es in uns Kräfte
gibt, die Schmerzen, Depression und Angst lindern und Kranksein heilen
können. Man wird keine Pille mehr nehmen müssen, um Reaktionen
auszulösen, die sich aus vielen anderen Quellen speisen können,
von der Meditation bis zur Massage, vom Gebet bis zum Kräutertee.
Richtig eingesetzt, erinnern Placebos Ärzte und Pflegende daran, dass
sie es mit ganzen Menschen zu tun haben. Gleichzeitig geben sie den Patienten
das beruhigende Gefühl, dass ihr Arzt mehr sein kann als ein modernste
Techniken beherrschender Automat. Sehen beide Seiten erst einmal die vielen
Alternativen zu Technologie und Pillen, können sie sich stärker
auf das heilende Bündnis verlassen, das sie im Moment der Konsultation
miteinander eingehen.
Wir können beides haben, Wissenschaft und
Intuition, Vernunft und Romantik. Ein Entweder-oder braucht es nicht zu
geben. Die Medizin hat für beides Platz, und vermeintliche Dichotomien
erweisen sich letztlich als Teile eines Ganzen. Für Ärzte sollte
es keine Trennung zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, zwischen
Schulmedizin und Alternativmedizin geben. Jeder Patient ist anders; der
eine erfordert mehr Kunst, der andere mehr Wissenschaft. Wissenschaft und
Intuition schließen einander nicht aus. Empathie und Kommunikation
sind ebenso wichtig wie Medikamente und komplizierte diagnostische Verfahren.
Wenn Placebos helfen, brauchen sich [<289] Ärzte wegen der magischen
Aspekte ihrer Arbeit nicht schuldig zu fühlen; das Gleiche gilt, wenn
ihre Patienten nach Alternativen suchen, die Geist und Seele mit Energie
beflügeln. ..."
Aus psychologischer Sicht ist am Placeboeffekt nichts Magisches
Offene Fragen
Die Wirkungsweise ist mikroanalytisch gesehen
noch unerforscht und bleibt eine Herausforderung und Forschungsaufgabe.
"Warum ein Mensch auf Placebos reagiert und ein
anderer nicht, bleibt ein Geheimnis, da doch beide den gleichen biologischen
Apparat besitzen." (S. 242) Die PsychologIn und die PsychotherapeutIn sehen
hier kein Problem, weil zwei verschiedene Menschen in vielerlei Hinsicht
unterschiedlich entwickelt, geprägt und verfaßt sind. Hinzu
kommen die unterschiedlichen Situationen und die spezielle Beziehung, die
sich zwischen TherapeutIn und PatientIn entwickelt.
Bewertung:
Dieses Buch über Placebos ist insofern besonders interessant, weil es von einem ganz unverdächtigen, in Harvard ausgebildeten, Internisten und Gastroenterologen stammt. Wertvoll ist es schon deshalb, weil es - wieder einmal - auf das Phänomen der Bedeutung von Vertrauen, Erwartung, Glaube und Hoffnung in der Therapie nachdrücklich hinweist. Das sind mächtige Heilfaktoren. Man wird Medizin, Heilung und Therapie nie richtig verstehen, solange man den Placebofaktor nicht richtig verstanden hat. Uneingeschränkte Unterstützung verdient die Grundhaltung, dass Wissenschaft, Schulmedizin, Alternativmethoden, Placebo, Seele, Geist und Glauben sich nicht ausschließen müssen. Mikroanalytisch erfahren wir nichts Neues. Aber Spiros Buch ist vielleicht ein wichtiger Beitrag dafür, dass sich die Wissenschaft endlich an mikroanalytische Modellierungen begibt. Auch hier, scheint es, wird man erst richtig weiter kommen, wenn es zunehmend besser gelingt, Homunculi ("Bauplan für eine Seele") zu konstruieren.
Links (Auswahl: beachte) > siehe auch hier.
Placebo [Google] [W]
Spontanheilung [Google]
Selbstheilung [Google]
Akupunkturstudie: Morgenwelt: Glaubst Du an mich? Ich heile Dich! https://www.morgenwelt.de/416.html
Literatur (Auswahl)
Siehe umfangreiche Literaturliste zu Placebos
hier.
Anmerkungen und Endnoten
___
Bewertung. Bewertungen sind immer subjektiv, daher sind wir in unseren Buchpräsentationen bemüht, möglichst viel durch die AutorInnen selbst sagen zu lassen. Die Kombination Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassungen sollte jede kundige oder auch interessierte LeserIn in die Lage versetzen selbst festzustellen, ob sie dieses oder jenes genauer wissen will. Die BuchpräsentatorIn steht gewöhnlich in keiner Geschäftsbeziehung zu Verlag oder den AutorInnen; falls doch wird dies ausdrücklich vermerkt. Die IP-GIPT ist nicht kommerziell ausgerichtet, verlangt und erhält für Buchpräsentationen auch kein Honorar. Meist dürften aber die BuchpräsentatorInnen ein kostenfreies sog. Rezensionsexemplar erhalten. Die IP-GIPT gewinnt durch gute Buchpräsentationen an inhaltlicher Bedeutung und Aufmerksamkeit und für die PräsentatorInnen sind solche Präsentationen auch eine Art Fortbildung - so gesehen haben natürlich alle etwas davon, am meisten, wie wir hoffen Interessenten- und LeserInnen. Beispiele für Bewertungen: [1,2,3,]
___
Anm. Vorgesehene. Wir präsentieren auch Bücher aus eigenem Bestand, weil wir sie selbst erworben haben oder Verlage sie aus verschiedenen Gründen nicht (mehr) zur Verfügung stellen wollen oder können.
___
Standort Placebo. Heilung, Hoffnung und Arzt-Patient-Beziehung.
*
Placebo. Glaubensheilung und die Wirkungsweise des Placeboeffektes.
Die vier allgemeinen Elemente von Psychotherapie und die fünf psychologischen Heilmittel-/Heilwirkfaktor- Klassen nach J. D. Frank (1961).
Übersicht Krankheitsbegriff in der IP-GIPT.
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
Placebo site:www.sgipt.org. |
Information für Dienstleistungs-Interessierte.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Buchpräsentation. Spiro, Howard (2005). Placebo. Heilung, Hoffnung und Arzt-Patient-Beziehung. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/lit/huber/placebo.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
kontrolliert: irs 30.08.06
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
05.04.15 Linkfehler geprüft und korrigiert.