(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=07.04.2012 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung 20.10.14
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org__ Zitierung & Copyright
Anfang Existenzielle Psychotherapie_Überblick _Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges _Titelblatt _Konzept _Archiv _Region _Service-iec-verlag _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Bücher, Literatur und Links zu den verschiedensten Themen, hier die Buchpräsentation:
Buch-Präsentationen in der IP-GIPT
Existenzielle Psychotherapie
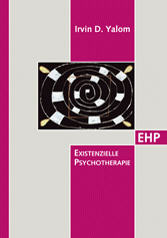
präsentiert von Rudolf Sponsel, Erlangen
Bibliographie * Verlagsinfo * Inhaltsverzeichnis * Leseprobe * Ergebnisse * Bewertung * Links * Literatur * Querverweise *
Bibliographie: Irvin D. Yalom (2010, 5.A.). Existenzielle Psychotherapie. Mit einem Vorwort des Autors: "25 Jahre Existenzielle Psychotherapie" und einem Interview mit Irvin Yalom von Ulfried Geuter: "Sich berühren lassen". Bergisch-Gladbach: EHP-Verlag. [Verlags-Info] 610 Seiten; Hardcover; ISBN: 978-3-926176-19-6
Verlagsinfo: "»Das große
Standardwerk der Humanistischen Psychologie - kaum ein Werk ist von so
zentraler und programmatischer Bedeutung. Und dabei schreibt Yalom so lesbar
wie in seinen Romanen, so dass er auch vielen Laien moderne Psychotherapie
verständlich machen kann - auf den Schreibtischen der Profis liegt
er eh'.«
»Kölner Stadt-Anzeiger: Welches Buch
lesen Sie derzeit? – Renan Demirkan: ›Yaloms Existenzielle Psychotherapie‹.«
»Ein Fehler, dieses Buch nur Psychiatern und Psychologen zu empfehlen,
denn jeder, der sich für Motive des menschlichen Daseins interessiert,
wird hier Anregungen finden.« (Rollo May)
»Ich bewundere das Sprachgefühl von Yalom,
seinen Mut, sich immer wieder selbst in Frage zu stellen, die Brillanz
seiner Ansichten, seinen Umgang mit Obsessionen, und zu guter Letzt seine
Fähigkeit, im schwierigsten Charakter den Menschen zu entdecken.«
(Washington Post)
"Wenn mich Leser fragen, welches meiner Bücher
mir am liebsten ist, würde ich wohl antworten, dass ich besonders
stolz auf das Buch ›Existenzielle Psychotherapie‹ bin.« (Irvin Yalom)"
Inhaltsverzeichnis
Danksagungen 11
1. Kapitel: Einführung 13
Existentielle Therapie: Eine dynamische Psychotherapie
16
Die existentielle Orientierung: Fremd, aber seltsam vertraut
22
Das Feld existentieller Psychotherapie
26
Existentielle Therapie und die akademische Gemeinschaft
34
I. Teil TOD
2. Kapitel: Leben, Tod und Angst
43
Die Interdependenz von Leben und Tod
43
Tod und Angst
56
Die Unachtsamkeit gegenüber dem Tod in der Theorie und
Praxis der Psychotherapie
72
Freud: Angst ohne den Tod
78
3. Kapitel: Der Todesbegriff bei Kindern
97
Das verbreitete Interesse von Kindern am Tod
98
Der Todesbegriff: Entwicklungsstufen
100
Todesangst und die Entwicklung der Psychopathologie
129
Die Todeserziehung von Kindern
133
4. Kapitel: Tod und Psychopathologie
137
Todesangst: Ein Paradigma der Psychopathologie
139
Besonderheit
145
Der letzte Retter
158
Auf dem Weg zu einer integrierten Sicht der Psychopathologie
172
Schizophrenie und die Furcht vor dem Tod
180
Ein existentielles Paradigma der Psychopathologie: Forschungsbefunde
186
5. Kapitel: Tod und Psychotherapie
193
Der Tod als Grenzsituation
193
Der Tod als ursprüngliche Quelle der Angst
225
Probleme der Psychotherapie
243
Lebensbefriedigung und Todesangst: Eine therapeutische Stütze
247
Todes-Desensibilisierung
251
II. Teil FREIHEIT 257
6. Kapitel: Verantwortung
261
Verantwortung als eine existentielle Angelegenheit 261
Vermeidung der Verantwortung: Klinische Erscheinungsformen 266
Übernahme von Verantwortung und Psychotherapie 275
Verantwortungsbewußtheit nach amerikanischer Art — oder:
Wie man sich um sein eigenes Leben kümmert,
selbst Regie führt, zuerst an sich denkt und es schafft 302
Verantwortung und Psychotherapie: Forschungsbefunde 311
Grenzen der Verantwortung 319
Verantwortung und existentielle Schuld 328
7. Kapitel: Wollen 341
Verantwortung, Wollen und Handlung 341
Zum klinischen Verständnis des Willens: Rank, Farber, May
349
Der Wille und klinische Praxis 358
Wunsch 360
Entscheidung — Wahl 373
Vergangenheit versus Zukunft in der Psychotherapie 410
III. Teil ISOLATION 417
8. Kapitel: Existentielle Isolation 419
Was ist existentielle Isolation? 421
Isolation und Beziehung 430
Existentielle Isolation und interpersonale Psychopathologie
443
9. Kapitel: Existentielle Isolation und Psychotherapie
465
Eine Anleitung zum Verständnis zwischenmenschlicher Beziehungen
465
Den Patienten mit der Isolation konfrontieren 470
Isolation und die Begegnung zwischen Patient und Therapeut
475
IV. Teil SINNLOSIGKEIT 493
10. Kapitel: Sinnlosigkeit 495
Das Problem des Sinns 498
Sinnhaftigkeit im Leben 499
Sinnverlust: Klinische Implikationen 526
Klinische Forschung 536
11. Kapitel: Sinnlosigkeit und Psychotherapie 543
Warum brauchen wir Sinn? 544
Psychotherapeutische Strategien 553
EPILOG 569
Anmerkungen 571
Personen- und Sachregister 611
Leseprobe: [S.544f]
"Warum brauchen wir Sinn?
Jahrzehnte empirischer Forschung haben gezeigt, daß unsere neuropsychologische
Organisation der Wahrnehmung so ist, daß wir hereinkommende zufällige
Stimuli augenblicklich zu Mustern formen. Die Gestalt-Bewegung in der Psychologie,
die von Wolfgang Köhler, Max Wertheimer und Kurt Koffka begründet
wurde, hat eine riesige Zahl von Forschungen, sowohl zur Wahrnehmung als
auch zur Motivation, hervorgebracht, die nachweist, daß wir sowohl
molekulare Stimuli als auch molare Verhaltensdaten und psychologische Daten
zu Gestalten (im Original deutsch), zu Konfigurationen oder Mustern organisieren.
Wenn uns also willkürliche Punkte auf einem Papier angeboten werden,
organisieren wir sie nach dem Figur-Grund-Prinzip; wenn uns ein unterbrochener
Kreis vorgelegt wird, nehmen wir ihn automatisch als vollständig wahr;
wenn uns unterschiedliche Verhaltensdaten präsentiert werden — zum
Beispiel ein seltsames Geräusch in der Nacht, ein ungewöhnlicher
Gesichtsausdruck, ein sinnloses internationales Ereignis —, macht man »Sinn«
daraus, indem man sie in ein vertrautes Erklärungssystem einpaßt.
Wenn irgendeiner dieser Stimuli oder Situationen nicht in unsere Muster
paßt, fühlen wir uns angespannt, verärgert und unzufrieden.
Dieses Unbehagen besteht solange, bis ein vollständigeres Verständnis
es uns erlaubt, die Situation in ein größeres erkennbares Muster
einzufügen.
Die Implikationen solcher Tendenzen zur Zuordnung
von Sinn sind offensichtlich. In der gleichen Weise, in der wir mit zufälligen
Stimuli und Ereignissen im Alltag umgehen und sie organisieren, setzen
wir uns auch mit unserer existentiellen Situation auseinander. Wir sind
angesichts einer gleichgültigen, ungeordneten Welt niedergeschlagen
und suchen nach Mustern, Erklärungen und dem Sinn der Existenz.
Ist man nicht in der Lage, ein zusammenhängendes
Muster zu erken-[<544] nen, fühlt man sich nicht nur irritiert
und unzufrieden, sondern auch hilflos. Der Glaube daran, daß man
einen Sinn entdeckt hat, geht immer einher mit einem Gefühl des Meisterns.
Selbst wenn die Sinnstruktur, die man entdeckt hat, den Gedanken beinhaltet,
daß man erbärmlich hilflos oder überflüssig ist, ist
es dennoch beruhigender als der Zustand der Ignoranz.
Es ist offensichtlich, daß wir uns nach Sinn sehnen und uns unbehaglich fühlen, wenn er fehlt. Man findet einen Zweck und hängt um seines Lebens willen daran. Aber der Zweck, den man erschafft, mildert unser Unbehagen nicht nachhaltig, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, daß wir ihn selbst hervorgebracht haben. (Frankl vergleicht den Glauben an einen persönlich konstruierten oder »erfundenen« Lebenssinn mit dem Erklettern eines Fakirseils, das man selbst in die Luft geworfen hat.) Es ist viel beruhigender zu glauben, daß der Sinn »da draußen« ist, und daß man ihn entdeckt hat. Viktor Frankl besteht darauf, daß »Sinn etwas ist, was eine Situation bedeutet, die eine Frage beinhaltet und nach einer Antwort sucht.... Es gibt für jedes Problem nur eine Lösung, die richtige; und es gibt für jede Lösung nur einen Sinn, und das ist ihr wahrer Sinn.«[FN 1] Er widerspricht Sartres Position, daß eine der Lasten der Freiheit darin besteht, daß man Sinn erfinden muß. In all seinen Schriften behauptet Frankl: »Sinn ist etwas, was man finden muß, nicht etwas, das einem gegeben wird. Der Mensch kann ihn nicht erfinden, sondern muß ihn entdecken.«[FN 2] Frankls Position ist im Grunde genommen religiös und beruht auf der Annahme, daß es einen Gott gibt, der einen Sinn für jeden von uns verfügt hat, der entdeckt und erfüllt werden muß. Selbst wenn wir den Sinn nicht in seiner Fülle begreifen können, besteht Frankl darauf, daß wir daran glauben müssen, daß es ein zusammenhängendes Lebensmuster und einen Zweck für das Leiden des Menschen gibt. Genau wie das Versuchstier den Grund für seine Qual nicht begreifen kann, so geht es auch den Menschen, die ihren Sinn nicht entdecken können, weil er in einer Dimension jenseits ihres Verständnisses liegt. Aber sind die grundlegenden Vorannahmen für diese Argumentation haltbar? Wenn es einen Gott geben sollte, warum sollte daraus schließlich folgen, daß Er einen Lebenszweck, und vor allem einen Lebenszweck für jeden von uns bereithält? Vergessen wir nicht, daß es der Mensch ist, nicht Gott, der vom Zweck besessen ist.
Lebenssinn und Werte
Eine Bedeutung des Sinns ist also, daß er ein Linderungsmittel
für die Angst ist: Er entsteht, um uns von der Angst zu befreien,
die von einem [<545] Leben und einer Welt ohne vorgegebene tröstliche
Struktur herrührt. Aber es gibt noch einen anderen entscheidenden
Grund, warum wir Sinn brauchen. Wenn einmal ein Gefühl für Sinn
entwickelt ist, entstehen daraus Werte — die ihrerseits synergetisch
dazu beitragen, daß sich unser Sinnempfinden steigert.
Was sind Werte, und warum brauchen wir sie? In seiner
Sinnkrise stellte Tolstoj nicht nur Warum-Fragen (»Warum lebe ich?«),
sondern auch Wie-Fragen (»Wie soll ich leben? Wovon soll ich leben?«)
— die alle ein Bedürfnis nach Werten, zum Ausdruck brachten, nach
einer Reihe von Leitlinien oder Prinzipien, die ihm sagten, wie er leben
sollte.
Eine anthropologische Standarddefinition für
Wert ist: »Eine Konzeption des 'Wünschenswerten', die explizit
oder implizit für ein Individuum oder eine Gruppe kennzeichnend ist
und die Auswahl aus verfügbaren Modi, Mitteln und Zielen des Handelns
beeinflußt« (kursiv von mir).[FN 3] Mit anderen Worten:
Werte stellen einen Code dar, demzufolge ein Handlungssystem ausformuliert
werden kann. Werte gestatten es uns, Verhaltensmöglichkeiten in eine
Zustimmungs-Ablehnungs-Hierarchie zu bringen. Wenn beispielsweise unsere
Sinnstruktur den Dienst am anderen betont, dann ist es leicht möglich,
Leitlinien zu entwickeln oder Werte, die es uns erlauben zu sagen: »Dieses
Verhalten ist richtig oder dieses Verhalten ist falsch.« Ich habe
in früheren Kapiteln betont, daß man sich selbst durch eine
Reihe fortlaufender Entscheidungen erschafft. Aber man kann nicht jede
Entscheidung sein ganzes Leben lang de novo treffen; gewisse übergeordnete
Entscheidungen müssen getroffen werden, die uns ein Organisationsprinzip
für nachfolgende Entscheidungen liefern. Wenn das nicht der Fall wäre,
würde ein großer Teil des Lebens für die Wirren des Entscheidens
gebraucht werden.
Werte liefern dem Individuum nicht nur einen Plan für persönliches
Handeln, sondern machen es den Menschen auch möglich, in Gruppen zu
leben. »Soziales Leben wäre unmöglich ohne sie....«
sagt uns Clyde Kluckholm und fährt fort: »Werte versehen das
soziale Leben mit einem Element der Vorhersagbarkeit.«[FN 4] Diejenigen,
die zu einer bestimmten Kultur gehören, haben eine gemeinsame Konzeption
über das, »was ist«, und entwickeln aus dieser Konzeption
heraus ein gemeinsames Glaubenssystem von dem, »was getan werden
muß«. Soziale Normen gehen aus einem Sinnschema hervor, das
den Konsens der Gruppe gefunden hat, und liefern die Vorhersagbarkeit,
die für soziales Vertrauen und den Zusammenhalt notwendig sind. Ein
gemeinsames Glaubenssystem sagt den Menschen nicht nur, was sie tun sollten,
sondern auch, was andere wahrscheinlich tun werden.
... ... ..."
Ergebnisse.
S. 569: "Epilog
Die Ausführungen über die Sinnlosigkeit spannen den Bogen zurück zu der Definition, mit der ich begann: Existentielle Therapie ist ein dynamischer Ansatz, der sich auf die Probleme konzentriert, die in der menschlichen Existenz wurzeln. Jeder von uns sehnt sich nach Dauerhaftigkeit, Gegründetheit, Gemeinschaft und Struktur; und doch müssen wir uns alle dem unausweichlichen Tod, der Bodenlosigkeit, der Isolation und der Sinnlosigkeit stellen. Existentielle Therapie ist auf ein Modell der Psychopathologie gegründet, welches davon ausgeht, daß Angst und deren fehlangepaßte Auswirkungen Antworten auf diese vier letzten Dinge sind.
Obwohl es notwendig war, jede dieser letzten Fragen getrennt zu erörtern, sind sie im Leben eng miteinander verwoben und stellen das Grundgewebe der Therapie dar. Für den Dialog zwischen Patient und Therapeut liefern sie sowohl den Inhalt als auch den Prozeß. Die Begegnung des Patienten mit dem Tod, mit Freiheit, Isolation und Sinnlosigkeit bietet dem Therapeuten explizites Interpretationsmaterial an. Selbst wenn diese Themen nicht offen in der Therapie auftauchen, geben sie immer noch einen modus operandi her. Psychische Phänomene wie Wollen, Verantwortung übernehmen, Beziehung zum Therapeuten aufnehmen und sich im Leben engagieren sind die entscheidenden Prozesse des therapeutischen Wandels. Es sind genau diese entscheidenden Aktivitäten, die zu oft als unbedeutende »Zugaben« in vielen therapeutischen Systemen betrachtet werden.
Existentielle Therapie fesselt die Aufmerksamkeit, indem sie fest in den ontologischen Untergrund eingepflanzt ist, in die tiefsten Strukturen menschlicher Existenz. Sie ist auch deshalb fesselnd, weil sie humanistisch begründet ist und als einzige unter den therapeutischen Paradigmen in völliger Übereinstimmung mit der höchst persönlichen Natur der therapeutischen Aufgabe ist. Darüber hinaus reicht das existentielle Paradigma sehr weit: Es umfaßt und nutzt die Einsichten vieler Philosophen, Künstler und Therapeuten über die schmerzhaften und erlösenden Folgen der Auseinandersetzung mit den letzten Dingen. [>570]
Aber es ist ein Paradigma, ein psychologisches Konstrukt, das nur durch seine klinische Nützlichkeit begründet werden kann. Wie bei allen Konstrukten wird auch diesem schließlich ein anderes Konstrukt mit größerer Erklärungskraft folgen. Jedes klinische Paradigma, das nicht vorzeitig durch irgendein offizielles Institut in Stein gemeißelt wurde, ist organisch; oder, indem es eine neuartige Perspektive eröffnet, ermöglicht es bis dahin verborgenen Daten aufzutauchen. Diese neuen Daten wiederum modifizieren das ursprüngliche Paradigma. Ich betrachte dieses existentielle Paradigma als eine erste Ausformulierung, die auf klinischen Beobachtungen gegründet ist, welche notwendigerweise hinsichtlich ihrer Quellen, ihrer Reichweite und ihrer Zahl begrenzt sind. Meine Hoffnung ist, daß dieses Paradigma organisch sein möge — daß es sich in seiner gegenwärtigen Form nicht nur als nützlich für die Kliniker erweist, sondern die Auseinandersetzung anregt, die notwendig ist, um es zu modifizieren und anzureichern."
Hinweis 19.10.2014: Irvin Yalom - Psychotherapeut aus Leidenschaft (Sternstunden Kultur 3sat(
Bewertung: Yaloms existenzielle Psychotherapie ist ein bedeutender Wurf zu den immerwährend großen existenziellen Themen und Sinnfragen des Lebens. Seine vier großen Themenbereiche sind der Tod, Freiheit und Verantwortung, Isolation und Gemeinschaft, Sinn und Sinnlosigkeitserleben. Er kommt in seinem Epilog zu dem Ergebnis: "Jeder von uns sehnt sich nach Dauerhaftigkeit, Gegründetheit, Gemeinschaft und Struktur; und doch müssen wir uns alle dem unausweichlichen Tod, der Bodenlosigkeit, der Isolation und der Sinnlosigkeit stellen. Existentielle Therapie ist auf ein Modell der Psychopathologie gegründet, welches davon ausgeht, daß Angst und deren fehlangepaßte Auswirkungen Antworten auf diese vier letzten Dinge sind." Das ist ein wichtiges Ergebnis, weil es letztlich bedeutet, wenn man in der Lebensberatung oder Psychotherapie zu kurz greift, zu wenig in die Tiefe geht, werden die Fehlanpassungen, sofern existenzielle Gründe mit hineinspielen, nicht dauerhaft zu korrigieren sein. Das ist eine Warnung an alle zu einseitig technisch oder pragmatisch orientierten Therapien. Ein wirklich schulenübergreifendes und damit integratives Werk, das zur Grundbibliothek einer PsychotherapeutIn gehören sollte. Es ist allerdings nicht ganz einfach, ja nicht selten eine schwierige Gratwanderung zwischen metaphysischer Selbstentfaltungshilfe und gebotener ideologischer Abstinenz aus Respekt vor der Selbstbestimmung des Gegenüber die jeweils richtige Variante und Dosierung zu finden.
Links (Auswahl: beachte)
- Buchpräsentation Humanistisch-Existenzielle Therapie.
Glossar, Anmerkungen und Endnoten
GIPT = General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
Bewertung. Bewertungen sind immer subjektiv, daher sind wir in unseren Buchpräsentationen bemüht, möglichst viel durch die AutorInnen selbst sagen zu lassen. Die Kombination Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassungen sollte jede kundige oder auch interessierte LeserIn in die Lage versetzen selbst festzustellen, ob sie dieses oder jenes genauer wissen will. Die BuchpräsentatorIn steht gewöhnlich in keiner Geschäftsbeziehung zu Verlag oder den AutorInnen; falls doch wird dies ausdrücklich vermerkt. Die IP-GIPT ist nicht kommerziell ausgerichtet, verlangt und erhält für Buchpräsentationen auch kein Honorar. Meist dürften aber die BuchpräsentatorInnen ein kostenfreies sog. Rezensionsexemplar erhalten. Die IP-GIPT gewinnt durch gute Buchpräsentationen an inhaltlicher Bedeutung und Aufmerksamkeit und für die PräsentatorInnen sind solche Präsentationen auch eine Art Fortbildung - so gesehen haben natürlich alle etwas davon, am meisten, wie wir hoffen Interessenten- und LeserInnen. Beispiele für Bewertungen: [1,2,3,]
___
Anm. Vorgesehene. Wir präsentieren auch Bücher aus eigenem Bestand, weil wir sie selbst erworben haben oder Verlage sie aus verschiedenen Gründen nicht (mehr) zur Verfügung stellen wollen oder können.
___
Standort Existenzielle Psychotherapie.
*
Menschenbild, Anthropologie, Wertproblem und Metaphysik in der Allgemeinen und Integrativen Psychologie und Psychotherapie.
Überblick und Kritik der Metaphysik, Religion, Sekten, Ideologie und Weltanschauung aus allgemein-integrativer und psycholologisch-psychotherapeutischer Perspektive.
Sinn in der IP-GIPT. * Spiritualität
Buch-Präsentationen, Literaturhinweise und Literaturlisten in der IP-GIPT. Überblick und Dokumentation.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
Buchpräsentation site:www.sgipt.org. |
Information für Dienstleistungs-Interessierte.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Buchpräsentation Existenzielle Psychotherapie von Irving D. Yalom. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT.Erlangen: https://www.sgipt.org/lit/EHP/YalomEP.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen, die die Urheberschaft der IP-GIPT nicht jederzeit klar erkennen lassen, ist nicht gestattet. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
20.10.14 Hinweis auf Interview mit Yalom in Stenerstunden Kultur.