Abteilung Politische Psychologie - Bereich Staatslehre - Präambel
IP-GIPT DAS=00.12.2002 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung 21.6.3
Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen * Mail:_sekretariat@sgipt.org_
Das Subsidiaritätsprinzip
Verkehrte Interpretation
und Euphemismus
Materialien zur Staatslehre von Rudolf Sponsel, Erlangen
Die Grund- und Kernidee des Subsidiaritätsprinzips [M01, M02, M03] besteht darin, a) zwischen staatlichen und nicht staatlichen Aufgaben und b) deren Organisation zu unterscheiden. Das ist sicher ein immerwährendes und grundlegendes Problem aller staatlichen Organisation und damit jeder Staatslehre. So soll sich der Staat z.B. aus Religion, Weltanschauungsfragen und der Familie so weit "wie möglich" raushalten. Geklärt werden muß, wer für was zuständig ist (staatliches Organ, Gebietskörperschaft)? Die wichtigen Funktionen sind: Abgrenzung, Zuständigkeit und Organisation.
Das Subsidiaritätsprinzip wird oft mißbraucht, wenn es darum geht, günstige Rahmenbedingungen für Eigennutz und Egoismus der Starken, Skrupellosen, Privilegierten und Intelligenten herzustellen, abzusichern oder auszubauen, wobei dies meist in falsch- euphemistische Begründungen wie "Freiheit" und "Selbstverantwortung" verpackt und verdreht wird, wo es in Wahrheit ums Geld, Vorteile und Pfründe geht. In Deutschland erfüllt diese Aufgabe bevorzugt die FDP und ihre entsprechenden GesinnungsgenossInnen in den anderen Parteien und gesellschaftlichen Institutionen.
Materialie
01 aus dem Lexikon der Staats- und Geldwirtschaft
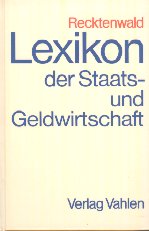 |
"Subsidiarität, subsidiär
=
unterstützend, ist ein Prinzip, das dem Einzelnen in Selbstverantwortung
den Vorrang vor dem Kollektiv einräumt Jeder Lebenskreis soll alle
Aufgaben in eigener Vollmacht und Initiative leisten, die er seinem Wesen
nach zu erfüllen hat. Was Angelegenheit der Familie ist, soll Sache
der Familien bleiben und nicht von anderen Institutionen übernommen
werden. Andererseits sollen die übergeordneten Gemeinwesen den unteren
helfen, daß sie ihren Aufgaben nachkommen können. Auch der Staat
hat nur subsidiären Charakter in Gesellschaft und Wirtschaft, dh er
soll sich auf die ihm eigenen Aufgaben beschränken und nicht die Rechte
des einzelnen und die der natürlichen Lebensgemeinschaften und Wirtschaftsformen
verletzen. Das gleiche gilt für den föderativ gegliederten Staat
selbst."
|
Materialie
02 aus dem Handlexikon der Politikwissenschaft (S. 112)
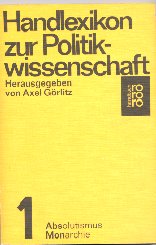
Rechts: Aus dem Stichwort Föderalismus S. 112. Eine weitere Ausführung findet sich S. 118 unter dem Stichwort Gemeinwohl. |
"In der weiteren Entwicklung der Theorie des Föderalismus sind in Europa Kant (1724-1804) und Rousseau (1712-1778) zu nennen, die an Montesquieu anknüpfen, sowie Tocqueville (1805-1859) und Proudhon (1809-1865), die die amerikanische Entwicklung kommentieren, wobei Proudhon allerdings auch auf Althusius zurückgreift. Im l9. Jahrhundert wird die Föderalismus-Diskussion in Deutschland durch Constantin Frantz (1817-1891) weitergeführt, der mit seiner Lehre vom 'bündischen Staat' sich sowohl gegen 'Sozialismus' und 'Liberalismus' als auch gegen 'Monarchie' und formale, absolute 'Demokratie' wendet. Die katholishe Soziallehre sieht den Föderalismus im politischen Bereich in engem Zusammenhang mit dem Subsidiaritätsprinzip: Der selbstverantwortliche Gliedstaat hat das Recht, seine eigenen Angelegenheiten selber zu regeln, Eingriffe des Gesamtstaates abzuwehren, Hilfe von diesem aber immer dann in Anspruch zu nehmen, wenn er seine Aufgabe allein nicht bewältigen kann. Der Gesamtstaat hat demnach die Pflicht, die freie Entfaltung der Eigenart der Gliedstaaten zu gewährleisten und sie dort zu unterstützen, wo ihre eigenen Kräfte nicht ausreichen. Die Entwicklung der Theorie der Föderalismus und seine historischen Ausformungen machen aber deutlich, daß dieser Vorrang der engeren vor der weiteren Gemeinschaft ('das Recht der kleineren Lebenskreise') keine conditio sine qua non für einen föderalistischen Aufbau des sozialen Ganzen ist." |
Materialie
03 aus dem Wörterbuch der Geschichte (dtv)
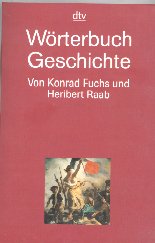 . . |
"Subsidiarität, Subsidiaritätsprinzip.
Prinzip der kath. Soziallehre, baut auf dem Solidarismus auf, begründet
in der Sozialnatur des Menschen als zugleich individuales und soziales
Wesen und im Naturrecht, wonach Anspruch auf Herstellung des dem Subsidiaritätsprinzip
entsprechenden Zustandes besteht, d. h. Verteilung aller gesellschaftl.
Zuständigkeiten nach dem Grundsatz des Gemeinwohls
und größtmöglicher Freiheit.
LIT. G. Wildmann, Personalismus Solidarismus und Gesellschaft (1961), E. Link, Das Subsidiaritätsprinzip (1955). A. F. Utz (Hrsg.), Das Subsidiaritätsprinzip (1953); F. Klüber, Grundlagen der kath. Gesellschaftslehre (1960); G. Wildmann, Personalismus Solidarismus und Gesellschaft (1961). |
Euphemismus, euphemistisch: falsch schön reden, aus dem Griechischen. eu =: gut, phem =: Laut/ Gestalt. Wenn etwa Bürger mehr Steuern, Krankenkassen- oder Rentenbeiträge zahlen müssen, nennt man das euphemistisch etwa: müssen stärker "eingebunden" werden oder mehr Selbst-/ Verantwortung übernehmen. Typisch für eine verlogene und heuchlerische Sprache besonders in der Politik und bei besonderen Anlässen (z.B. Fest-, Feiertags- und Grabreden), aber auch in Zeugnissen, die dank einer begnadeten deutschen Justiz zum euphemistischen Lügen gezwungen werden.
Subsidien: "Geldleistungen, die von einem Staat einem anderen für politische und militärische Hilfsdienste vertragsmäßig zugesichert werden. S. wurden im 17. und 18. Jh. von fremden Mächten insbes. an dt. Fürsten gezahlt, die sich auf diese Weise finanzielle Mittel für ihre kostspielige Hofhaltung und Politik beschafften. Viele Landesfürsten (Hessen-Kassel, Kurköln, Kurpfalz, Brandenburg-Preußen u. a.) schlossen mit den Niederlanden, mit England, Frankreich, der Republik Venedig u. a. Staaten Subsidienverträge ab. Sie betrafen in der Regel den Unterhalt von Söldnertruppen, die in den Kriegen der S. zahlenden Macht eingesetzt wurden, oder den Kauf ganzer Truppenteile für eine bestimmte Zeit ( >Soldatenhandel). In den zahlreichen dynastischen Kriegen des 18. Jh. verpflichteten sich auf diese Weise viele dt. Fürsten zur Aufstellung von Truppen bzw. zur Teilnahme an den Kriegen." Quelle: Wörterbuch der Geschichte, L-Z, Dietzverlag, Berlin 1983.
conditio sine qua non =: notwendige, unverzichtbare Bedingung. Um etwas zu kaufen, braucht man ein Tauschmittel - meist Geld - , das ist eine conditio sine qua non. Um etwas in seinen Besitz zu bringen aber nicht, man kann es leihen, stehlen, sich schenken lassen oder - wenn möglich - selber machen.
Staatslehre in der IP-GIPT
Überblick Programm Politische Psychologie in der IP-GIPT
Sponsel, Rudolf (DAS). Das Subsidiaritätsprinzip. Verkehrte Interpretation und Euphemismus. Materialien zur Staatslehre. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/politpsy/staatsl/subsidp.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Sofern andere Rechte berührt sind, müssen diese jeweils dort angefragt werden. In Streitfällen gilt der Gerichtsstand Erlangen als akzeptiert.
_ __Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
korrigiert: irs 210603