(ISSN 1430-6972)
IP-GIPT DAS=14.02.2019 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: TT.MM.JJ
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
Mail:_sekretariat@sgipt.org__ Zitierung & Copyright
Anfang Systemische Therapie in der Praxis__Datenschutz_ Überblick _Rel. Aktuelles _Rel. Beständiges _Titelblatt _Konzept _Archiv _Region _Service-iec-verlag _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Willkommen in unserer Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, Abteilung Bücher, Literatur und Links zu den verschiedensten Themen, hier:
Systemische Therapie in der Praxis
Buch und DVD im Set

Autorisierte Präsentation von Rudolf Sponsel, Erlangen
Gratulation zum langen Atem und Kampfgeist:
Die systemische Therapie wurde am 22.11.2018
für Erwachsene durch den Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) sozialrechtlich anerkannt.
Bibliographie * Verlagsinfo * Inhaltsverzeichnis * Leseprobe * Bewertung * Autor(Innen) * Links * Literatur * Querverweise *
Bibliographie: Borst, Ulrike & Sydow, Kirsten von (2018, Hrsg.) Systemische Therapie in der Praxis. Buch und DVD im Set. Buch 1063 Seiten, DVD Beiheft 24 Seiten. Weinheim: Beltz-Gruppe.
Verlagsinfo: "Im Lehrbuch wird die ganze Bandbreite der systemischen Ansätze umfassend und anschaulich dargestellt. Die Herausgeberinnen Kirsten von Sydow und Ulrike Borst beschreiben gemeinsam mit zahlreichen renommierten Autoren systemische Strategien, Techniken und Haltungen. Der Schwerpunkt liegt immer auf der praktischen Durchführung:
• Viele Fallbeispiele und Therapiedialoge
• FAQs und Antworten zum therapeutischen Vorgehen
• Typische Schwierigkeiten sowie Dos und Don’ts
In über vier Stunden bieten die DVDs ein breites Spektrum aus ganz unterschiedlichen Settings, wie beispielsweise die Familienskulptur, die Paartherapie oder das Erstgespräch."
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort 30
Einführung 36
I Grundlagen und Rahmenbedingungen 41
Editorial 42
1 Was ist Systemische Therapie? 47
Kirsten von Sydow
1.1 Begriffsklärung 47
1.2 Metatheoretischer Rahmen 53
1.3 Systeme, Strukturen und Kommunikation 55
1.4 Die Sprache der Veränderung 60
1.5 Bindungs- und Mehrgenerationenkontext 61
1.6 Ätiologische Konzepte 67
1.7 Theoretische Integration 67
2 Grundhaltung und Rahmung 70
Ulrike Borst
2.1 Menschenbild 71
2.2 Sicht auf die Patientin und den Patienten 75
2.3 Sicht des Therapeuten auf sich selbst 79
2.4 Rahmung der therapeutischen Beziehung 79
2.5 Grundhaltung 81
3 Therapeutische Beziehung 84
Ulrike Borst
3.1 Fallverstehen in der Begegnung als dialektisches, dynamisches Geschehen
84
3.2 Was wirkt? 87
3.3 Wie werden Beziehungs- und Begegnungskompetenzen gelernt? 90
3.4 Kritische Einordnung 93
II Therapiebeginn, Erstgespräch und Diagnostik 95
Editorial 96
4 Das Erstgespräch mit Einzelpersonen 99
Kirsten von Sydow
4.1 Grundlagen 99
4.2 Klinische Praxis 99
5 Das Erstgespräch mit Paaren und Familien 107
Helke Bruchhaus Steinert
5.1 Therapeutische Fertigkeiten in der Arbeit mit Paaren 107
5.2 Idealtypischer Ablauf eines Erstgesprächs mit Paaren 108
6 Auftrags- und Zielklärung 115
Ulrike Borst
6.1 Anliegen, Aufträge und Kontrakte 115
6.2 Systemische Problem- und Zieldefinitionen 116
6.3 Forschung zu Therapiezielen 120
6.4 Das Auftragskarussell 121
6.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten 122
7 Standardisierte Diagnostik 123
Kirsten von Sydow
7.1 Diagnostik im Erstgespräch 124
7.2 Klinische Diagnostik und Klassifikation von Störungen, Symptomatik
und Ressourcen 124
7.3 Interpersonelle Diagnostik 125
7.4 Therapieevaluation und Qualitätssicherung 127
7.5 Kritische Einordnung 132
8 Indikationen und Kontraindikationen 134
Kirsten von Sydow
8.1 Störungsspezifische Indikationen und Kontraindikationen 134
8.2 Settingbezogene Indikationen und Kontraindikationen 136
8.3 Auf den soziokulturellen Kontext bezogene Indikationen und Kontraindikationen
138
8.4 Indikationen und Kontraindikationen für spezifische systemische
Interventionen 139
8.5 Passung von Therapeut und Klient(en) 139
8.6 Kritische Einordnung 140
9 Qualitätssicherung und Therapieevaluation 142
Hugo Stephan Grünwald
9.1 Kontext 142
9.2 Wirksamkeit von Psychotherapie 142
9.3 Wirksamkeitsmessung in der Systemischen Therapie 143
9.4 Qualitäts- und Wirksamkeitskriterien 144
9.5 Pragmatisches Modell einer Qualitätssicherung für Systemische
Therapie 145
9.6 Standardpaket zur Qualitätssicherung systemischer Therapie
146
9.7 Kritische Einordnung 150
10 Umgang mit Diagnosen und Arztbriefen 152
Ulrike Borst
10.1 Kritische Würdigung der gängigen diagnostischen Manuale
153
10.2 Systemische Ergänzungen 155
10.3 Praktischer Umgang mit Diagnosen und Arztbriefen 157
10.4 Kritische Einordnung 160
11 Umgang mit schwierigen Situationen in der Anfangsphase 162
Margarete Malzer-Gertz • Miriam Gertz
11.1 Einleitung und Stand der Forschung 162
11.2 Was ist ein guter Therapiebeginn? 162
11.3 Typische Schwierigkeiten und Störungen in der Anfangsphase
einer Therapie 164
11.4 Ein ressourcenorientierter Blick auf schwierige Situationen in
der Anfangsphase der Therapie 166
11.5 Kritische Einordnung 174
III Basisinterventionen der Systemischen Therapie 177
Editorial 178
12 Ressourcenaktivierung und positive Umdeutung 182
Liz Nicolai
12.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 182
12.2 Indikationen und Kontraindikationen 187
12.3 Klinische Praxis 187
12.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 191
12.5 Kritische Einordnung 192
13 Genogrammarbeit 194
Bruno Hildenbrand
13.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 194
13.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 196
13.3 Klinische Praxis 196
13.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 201
13.5 Kritische Einordnung 201
14 Systemisches Fragen 203
Carmen Beilfuß
14.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 203
14.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 206
14.3 Klinische Praxis 206
14.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 216
15 Skulptur und Aufstellung 217
Kirsten von Sydow
15.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 217
15.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 220
15.3 Klinische Praxis 221
15.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 223
15.5 Kritische Einordnung 224
16 Psychoedukation 226
Josef Bäuml • Gabriele Pitschel-Walz
16.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 226
16.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 228
16.3 Klinische Praxis 229
16.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 233
16.5 Kritische Einordnung 234
17 Hausaufgaben und »intersession tasks« 238
Björn Enno Hermans
17.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 238
17.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 239
17.3 Klinische Praxis 241
17.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 243
18 Zeitlinienarbeit 245
Liz Nicolai
18.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 245
18.2 Indikationen und Kontraindikationen 247
18.3 Klinische Praxis 247
18.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 252
19 Arbeit mit Ritualen 254
Kathrin Stoltze
19.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 254
19.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 259
19.3 Klinische Praxis 260
19.4 Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 263
19.5 Kritische Einordnung 264
20 Reflektieren und Metakommunizieren 266
Ulrike Borst • Volkmar Aderhold
20.1 Hintergründe 266
20.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 270
20.3 Klinische Praxis 270
20.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 275
21 Arbeit mit inneren Anteilen 278
Sebastian Baumann
21.1 Einführung und allgemeine Merkmale 278
21.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 280
21.3 Klinische Praxis 281
21.4 Gute Erfahrungen und typische Fehler 287
21.5 Kritische Einordnung 289
22 Mentalisieren und Spiegeln 291
Uri Weinblatt
22.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 291
22.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 292
22.3 Klinische Praxis 294
22.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 299
22.5 Kritische Einordnung 300
23 Externalisieren von Problemen 302
Carmen C. Unterholzer
23.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 302
23.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 303
23.3 Klinische Praxis 303
23.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 307
24 Hilfreiche Literatur (und Medien) fu ¨r Klienten und Therapeuten
309
Kirsten von Sydow
24.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 309
24.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 310
24.3 Klinische Praxis 311
24.4 Gute Erfahrungen, typische Probleme 316
24.5 Kritische Einordnung 318
25 Videounterstützte Interventionen in der Systemischen Therapie
319
Carole Gammer
25.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 319
25.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 320
25.3 Klinische Praxis 321
25.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 325
26 Internalisieren von Lösungen 327
Stefan Geyerhofer
26.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 327
26.2 Klinische Praxis 328
26.3 Lösungsgeschichten »festschreiben« 329
26.4 Kritische Einordnung 335
27 Reguläre Therapiebeendigung und Behandlungsabbrüche
336
Margarete Malzer-Gertz • Miriam Gertz
27.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 336
27.2 Klinische Praxis: ein gelungenes Therapieende 336
27.3 Erfahrungen mit verschiedenen Varianten der Beendigung 340
27.4 Therapieabbrüche und atypische Therapiebeendigungen 340
27.5 Kritische Einordnung 343
IV Settings und Anwendungsformen 345
Editorial 346
28 Systemische Einzeltherapie 348
Konrad Peter Grossmann
28.1 Einleitung 348
28.2 Die Vielfalt systemischer Einzeltherapie 350
28.3 Wirkfaktoren und Outcome von Einzeltherapien 350
28.4 Zur Praxis von Einzeltherapie: Würdigen und Anregen 351
28.5 Klinische Praxis 351
28.6 Über Veränderung 353
28.7 Kritische Einordnung 356
29 Paartherapie 358
Hans Jellouschek
29.1 Theoretischer Hintergrund und Grundlagen 358
29.2 Therapieprozess und Abschluss 363
29.3 Fallbeispiel 364
29.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten 367
29.5 Kritische Einordnung 367
30 Familientherapie 369
Reinert Hanswille
30.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 369
30.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 369
30.3 Klinische Praxis 370
30.4 Der Prozess der Familientherapie 373
30.5 Fallbeispiel 376
30.6 Kritische Einordnung 378
31 Systemische Gruppentherapie 380
Bettina Wilms
31.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 380
31.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 381
31.3 Klinische Praxis 382
31.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 383
31.5 Kritische Einordnung 383
32 Multifamilien- und Paargruppentherapien 385
Eia Asen
32.1 Theoretischer Hintergrund und Grundlagen 385
32.2 MFT als Kontext für Perspektivenerweiterung 386
32.3 Klinische Vignette: MFT in einer Familientagesklinik 390
32.4 Erfahrungen und typische Schwierigkeiten 391
32.5 Kritische Einordnung 392
33 Arbeit mit komplexen Helfersystemen 394
Ulrike Borst • Volkmar Aderhold
33.1 SYMPA – systemtherapeutische Methoden psychiatrischer
Akutversorgung 395
33.2 Bedürfnisangepasste Behandlung und »offener Dialog«
396
33.3 Variante »Good Future Dialogue« 404
33.4 Netzwerke 405
33.5 Kritische Einordnung 407
34 Aufsuchende Familientherapie (»Home Treatment«) 409
Hartmut Epple
34.1 Hintergrund und ausgewählte Forschungsergebnisse 409
34.2 Aufsuchende Therapie in Jugendhilfe-Kontexten 411
34.3 Klinische Praxis 412
34.4 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 415
34.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 416
34.6 Kritische Einordnung 417
35 Veränderungen des Settings als Intervention 420
Martin Rufer
35.1 Das Setting in der Psychotherapie 420
35.2 Das (Mehrpersonen-)Setting in der Systemischen Therapie 420
35.3 Relevantes System, variables und flexibles Setting 421
35.4 Therapiesystem – diadische und triadische Therapiesettings 423
35.5 Indikatoren und Kriterien für die Wahl und Veränderung
eines Settings 423
35.6 Kritische Einordnung 426
V Störungs- und problemspezifische Ansätze: Erwachsene 429
Editorial 430
36 Depressionen 433
Ulrike Borst
36.1 Diagnostik, Epidemiologie, Risiko- und Schutzfaktoren 433
36.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 435
36.3 Klinische Praxis: Wege aus der Depression 437
36.4 Weitere Therapieoptionen 442
36.5 Typische Probleme, gute Erfahrungen 443
36.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 444
37 Angststörungen 447
Christina Hunger • Ulrike Willutzki
37.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 447
37.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 448
37.3 Klinische Praxis 450
37.4 Weitere Therapieoptionen 453
37.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten 454
37.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 455
38 Zwangsstörungen 457
Igor Tominschek
38.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 457
38.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 457
38.3 Klinische Praxis 458
38.4 Weitere Therapieoptionen 460
38.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 460
38.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 460
39 Belastungs-, Anpassungsstörungen und einfache PTBS 462
Urs Hepp • Jochen Binder
39.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 462
39.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 465
39.3 Klinische Praxis 466
39.4 Weitere Therapieoptionen 469
39.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 470
39.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 470
40 Komplexe Traumafolgestörungen und Borderline-Persölichkeitsstörungen
472
Kirsten von Sydow
40.1 Konzeptualisierung, Diagnostik und Epidemiologie 472
40.2 Therapieziele 476
40.3 Klinische Praxis 476
40.4 Gute Erfahrungen und typische Probleme 485
41 Weitere Persönlichkeitsstörungen 488
Elisabeth Wagner
41.1 Diagnose von Persönlichkeitsstörungen 488
41.2 Dysfunktionale Fühl-Denk-Verhaltensprogramme bzw. Schemata
488
41.3 Klinische Praxis 489
41.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 492
41.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 492
42 Psychotische Störungen 494
Ulrike Borst • Volkmar Aderhold
42.1 Diagnostik, Komorbidität, Epidemiologie und Ätiologie
494
42.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 499
42.3 Klinische Praxis 499
42.4 Weitere Therapieoptionen 505
42.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 506
42.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 506
43 Psychosomatik 508
Lothar Eder
43.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 508
43.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 509
43.3 Klinische Praxis 510
43.4 Weitere Therapieoptionen 513
43.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 514
43.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 514
44 Sexuelle Störungen und Probleme 516
Kirsten von Sydow
44.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 516
44.2 Therapeutische Ziele 518
44.3 Klinische Praxis 519
44.4 Weitere Therapieoptionen 524
44.5 Typische Probleme 525
44.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 525
45 Burn-out und arbeitsassoziierte Störungen 529
Sebastian Haas
45.1 Hintergrund 529
45.2 Klinik, Diagnostik und Differenzialdiagnostik von Burn-out 530
45.3 Therapeutische Ziele und Strategien 532
45.4 Klinische Praxis 537
45.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten 538
45.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 539
VI Störungs- und problemspezifische Ansätze:
Kinder, Jugendliche (und junge Erwachsene)
541
Editorial 542
46 Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen 545
Dagmar Pauli
46.1 Diagnostik, Epidemiologie und Komorbidität 545
46.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 546
46.3 Klinische Praxis 547
46.4 Weitere Therapieoptionen 551
46.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 552
47 Substanzgebrauchsstörungen bei Jugendlichen und (jungen)
Erwachsenen 554
Andreas Schindler (unter Mitarbeit von Brigitte Gemeinhardt)
47.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 554
47.2 Therapieziele und Vorgehen 557
47.3 Klinische Praxis 557
47.4 Weitere Therapieoptionen 561
47.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 562
47.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 562
48 Internet- und medienbezogene Störungen 564
Oliver Bilke-Hentsch
48.1 Diagnostik, Komorbidität und Epidemiologie 564
48.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 568
48.3 Klinische Praxis 569
48.4 Weitere Therapieoptionen 571
48.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 573
48.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 574
49 Depressionen bei Kindern und Jugendlichen 575
Ingo Spitczok von Brisinski
49.1 Diagnostik, Komorbidität, Epidemiologie 575
49.2 Zentrale Therapieziele 578
49.3 Klinische Praxis 578
49.4 Weitere Therapieoptionen 581
49.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 581
49.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 582
50 Angststörungen von Kindern und Jugendlichen 585
Wilhelm Rotthaus
50.1 Formen der Angst, Häufigkeit und Komorbidität 585
50.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 586
50.3 Gute Erfahrungen und häufige Fallstricke 589
50.4 Empirische Befunde und kritische Einordnung 590
51 Traumafolgestörungen 591
Alexander Korittko
51.1 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 591
51.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 592
51.3 Klinische Praxis 593
51.4 Weitere Therapieoptionen 594
51.5 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten 595
51.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 595
52 ADHS 598
Helmut Bonney
52.1 Diagnostik, Komorbidität, Differenzialdiagnostik und Risikofaktoren
598
52.2 Klinische Praxis 599
52.3 Empirische Befunde und kritische Einordnung 601
53 Autismus-Spektrum-Störungen 603
Ingo Spitczok von Brisinski
53.1 Diagnostik, Komorbidität, Epidemiologie 603
53.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 605
53.3 Klinische Praxis 605
53.4 Weitere Therapieoptionen 610
53.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 611
53.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 612
54 Schulverweigerung 614
Haja (Johann Jakob) Molter • Inge Singer-Rothöft
54.1 Diagnostik und Komorbidität 614
54.2 Klinische Praxis 616
54.3 Gute Erfahrungen und typische Probleme 619
54.4 Empirische Befunde und kritische Einordnung 620
55 Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters 621
Miriam Haagen
55.1 Grundlagen und Rahmenbedingungen 621
55.2 Diagnostik, Komorbidität und Differenzialdiagnostik 622
55.3 Therapieziele und klinische Praxis 624
55.4 Gute Erfahrungen und typische Probleme 627
VII Systemische Therapie in besonderen Kontexten 629
Editorial 630
56 Krisenintervention und Suizidalität bei Erwachsenen 633
Urs Hepp
56.1 Hintergrund und spezielle Aspekte von Krisen- und Notfallsituationen
633
56.2 Anwendung systemischer Konzepte 634
56.3 Klinische Praxis 635
56.4 Umgang mit Diversität 638
56.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 638
56.6 Kritische Einordnung 639
57 Akute Krisen und suizidales Handeln von Kindern und Jugendlichen
642
Wilhelm Rotthaus
57.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 642
57.2 Systemisches Verständnis 643
57.3 Klinische Praxis 644
57.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 647
57.5 Kritische Einordnung 647
58 Therapie mit Paaren am Rande der Trennung 649
Peter Fraenkel
58.1 Besonderheiten und allgemeine Merkmale 649
58.2 Anpassung systemischer Strategien 651
58.3 Umgang mit Diversität 652
58.4 Klinische Praxis 652
58.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 660
59 Kindeswohlgefährdung 662
Bernd Reiners
59.1 Hintergrund 662
59.2 Diagnostik 664
59.3 Klinische Praxis 666
59.4 Weitere Hilfsoptionen 668
59.5 Gute Erfahrungen, typische Probleme und Fehler 669
59.6 Kritische Einordnung 669
60 Eltern bleiben bei Trennung und Scheidung 672
Kurt Pelzer
60.1 Ein Ziel mit paradoxem Charakter 672
60.2 Ein systemischer Blick auf Eskalationsdynamiken 673
60.3 »Mediationsorientierte« systemische Therapie 674
60.4 Ein kurzer Blick auf sogenannte »hochstrittige Eltern«
676
60.5 »Für das Kind« oder Allparteilichkeit? 677
61 Patchworkfamilien 679
Thomas Hess • Claudia Starke
61.1 Hintergrund 679
61.2 Besonderheiten 681
61.3 Therapie 682
61.4 Praxisbeispiel mit Fragen 687
61.5 Gute Erfahrungen, Fehler und Nebenwirkungen 689
61.6 Kritische Einordnung 690
62 Schwere Erkrankungen, Sterben und Tod im familiären Kontext
692
Miriam Haagen
62.1 Trauernde Angehörige in Psychotherapie und Beratung 692
62.2 Integration familientherapeutischer Konzepte in die Medizin 693
62.3 Unterschiedliche Reaktionen von Kindern und Erwachsenen 695
62.4 Familiengespräche im medizinischen Kontext 696
62.5 Gute und schwierige Erfahrungen 700
62.6 Kritische Einordnung 701
63 Systemische Therapie mit älteren Klienten 703
Bernadette Ruhwinkel
63.1 Besonderheiten, Hintergrund und allgemeine Merkmale 703
63.2 Anpassung oder Erneuerung der Strategien 703
63.3 Klinische Praxis 705
63.4 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 708
63.5 Kritische Einordnung 709
64 Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie 711
Christiane Ludwig-Körner
64.1 Hintergrund und allgemeine Merkmale 711
64.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 713
64.3 Klinische Praxis 713
64.4 Gute Erfahrungen und typische Schwierigkeiten und Fehler 715
64.5 Kritische Einordnung 715
65 Kinderorientierte Familientherapie (KOF) 717
Bernd Reiners
65.1 Besonderheiten, Hintergrund und allgemeine Merkmale 717
65.2 Klinische Praxis 717
65.3 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 721
65.4 Kritische Einordnung 721
66 Geschlechtsspezifische Aspekte 724
Kerstin Dittrich
66.1 Hintergrund: Geschlecht aus systemischer Sicht 724
66.2 Die Bedeutung von Geschlechterstereotypen für die Psychotherapie
725
66.3 Anregungen zu geschlechtersensibler Therapie 726
67 Systemische Therapie bei Migration und Flucht 729
Andrea Lanfranchi
67.1 Hintergrund und Besonderheiten 729
67.2 Systemtherapeutische Ziele und Strategien 732
67.3 Klinische Praxis 736
67.4 Fallstricke 740
67.5 Kritische Einordnung 741
68 Schreiben in der Systemischen Therapie 744
Carmen C. Unterholzer
68.1 Hintergründe und Entwicklungen 744
68.2 Therapeutisch sinnvolle Textgattungen 745
68.3 Klinische Praxis 746
68.4 Gute Erfahrungen, Schwierigkeiten und Fehler 748
68.5 Kritische Einordung 749
69 Online-Therapie 751
Agnes Justen-Horsten
69.1 Besonderheiten, Hintergrund und allgemeine Merkmale 751
69.2 Was versteht man unter Online-Therapie? 753
69.3 Klinische Praxis 754
69.4 Gute Erfahrungen, typische Probleme 757
69.5 Kritische Einordnung 757
VIII Systemisch-integrative Therapiemanuale für Erwachsene 761
Editorial 762
70 Lösungsorientierte Kurzzeittherapie (nach Steve de Shazer)
766
Stefan Beher
70.1 Hintergrund 766
70.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 766
70.3 Klinische Praxis 767
70.4 Gute Erfahrungen, typische Probleme 772
70.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 773
71 Systemische Paartherapie bei Depressionen (Londoner Manual) 775
Ulrike Borst • Kirsten von Sydow
71.1 Hintergrund 775
71.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 776
71.3 Klinische Praxis 776
71.4 Weitere Therapieoptionen 781
71.5 Gute Erfahrungen, typische Probleme 781
71.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 781
72 Emotionsfokussierte Paartherapie (EFT) 784
Oskar Holzberg • Andrea Seiferth
72.1 Hintergrund 784
72.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 785
72.3 Klinische Praxis 785
72.4 Empirische Befunde und kritische Einordnung 788
73 Das Leeds-Manual für Systemische Familientherapie 790
Peter Stratton • Helga Hanks
73.1 Hintergrund 790
73.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 790
73.3 Klinische Praxis 791
73.4 Weitere Entwicklungen 796
73.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 796
73.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 797
74 Differenzierungsorientierte Paar-/Sexualtherapie (nach David Schnarch)
799
Kirsten von Sydow
74.1 Hintergrund 799
74.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 802
74.3 Klinische Praxis 804
74.4 Weitere Therapieoptionen 807
74.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 807
75 Behavioral Couple Therapy for Alcohol and Drug Abuse (BCT) 810
Johannes Lindenmeyer
75.1 Hintergrund 810
75.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 810
75.3 Klinische Praxis 811
75.4 Weitere Therapieoptionen 814
75.5 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 814
75.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 815
76 Systemische Therapie mit der inneren Familie (nach Richard Schwartz)
817
Dagmar Kumbier
76.1 Hintergrund 817
76.2 Klinische Praxis 818
76.3 Gute Erfahrungen, typische Schwierigkeiten und Fehler 820
76.4 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 821
76.5 Weitere Therapieoptionen 821
76.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 821
77 Systemische Gruppentherapie bei komplexen Traumafolgestörungen
– Frauen nach sexuellem Missbrauch
(Kopenhagener Manual) 823
Kirsten von Sydow • Marianne Engelbrecht Lau
77.1 Hintergrund 823
77.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 823
77.3 Klinische Praxis 823
77.4 Weitere Therapieoptionen 826
77.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 826
77.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 829
IX Systemisch-integrative Therapiemanuale für Kinder und Jugendliche 831
Editorial 832
78 SPACE (Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions) –
ein Programm für förderliches Elternverhalten bei Kindesängsten
835
Eli Lebowitz • Haim Omer
78.1 Hintergrund 835
78.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 837
78.3 Klinische Praxis 837
78.4 Weitere Therapieoptionen 840
78.5 Gute Erfahrungen, typische Probleme 841
78.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 841
79 Bindungsbasierte Familientherapie (Attachment-Based Family Therapy,
ABFT) 843
Guy Diamond
79.1 Hintergrund 843
79.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 844
79.3 Klinische Praxis 845
79.4 Gute Erfahrungen und typische Probleme 847
79.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 847
80 Familienbasierte Therapie für Jugendliche mit Essstörungen
(Family-Based Treatment for Adolescent Eating Disorders, FBT)
850
Roslyn Binford Hopf • James Lock • Daniel Le Grange
80.1 Hintergrund 850
80.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 850
80.3 Klinische Praxis 850
80.4 Empirische Befunde und kritische Einordnung 853
81 Multidimensionale Familientherapie (MDFT) 856
Andreas Gantner • Howard Liddle
81.1 Hintergrund 856
81.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 856
81.3 Klinische Praxis 857
81.4 Weitere Therapieoptionen 859
81.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 859
81.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 860
82 Multisystemische Therapie (MST) 862
Bruno Rhiner
82.1 Hintergrund 862
82.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 866
82.3 Klinische Praxis 867
82.4 Gute Erfahrungen und typische Probleme 869
82.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 870
83 »ich schaff’s« – das lösungsfokussierte Programm
für Kinder und Jugendliche 873
Thomas Hegemann • Christina Achner
83.1 Hintergrund 873
83.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 873
83.3 Klinische Praxis 874
83.4 Weitere Therapieoptionen 877
83.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 878
83.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 878
84 Elterliche Präsenz – Nonviolent Resistance (NVR) Elterncoaching
880
Uri Weinblatt
84.1 Hintergrund 880
84.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 881
84.3 Klinische Praxis 882
84.4 Gute Erfahrungen und typische Probleme 888
84.5 Empirische Befunde und kritische Einordnung 889
85 Mentalisierungsbasierte Therapie mit Familien (MBT-F) 891
Eia Asen • Uri Weinblatt
85.1 Hintergrund 891
85.2 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 893
85.3 Klinische Praxis 894
85.4 Weitere Therapieoptionen 899
85.5 Gute Erfahrungen und typische Probleme 900
85.6 Empirische Befunde und kritische Einordnung 901
X Methodenintegration und weitere Aspekte professioneller
Praxis 903
Editorial 904
86 Ethik und Berufsrecht 906
Martin Stellpflug • Jan Moeck
86.1 Ethik in der Psychotherapie 906
86.2 Rechtsgrundlagen des Berufsrechts 907
86.3 Allgemeine Berufspflichten 907
86.4 Spezielle Berufspflichten 908
87 Risiken und Nebenwirkungen 912
Bernhard Strauß
87.1 Hintergrund 912
87.2 Haupt- und Nebenwirkungen 912
87.3 Erfassung unerwünschter Wirkungen von Psychotherapie 914
87.4 Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 915
87.5 Spezifische Nebenwirkungen systemischer Psychotherapien 916
87.6 Kritische Einordnung 919
88 Die Approbationsausbildung und -prüfung 920
Reinert Hanswille
88.1 Hintergrund 920
88.2 Der Erwerb der Approbation nach dem gegenwärtig gültigen
Psychotherapeutengesetz 921
88.3 Reform der Psychotherapeutenausbildung 926
88.4 Kritische Einordnung 927
89 Forschungsstand, wissenschaftliche und sozialrechtliche Anerkennung
der Systemischen Therapie 929
Kirsten von Sydow
89.1 Hintergrund 929
89.2 Wirksamkeit von Systemischer Therapie bei Störungen Erwachsener
930
89.3 Wirksamkeit von Systemischer Therapie bei Störungen von Kindern
und Jugendlichen 934
89.4 Die Prüfung und der Stand der wissenschaftlichen und sozialrechtlichen
Anerkennung der Systemischen Therapie in Deutschland 937
- 89.5 Der Stand der Prüfung der Systemische Therapie als Verfahren
der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie durch den GB-A 940
89.6 Kritische Einordnung 941
90 Aus- und Weiterbildung in Systemischer Therapie an Hochschulen
und privaten Instituten 944
Kirsten von Sydow • Ulrike Borst • Stefan Geyerhofer
90.1 Systemische Aus- und Weiterbildung im Umbruch 944
90.2 Systemische Aus- und Weiterbildung an privaten Instituten 948
90.3 Systemische Aus- und Weiterbildung an Hochschulen 951
90.4 Weitere zentrale Ausbildungsbestandteile: Klinische Praxis, Selbsterfahrung,
Supervision und Prüfungen 957
91 Integrative Systemische Therapie (nach William M. Pinsof) – IST
963
William M. Pinsof
91.1 Hintergrund 963
91.2 Die Ziele der Integrativen Systemischen Therapie 963
91.3 Die Essenz der Integrativen Systemischen Therapie 964
91.4 Metarahmen zur Hypothesenbildung 965
91.5 Die Blaupause 966
91.6 Metarahmen zur Planung 966
91.7 Durchführung 972
91.8 Der Pfeil und die Leitlinien: Was ist wann zu tun? 973
91.9 Die Arbeitsbeziehung als Allianz 974
91.10 Integrative systemische Therapie als strukturierte und disziplinierte
Improvisation 975
91.11 Integrative systemische Therapie als Rahmen für lebenslanges
Lernen 975
Schlusswort 976
Kirsten von Sydow • Ulrike Borst
Anhang 983
Literatur 984
Über die Herausgeberinnen 1044
Autorenverzeichnis 1046
Sachwortverzeichnis 1050
Leseprobe aus: von Sydow/Borst, Systemische Therapie in der Praxis, ISBN 978-3-621-28 527-8 © 2018 Beltz Verlag, Weinheim Basel
1 Was ist Systemische Therapie?
Kirsten von Sydow
»Ich lebe nicht mit mir allein, ich werde Teil von dem, was mich
umgibt.«
(Lord Byron, 1788-1824, englischer Dichter)
1.1 Begriffsklärung
Die Definition von Systemischer Therapie, auf die sich die deutschen
systemischen Dachverbände – orientiert an international gebräuchlichen
Definitionen – geeinigt haben, lautet:
Betrachtet werden Wechselwirkungen zwischen intrapsychischen, biologisch-somatischen
und interpersonellen Prozessen von Individuen und Gruppen als wesentliche
Aspekte von Systemen. Die Elemente der jeweiligen Systeme und ihre wechselseitigen
Beziehungen sind die Grundlage für die Diagnostik und Therapie von
psychischen Erkrankungen.
Auf dieser Definition aufbauend wurde die Systemische
Therapie in Deutschland wissenschaftlich anerkannt (WBP, 2009). Andere
Texte definieren Systemische Therapie – sehr weit – als das »Schaffen
von Bedingungen für Selbstorganisationsprozesse« (Schiepek et
al., 2013), was weder spezifisch für Psychotherapie noch für
systemische Psychotherapie ist (von Sydow, 2015).
Ziel der Systemischen Therapie ist es, symptomfördernde
familiäre Interaktionen und Strukturen, dysfunktionale Lösungsversuche
und starre/einschränkende Familienerzählungen infrage zu stellen
und die Entwicklung neuer, gesundheitsfördernder Interaktionen, Lösungsversuche
und Erzählungen anzuregen.
Die psychologische Grundlagenforschung belegt die
theoretischen Grundannahmen der Systemischen Therapie und stützt die
systemische Prämisse, dass Kontexterweiterungen und ein Fokus auf
zwischenmenschliche Beziehungen für das Verstehen und Behandeln individueller
Pathologie entscheidende therapeutische Vor-[>48]teile bieten. Die Ausführungen
in diesem Kapitel orientieren sich an von Sydow (2015) und von Sydow et
al. (2007).
Systemische Therapie und Paar-/Familientherapie
»Systemische Therapie« beschreibt eine theoretische Orientierung;
diese kann als Einzel-, Paar-, Familien-, Gruppen- oder Multifamiliengruppentherapie
realisiert werden. »Paar-/Familientherapie« bezeichnet dagegen
ein therapeutisches Setting bzw. eine Anwendungsform. Neben der Systemischen
Familientherapie existieren auch behaviorale, psychodynamische und humanistische
Familientherapien (Scheib & Wirsching, 2004).
Systemische Therapie und Paar-/Familientherapie
überlappen sich, sind aber nicht identisch. Systemische Therapie ist
historisch aus der Familientherapie hervorgegangen. Die meisten Familien-
und Paartherapeuten in Deutschland und im Ausland orientieren sich theoretisch
und methodisch (nur oder auch) an systemischen Konzepten (von Sydow et
al., 2007). In den USA ist ein systemisches Grundverständnis obligatorisch
für die Akkreditierung aller Paar- und Familientherapie-Ausbildungsgänge
bei der American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT; zit.
n. von Sydow et al., 2007, S. 14).
Familie und Partnerschaft sind wesentliche soziale
Kontexte des menschlichen Lebens. Orientiert an einem offenen Familienkonzept
(Schneewind, 2010) bezieht die Systemische Therapie Partner, Eltern, Kinder,
manchmal weitere Verwandte und andere Bezugspersonen sowie das weitere
professionelle Helfersystem (Ärzte, Lehrer, Sozialarbeiter u. a.)
in die Behandlung ein. Bezugspersonen werden direkt »in vivo«
einbezogen (Arbeit im Mehrpersonensetting) oder indirekt, indem Fragen
zum Verhalten, mutmaßlichem Erleben und den Intentionen abwesender
Bezugspersonen gestellt werden. Paartherapie mit hetero- oder homosexuellen
Paaren wird als eine Variante von Familientherapie verstanden.
Überblick zu grundlegenden Systemischen Therapieansätzen
Tabelle 1.1 gibt einen vereinfachten Überblick zu grundlegenden
Perspektiven der Systemischen Therapie. Es wird deutlich, dass unser Buch,
ebenso wie alle anderen Systemische-Therapie-Lehrbücher, stark auf
die strukturelle und die ressourcenbezogene Perspektive setzt. Daneben
räumen wir auch der Mehrgenerationen- und Bindungsperspektive und
den neuen »Trademark-Therapien« einen hohen Stellenwert ein.
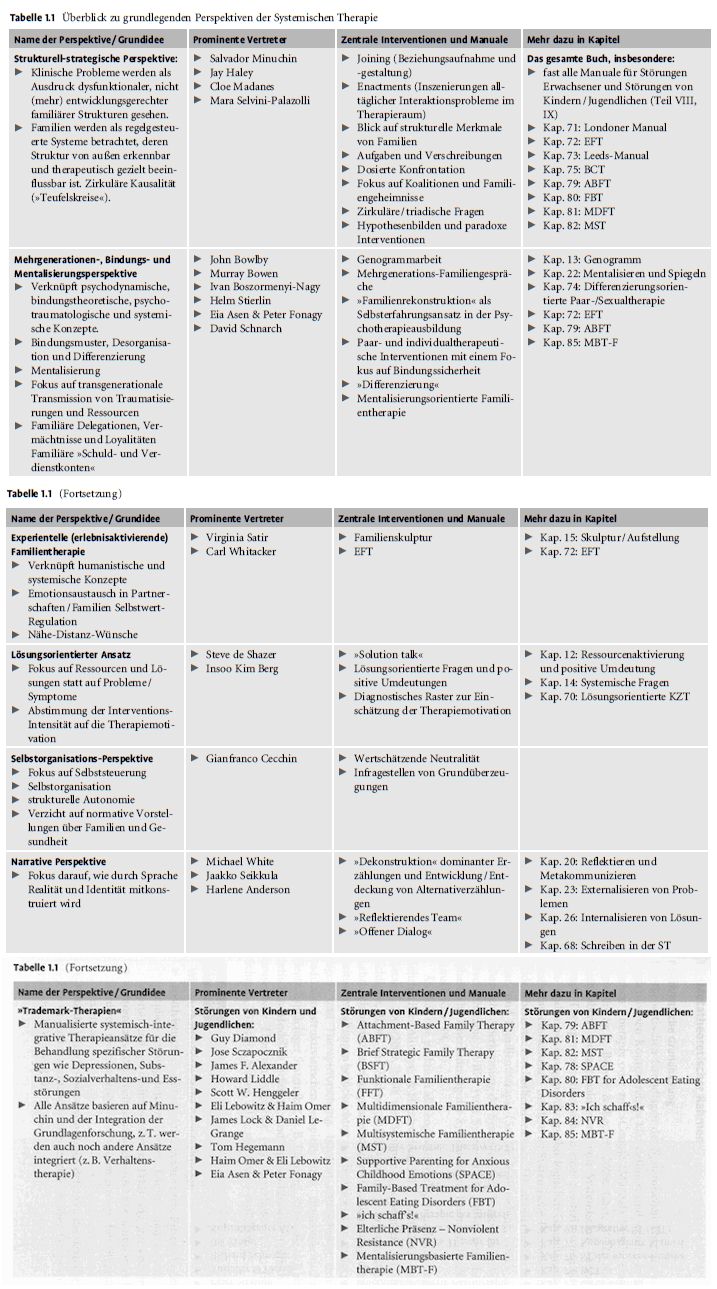
Die DVDs
DVD 1:
Grundlagen der Systemischen Therapie
1 Grundlagen der Systemischen Therapie
1.1 Einzeltherapeutisches Erstgespräch 15:22
1.2 Paartherapeutisches Erstgespräch 16:33
1.3 Umgang mit schwierigen Situationen in der Anfangsphase 14:21
1.4 Genogramm 15:50
1.5 Reguläre Therapiebeendigung und Therapieabbrüche 11:59
1.6 Veränderungen des Settings als Intervention (vier unterschiedliche
Settings) 17:19
DVD 2:
Störungsspezifische Therapie, Umgang mit besonderen Problemkonstellationen
und manualisierte systemisch-integrative Therapieansätze
2 Störungsspezifische Therapie
2.1 Depressionen (Einzelgespräch und Paargespräch) 17:28
2.2 Essstörungen (Familiengespräch) 26:42
2.3 Burnout und Arbeitsstörungen (Erst- und Abschlussgespräch
im Kontext stationärer Therapie) 23:04
3 Umgang mit besonderen Problemkonstellationen
3.1 Patchworkfamilien (drei unterschiedliche Settings) 20:16
3.2 Schwere Erkrankungen, Sterben und Tod im familiären Kontext
21:59
3.3 Systemische Therapie mit älteren Klienten 18:42
4 Manualisierte systemisch-integrative Therapieansätze
4.1 Emotionsfokussierte Paartherapie (EFT) 27:04
4.2 Multidimensionale Familientherapie (MDFT)
(drei unterschiedliche Settings) 35:22
"Beschreibung der DVD
Warum diese DVD? Psychotherapeutische Expertise kann nicht nur durch
Lesen oder Zuhören im Seminar erworben werden. Mindestens ebenso wichtig
ist es, durch Beobachtung von anderen, mehr darüber zu erlernen, wie
man Dinge tun kann. Albert Bandura beschrieb 1963 das Beobachtungs-/Modelllernen
als eine zentrale Lernmethode. Im Kontext von Familientherapie und Systemischer
Therapie hatten das Modelllernen und die Reflexion von Psychotherapie aufgrund
direkter Beobachtung schon immer einen besonders hohen Stellenwert. Bereits
in den Anfängen der Familientherapie wurde mit Ton- und Filmaufnahmen
gearbeitet. Standardmethoden der Systemischen Therapie wie Life-Supervision
und Reflektierendes Team wurden in diesem Kontext entwickelt. In Ausbildungsgruppen
wird ständig mit Master-Rollenspielen und Rollenspielen in Kleingruppen
sowie Videos und Tonbandaufnahmen von echten Patientengesprächen gearbeitet.
Und schließlich ist es für Abschlüsse in Systemischer Therapie
weltweit notwendig, die eigene therapeutische Arbeit Supervisoren und evtl,
auch anderen Ausbildungsteilnehmern sichtbar zu machen - sei es durch Tonbandaufnahmen,
Transkripte, Filme und/oder Live-Supervision (s. von Sydow et al., 2007).
Hier ist die Familientherapie und Systemische Therapie seit Jahrzehnten
sehr viel transparenter als andere Psychotherapieansätze (auch wenn
sich das langsam in anderen Therapieverfahren wie der Verhaltenstherapie
ebenfalls durchsetzt).
Wenn Sie beobachten, wie eine erfahrene Therapeutin
oder ein erfahrener Therapeut systemische Therapiegespräche mit Einzelpersonen,
Paaren und Familien durchführt, können Sie mehr darüber
lernen, »how to do it«, als wenn Sie nur lesen oder hören,
wie Systemische Therapien theoretisch durchgeführt werden soll. Darüber
hinaus liefern Therapievideos ausgezeichnetes Material für Diskussionen
und die kritische Reflexion im Rahmen von Seminar- oder Intervisionsgruppen.
Und vielleicht geht es auch darum, zu erkennen, dass selbst sehr erfahrene
Experten nicht immer perfekt sind - und dass es in der Systemischen Therapie
(und der Psychotherapie generell) nicht um Perfektion geht, sondern um
fehlerfreundliches Arbeiten von »hinreichend guten« Therapeuten
(hier paraphrasieren wir Winnicott, der von der »hinreichend guten
Mutter« spricht).
Was wird gezeigt? Die vorliegenden zwei DVDs verfolgen
das Ziel, einen möglichst repräsentativen und umfassenden Querschnitt
wichtiger Interventionen der Systemischen Therapie darzustellen: Die Arbeit
in unterschiedlichen Settings (Einzel-, Paar- und Familientherapie), unterschiedlichen
Lebensphasen (vom Jugendalter bis zum höheren Alter), unterschiedlichen
Phasen der Therapie (Therapiebeginn, spätere Sitzungen und Abschluss),
mit unterschiedlichen Störungsbildern (u.a. Depressionen, Essstörungen,
Substanzkonsumstörungen, somatische Störungen) und Problemlagen
(u. a. Partnerschaftsprobleme in Zusammenhang mit Außenbeziehungen;
Arbeitsplatzprobleme; Probleme in Patchworkfamilien; Probleme mit schweren
Erkrankungen, Sterben und Tod), unterschiedlichen Interventionen, schwierigen
therapeutischen Konstellationen sowie »klassischen« und modernen
manualisierten Interventionsansätzen.
Auf der ersten DVD werden grundlegende Aspekte der Systemischen Therapie
veranschaulicht: Erstgespräche mit Einzelpersonen und Paaren, das
für die Systemische Therapie besonders zentrale Verfahren »Genogramm«
und die Arbeit in wechselnden Settings (Familien-, Einzel- und Paartherapie)
sowie das störungsspezifische systemische Vorgehen bei Depressionen,
Essstörungen und Burnout/Arbeitsstörungen. Die zweite DVD zeigt
das Vorgehen bei spezifischen Problemlagen wie Konflikten in Patchworkfamilien,
dem Umgang mit schweren Erkrankungen, Sterben und dem Tod sowie die Arbeit
mit älteren Klienten. Die DVD wird abgeschlossen mit einem Einblick
in zwei moderne forschungsbasierte, manualisierte, systemisch-integrative
Ansätze, nämlich die Emotionsfokussierte Paartherapie (EFT) und
die Multidimensionale Familientherapie (MDFT).
Wie sind die Interventionen eingebettet? Als Lektüre
zu den Lehrvideos bietet sich das ebenfalls von uns herausgegebene Lehrbuch
»Systemische Therapie in der Praxis« an (von Sydow & Borst,
2018). Jedes Video der vorliegenden DVDs steht in direktem Bezug zu einem
Buchkapitel.
Was war uns bei Konzeption und Durchführung wichtig?
Zwei Aspekten haben wir besondere Bedeutung beigemessen:
- »State-of-the-Art«-Therapeutenverhalten. Das Beziehungsverhalten sollte so gestaltet sein, dass eine authentische Arbeitsatmosphäre [>4] entsteht. Auch sollten bewährte (und evidenzbasierte) Interventionen eingesetzt und angewandt werden. Beides ist selbstverständlich abhängig von der Persönlichkeit und dem Stil der jeweiligen Therapeuten, dem Setting, der jeweiligen Problematik sowie den interaktionellen Eigenheiten der dargestellten Patienten. Insofern wird hier kein »perfektes und ultimatives« Therapievorbild gegeben, sondern ein - hoffentlich! - stimmiger und prägnanter, von therapeutischer Expertise in Theorie und klinischer Praxis geprägter Eindruck. Dies ist unserer Auffassung nach den Therapeutinnen und Therapeuten, die in den hier demonstrierten Bereichen alle ausgewiesene Experten sind, sehr gut gelungen.
- Realistisches Patientenverhalten. Echte Therapievideos, auf denen reale Patienten zu sehen sind, sind aus patienten- und datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt. Es ist aber möglich, realistische Therapiesituationen, die auf realen Fällen beruhen, im Rollenspiel so zu entwickeln, dass sie der klinischen Praxis sehr nahe kommen. Aufseiten der Schauspielpatienten gehören dazu neben darstellerischem Geschick und der Fähigkeit, sich auf so ein Rollenspiel (ohne detailliertes Drehbuch) authentisch einlassen zu können, auch die Kompetenz, Patienten und ihre Probleme und Ressourcen realistisch darstellen zu können. Auch dies ist unserer Auffassung nach hier ausgezeichnet gelungen - daher unser herzlicher Dank auch an die Darstellerinnen und Darsteller (die teilweise ausgebildete Schauspielerinnen mit Erfahrung in der Darstellung von Patientenfällen, teilweise selbst systemische Therapeuten und Therapeutinnen, teilweise in beider Hinsicht Laien sind)!
Aus beiden Punkten folgt, dass die Videos eine gewisse Länge benötigen, um realistisch sein zu können. Gleichzeitig war das Ziel, das Wichtigste sehr knapp und konzentriert darzustellen. Wir hoffen, hier einen guten Mittelweg zwischen »Authentizität« und »didaktischer Straffung« gefunden zu haben.
Warum gibt es Untertitel? In den Untertiteln, die sich ausblenden lassen, wird das therapeutische Vorgehen kommentiert, indem beschrieben wird, was gerade passiert (auch unter Nutzung der entsprechenden Fachtermini) oder warum der Therapeut sich gerade entsprechend verhält. Damit soll die Anwendung der systemischen Konzepte noch klarer verdeutlicht werden. Durch das Ausblenden der Untertitel haben Sie jedoch auch die Möglichkeit, das Vorgehen ohne diese Kommentare auf sich wirken zu lassen, was didaktisch ebenfalls wertvoll sein kann."
Es folgen detaillierte Beschreibungen der zwei DVD-Inhalte.
Bewertung: Ein monumentales Werk (1063 Seiten und DVD-Beiheft), das fast alle Aspekte der Psychotherapie abdeckt. Das Buch ist didaktisch sehr gut strukturiert (Detailliertes Inhaltsverzeichnis, Beispiele, Übersichten, Definitionen, farbig unterlegte Hervorhebungkästen, FAQs, "!", Tabellen, Editorials).
Die beiden im Beiheft erläuterten und kommentierten DVDs sind zum Verständnis des systemischen Handelns sehr wichtig und hilfreich, wenn ich auch manchmal suchen musste, das spezifisch Systemische zu erkennen. So gesehen macht das DVD-Angebot das Lehrbuch erst lebendig und vollständig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.
Im letzten Abschnitt wird erfreulich deutlich, dass es einer integrativen, schulen- und methodenübergreifenden Psychotherapie bedarf:
- "91.2 Die Ziele der Integrativen Systemischen Therapie
Die Integrative Systemische Therapie (IST; Pinsof et al., 2017) bietet eine psychotherapeutische Metaperspektive, die es Therapeuten ermöglicht, spezifische psychotherapeutische Modelle gleichzeitig zu überwinden und auf sie zuzugreifen, und der die therapeutische Praxis in einem multisystemischen (»systemischen«) Kontext verortet. (Anm. der Herausgeberinnen: Der Begriff »psychotherapeutisches Modell« ist in diesem Zusammenhang und angepasst auf die deutschen Verhältnisse am ehesten als »Psychotherapieverfahren« zu verstehen.)
Das erste Ziel. Die Integrative Systemische Therapie zielt auf eine Überwindung spezifischer Modelle der Psychotherapie ab. Es ist abgeleitet aus der Annahme, dass diese spezifischen Modelle von den Prägungen, Vorannahmen, Vorlieben und Fokussen ihrer Entwickler geprägt sind, aus denen sich eine bestimmte Sprache entwickelt, in der das Feld der Psychotherapie beschrieben wird. So kommt es, dass verschiedene Modelle häufig und unvermeidlich ähnliche Aspekte der psychotherapeutischen Landschaft in ihrer eigenen Sprache beschreiben, dabei aber die Landschaftsbeschreibungen anderer Ansätze ignorieren oder entwerten. Beispiele dafür sind das psychoanalytische Konzept der »Übertragung«, was Verhaltenstherapeuten als »Übungstransfer« oder Generalisierung bezeichnen; das verhaltenstherapeutische Konzept der »Exposition«, was Familientherapeuten und Emotionsfokussierte Therapeuten »Konfrontation« nennen und Gestalttherapeuten »sich seinen katastrophisierenden Erwartungen stellen«; und schließlich das Konzept der »Achtsamkeit«, was über Jahre buddhistischer Praxis noch »Meditation« hieß. Es ist an der Zeit, dass das Feld der Psychotherapie eine reife klinische Wissenschaft wird, die das Sammelsurium und das Sprachgewirr überwindet, die aus dem Wuchern einzelner Psychotherapiemodelle[>964] erwachsen sind und in Richtung eines umfassenden und leitlinieninformierten Rahmens bewegt, in dem benannte und noch nicht benannte Strategien und Techniken zum Einsatz kommen." (S. 963).
So ist es.
Autor(Innen), HerausgeberInnen:
Frau Professor Kirsten von Sydow ist an der Psychologischen Hochschule
in Berlin beschäftigt und führt eine eigene Praxis in Hamburg.
Frau Dr. Ulrike Borst ist Leiterin des Ausbildungsinstituts für
Systemische Therapie und Beratung in Meilen (Schweiz).
Das Autorenregister S. 1046-1049, der Mitwirkenden an dem Buch umfasst
71 Namen.
Links (Auswahl: beachte)
- Informationen über Bücher, Bibliotheken, bibliographische Quellen.
- Homepage Systemische Gesellschaft.
- Die sozialrechtliche Anerkennung durch den gemeinsamen Bundesausschauss 2018.
- Das Gutachten des wissenschaftlichen Beirats zur Anerkennung 2008.
Literatur (Auswahl) Das Buch enthält
eine umfangreiche Literliste: S. 984-1043.
Anmerkungen und Endnoten
___
Bewertung. Bewertungen sind immer subjektiv, daher sind wir in unseren Buchpräsentationen bemüht, möglichst viel durch die AutorInnen selbst sagen zu lassen. Die Kombination Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassungen sollte jede kundige oder auch interessierte LeserIn in die Lage versetzen selbst festzustellen, ob sie dieses oder jenes genauer wissen will. Prinzipiell ist die IP-GIPT nicht kommerziell ausgerichtet, verlangt und erhält für Buchpräsentationen auch kein Honorar. Meist dürften aber die BuchpräsentatorInnen ein kostenfreies sog. Rezensionsexemplar erhalten. Die BuchpräsentatorIn steht gewöhnlich in keiner Geschäftsbeziehung zu Verlag oder den AutorInnen; falls doch. so wird dies ausdrücklich vermerkt: Geschäftsbeziehungen. Die IP-GIPT gewinnt durch gute Buchpräsentationen an inhaltlicher Bedeutung und Aufmerksamkeit und für die PräsentatorInnen sind solche Darstellungen auch eine Art Fortbildung - so gesehen haben natürlich alle etwas davon, am meisten, wie wir hoffen InteressentInnen und LeserInnen.
___
Geschäftsbeziehungen.
Keine Geschäftsbeziehung mit dem Beltz-Verlag oder den HerausgeberInnen und AutorInnen. Kein Honorar, aber das Werk und die DVDs wurden kostenlos zur Verfügung gestellt.
___
Anm. Vorgesehene. Wir präsentieren auch Bücher aus eigenem Bestand, weil wir sie selbst erworben haben oder Verlage sie aus verschiedenen Gründen nicht (mehr) zur Verfügung stellen wollen oder können.
__
Sozialrechtliche Anerkennung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) am 22.11.2018
"Bewertungsverfahren der systemischen Therapie
Die systemische Therapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren, dessen Fokus auf dem sozialen Kontext psychischer Störungen liegt. In die Therapie einbezogen werden Mitglieder des für die Patientin oder den Patienten bedeutsamen sozialen Systems, beispielsweise der Familie (vgl. Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie: Gutachten zur wissenschaftlichen Anerkennung der Systemischen Therapie, 14.12.2008).
Im April 2013 hat der G-BA eine umfassende methodische Bewertung der systemischen Therapie als Psychotherapie-Verfahren bei Erwachsenen auf den Weg gebracht. Bewertet wird das Verfahren zu allen 14 in der Psychotherapie-Richtlinie genannten Anwendungsbereichen, darunter affektive Störungen, Angst- und Zwangsstörungen, somatoforme Störungen, Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensstörungen sowie psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen oder durch Opioide.
In seinem Beschluss vom 22. November 2018 hat der G-BA den Nutzen und die medizinische Notwendigkeit der systemischen Therapie bei Erwachsenen als Psychotherapieverfahren anerkannt. Der Unterausschuss Psychotherapie wurde beauftragt, in einem weiteren Schritt die Psychotherapie-Richtlinie des G-BA anzupassen."
Quelle: [https://www.g-ba.de/institution/themenschwerpunkte/psychotherapie/systemische-therapie/]
Standort: Systemische Therapie in der Praxis.
*
Sydow, Kirsten von (2015) Systemische Therapie München: Reinhardt.
Buch-Präsentationen, Literaturhinweise und Literaturlisten in der IP-GIPT. Überblick und Dokumentation.
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site: www.sgipt.org
Buchpräsentation site: www.sgipt.org. |
Information für Dienstleistungs-Interessierte.
*
Zitierung
Sponsel, Rudolf (DAS). Buchpräsentation Systemische Therapie in der Praxis. Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT.Erlangen: https://www.sgipt.org/lit/Beltz/STidP.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen. Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden. Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht, sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
kontrolliert: irs10.02.2019
Änderungen Kleinere Änderungen werden nicht extra ausgewiesen; wird gelegentlich überarbeitet und ergänzt.
14.02.19 Ins Netz gestellt.
11.02.19 zum internen Abruf
10.02.19 Präsentationskonzept.
09.02.19 Angelegt.