Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT DAS=18.06.2002
Impressum: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel
Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
__ __Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Ökopsychosomatik
Umweltbelastungen und psychovegetative Beschwerden
von Sigrun Preuss
Buchhinweis mit Leseproben
und Inhaltsverzeichnis von Rudolf Sponsel,
Erlangen
Erstausgabe 18.6.2002, Letztes Update TT.MM.JJ
Quervweis: Überblick
Umweltpsychologie
 |
Bewertung:
Ein ausgezeichnetes interdisziplinäres und integratives Buch mit vielen wichtigen und grundlegenden Informationen, praktischen Check- und Zuordnungs- Listen, Test- und Prüffragen (zu Schadstoffen, Umweltbelastungen, Symptomen und Störungsbildern) und ersten Konzepten zu psychologischen Behandlungsansätzen in der Ökopsychosomatik mit einem ausführlichen Literaturverzeichnis. |
Preuss, Sigrun (1995). Ökopsychosomatik Umweltbelastungen und psychovegetative Beschwerden. Heidelberg: Asanger. [150 Seiten].
Inhaltsverzeichnis
1. Umwelt und Gesundheit 11
1.1 Begriffsbestimmung: Ökopsychosomatik 12
1.2 Typische Beschwerden in der Ökopsychosomatik
15
1.3 Ökopsychosomatische Beschwerden: Belästigung
oder Krankheitswert? 20
1.4 Erklärungsmodelle der Ökopsychosomatik
24
1.5 Das Zuschreibungsproblem 27
2. Schadstoffe und ihr Beschwerdenpotential 33
2.1 Multiple Chemische Sensitivität 34
2.2 Schadstoffe in der Atemluft 35
2.2.1 Das Chlorkohlenwasserstoff-Syndrom 35
2.2.2 Formaldehyd 37
2.2.3 Abgase 38
2.2.4 Kohlenwasserstoffe: Benzine, Benzol, Dieselkraftstoff
39
2.2.5 Wechselwirkungen 40
2.2.6 Zusammenfassung: Psychovegetative Beschwerden
durch Schadstoffe in der Atemluft 40
2.3 Schadstoffe in Nahrung und Zahnfüllungen (Amalgam)
42
2.3.1 Metalle: Blei, Quecksilber, Palladium, Arsen 42
2.3.2 Pestizide 45
2.3.3 Dioxine und Furane 46
2.3.4 Wechselwirkungen 47
2.3.5 Zusammenfassung: Psychovegetative Beschwerden durch
Schadstoffe in Nahrung und Zahnfüllungen 47
3. Belastungsquelle Lärm 49
3.1 Grundbegriffe 49
3.2 Das Ausmaß von Schallbelastungen 51
3.3 Wirkungen von Beschallung 53
3.4 Wechselwirkungen 58
3.5 Zusammenfassung: Psychovegetative Beschwerden bei
Schallbelastungen 59
4. Elektrizität und ihre gesundheitlichen Auswirkungen
61
4.1 Grundbegriffe 61
4.2 Elektrische und elektromagnetische Feldbelastungen
62
4.3 Wirkungen von elektromagnetischen Feldern 64
4.4 Wechselwirkungen 69
4.5 Zusammenfassung: Psychovegetative Beschwerden bei
elektromagnetischer Belastung 70
5. Bauliche Gestaltung und ihre Einflüsse auf
die Befindlichkeit 71
5.1 Wirkungsfeld Innenraum 72
5.1.1 Das Sick-Building-Syndrom 72
5.1.2 Architektur des Innenraumes 75
5.1.3 Bauformen 78
5.2 Wirkungsfeld Außenraum 79
5.2.1 Lokale Identifikation 80
5.2.2 Gestaltung des Außenraumes 81
5.2.3 Territoriale Strukturierung 82
5.2.4 Ausstattung des Wohnumfeldes 83
5.2.5 Trennung von Wohnung und Arbeitsplatz 84
5.3 Zusammenfassung: Psychovegetative Beschwerden durch
bauliche Gestaltung 85
6. Wissen und Vermutungen über Umweltbelastungen
als Noxe 87
6.1 Reaktionen auf potentielle Umweltbelastungen 87
6.2 Reaktionen auf vermutete Umweltbelastungen: Der Toxikopie-Mechanismus
90
6.3 Reaktionen auf erfolgte Umweltbelastungen: Die traumatische
Neurose 94
6.4 Zusammenfassung: Psychovegetative Beschwerden bei
erlebensbedingter Belastung 97
7. Überblick: Psychovegetative Beschwerden
8. Leitfaden für die umweltpsychologische Anamnese
119
8.1 Ein diagnostisches Fallbeispiel 120
8.2 Durchführung der umweltpsychologischen Anamnese
123
8.2.1 Die Einleitungsphase 124
8.2.2 Fragen nach Schadstoffbelastungen 128
8.2.3 Fragen nach Schallbelastungen 131
8.2.4 Fragen nach elektromagnetischen Belastungen 132
8.2.5 Fragen nach baubedingten Belastungen 133
8.2.6 Fragen nach erlebensbedingten Umweltbelastungen
134
9. Psychologische Behandlungsansätze in der Ökopsychosomatik:
Hypothesen und erste Erfahrungen 135
9.1 Unspezifische Behandlungsansätze 136
9.2 Spezifische Behandlungsansätze 138
Literatur 143
"'Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Umwelt, die ein höchstmögliches Maß an Gesundheit und Wohlbefinden ermöglicht.' Dieser Satz mag als Kernstück der Europäischen Charta Umwelt und Gesundheit gelten, die auf der ersten Europäischen Konferenz „Umwelt und Gesundheit" 1989 in Frankfurt/Main zur Verabschiedung kam (vgl. Gritz 1991). Hier wird auf internationaler Ebene die Bedeutung der Umweltbedingungen als Voraussetzung für Gesundheit und Lebensqualität anerkannt.
Andernorts ist diese enge Verflechtung sogar juristisch festgegelegt: Das Bundes-Immissionsschutzgesetz von 1990 hat laut § 1 den Zweck, den Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu bewahren (BImSchG, 1994). Ähnliche Festschreibungen geben die Gewerbeordnung und die Baunutzungsordnung.
Die Wirkung von Umweltfaktoren auf die menschliche Gesundheit wurde bis dahin überwiegend aus dem Blickwinkel eines somatischen Krankheitsmodells behandelt. Es betonte physikalische und toxikologische Wirkungszusammenhänge. Auf der Grundlage dieses Ansatzes entstanden Grenzwerte für zahlreiche Stoffe, die in der Aufstellung der Maximalen Arbeitsplatzkonzentration, dem MAK-Wert, und der Maximalen Immissionskonzentration, dem MIK-Wert, ihre Verankerung fanden.
Allerdings vernachlässigte diese biomedizinische Sichtweise weitgehend die psychosozialen Aspekte. Die Europäische Charta Umwelt und Gesundheit von 1989 markiert eine Wende. Hier wird der Schutz des Menschen vor Gesundheitsschäden auch auf gesellschaftliche und sozioökonomische Faktoren erweitert.
Während sich das Hauptinteresse bis dahin auf die organmedizinischen Indikatoren von Gesundheit und Krankheit konzentriert hatte, verstärkt sich nun die Aufmerksamkeit für die psychischen Auswirkungen von Umweltbelastungen. Im Überschneidungsbereich von körperlichen und seelischen Störungen eröffnet sich das weite Spektrum umweltbedingter psychovegetativer Beschwerden. Als eine neue Teildisziplin der Klinischen Psychologie entwickelt sich das Feld der Ökopsychosomatik. [>12]
1.1 Begriffsbestimmung: Ökopsychosomatik
Von Psychosomatik wird in den verschiedensten Zusammenhängen gesprochen. Je nach theoretischem Hintergrund verbergen sich hinter diesem Begriff divergierende Auffassungen; es ist eine Bezeichnung mit unklarem Profil (vgl. Franke 1981, v.Uexküll 1990).
Das Psychologische Wörterbuch (Dorsch 1982, S. 539) führt dazu systematisierend aus: „Psychosomatik bezeichnet unterschiedlich: (a) Eine begrenzte Anzahl von Krankheiten, die gleichzeitig Funktionsstörungen und somatische Befunde aufweisen ... (b) Eine Art ganzheitliche medizinische Philosophie, wonach Krankheit durch die Beziehung zwischendem Individuum und seiner Umwelt entsteht, wobei nach verschiedenen Schulen den psychoanalytisch aufdeckbaren Verarbeitungsmechanismen und/oder den lerntheoretisch analysierbaren und durch Umweltfaktoren bedingten Lernprozessen des Individuums besondere Bedeutung zukommt ... (c) Eine erweiterte Interpretation von (b), die das Gewicht auf die ökologischen und sozialökonomischen Faktoren der Gesellschaftsordnung als Auslöser psychosomatischer Erkrankungen legt." Der Begriff Ökopsychosomatik bedeutet die Explikation eines Segments dieser dritten Sichtweise. Gemeint sind hierdie Einwirkungen der Umweltbedingungen auf den Menschen in seiner Ganzheit. Aus diesen Umwelteinflüssen ist für die Frage nach einem Krankheitsgeschehen wiederum der Ausschnitt der gesundheitsgefährdenden Einwirkungen relevant.
Im Gegensatz zu verschiedenen anderen Autoren (vgl. Bräutigam & Christian 1986, v. Uexküll 1990) soll der Begriff 'psychosomatisch' an dieser Stelle nicht als gleichbedeutend mit psychogenetisch, also durch psychische Vorgänge verursacht, aufgefaßt werden. Stattdessen wird er im ursprünglichen Wortsinn in Anlehnung an Delius & Fahrenberg (1966, S.6) „im Sinne einheitlicher, integrativer Auffassung der drei Seinsweisen des Befindens, des Verhaltens und der somatischen Organisation" verstanden. Dies entspricht auch der Sichtweise von Alexander (1971, S.32): 'Psychologische und somatische Phänomene finden in demselben Organismus statt und sind nur zwei Seiten des gleichen Vorganges'.
Das hier formulierte Verständnis von der Ökopsychosomatik beinhaltet eine wesentliche Unterscheidung zur Auffassung der Umwelt-Psychosomatik, wie sie von Küchenhoff (1994) formuliert wurde. Er sieht als [>13] Aufgabengebiet der Psychosomatik den Ausschnitt von Erkrankungen, der seelisch bedingt ist. Dementsprechend konzentriert er sich in seiner 'Psychopathologie der Umwelt' auf 'die seelisch krankmachenden Umweltfaktoren, die Bedeutung der Umwelt für die Verarbeitung von Krankheiten und ... die Widerspiegelung ökologischer Belastungen bzw. die Antwort auf ökologische Belastungen in psychischen Krankheiten' (Küchenhoff 1994, S. 4). Hier liegt der Schwerpunkt der Betrachtung auf der psychischen Verarbeitung und Bewältigung von Umweltbelastungen und den dabei entstehenden Erkrankungen. Als entscheidend werden hier also die vermittelnden psychischen Prozesse zwischen der Umweltbelastung und ihrer Auswirkung gesehen. Gelingt diepsychische Bewältigung von Umweltbelastungen nicht oder nur unzureichend, ergeben sich Beschwerden, die Küchenhoff (1994) dem Krankheitsbild der traumatischen Neurosen zurechnet. Beschwerden, die durch die Exposition selbst direkt ausgelöst werden, finden bei seiner Auffassung kaum Berücksichtigung.
Demgegenüber gibt das hier vorgestellte Modell derÖkopsychosomatik beiden Wirkungspfaden einen Stellenwert (vgl. Abb. 1.1). Es integriert in einer ganzheitlichen Organismusreaktion sowohl die Beschwerden, die durch die Umweltbelastung direkt erfolgen, als auch die Störungen, die ein Produkt der vermittelnden psychischen Prozesse sind.
In diesem Kontext ergeben sich zwei Möglichkeiten der Belastung (vgl.Preuss 1996, inVorbereitung): DieBelastungersterArtbeziehtsich auf die schadstoffbedingten Auswirkungen, die als Noxe eine psychophysiologische Reaktion im Organismus bewirken. Diese Effekte können als unmittelbar bezeichnet werden. Sie entstehen aus den tatsächlichen Immissionen auf den Menschen, unabhängig davon, ob ihr Wirkmechanismus bewußt erfaßt wird oder nicht. Ihre gesundheitlichen Folgen äußern sich sowohl im somatischen als auch im psychischen Bereich. Zu den Umweltbelastungen in diesem Sinne gehören Schadstoffe in Nahrung und Atemluft (vgl. Kapitel 2), Lärm (vgl. Kapitel 3), elektromagnetische Felder (vgl. Kapitel 4), aber auch die baulichen Gestaltungen unsererLebenswelt(vgl. Kapitel 5). Bei all diesen Umwelteinflüssen ist bekannt, daß unter bestimmten Expositionsbedingungen mit körperlichen und psychischen Beschwerden zu rechnen ist, auch wenn die einzelnen Dosis-Wirkungs-Zusammenhänge bisher noch nicht bei allen Immissionen bis ins Detail geklärt sind. [>14]
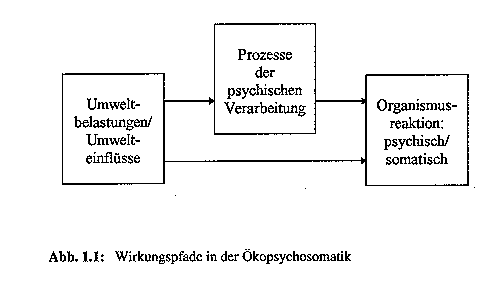
Die Belastung zweiter Art betrifft
die erlebensbedingten Auswirkungen von Umweltbelastungen. Derartige Effekte
sind als mittelbar zu betrachten. Sie lassen sich nicht einem spezifischen
Schadstoff und einem konkreten Dosis- Wirkungs- Zusammenhang zuordnen.
Die entscheidende Einflußgröße entsteht hier durch die
Prozesse der psychischen Verarbeitung, die moderierend in den direkten
Zusammenhang der Belastung erster Art eingreifen. Die vermittelnden psychischen
Prozesse können sich sowohl auf Sachverhalte mit Schädigungspotential
als auch auf
Sachverhalte ohne Schädigungspotential beziehen.
Es ist also denkbar, daß gegebene problematische Umwelteinflüsse
wie beispielsweise Schadstoffbelastungen aufgegriffen und durch entsprechende
interne Bewertungen über- oderunterschätzt werden, so daß
es entweder zu einer Katastrophisierung oder zum Ignorieren der Gefahr
kommt. Ebenso können unschädliche Umwelteinflüsse in falscher
Interpretation zur Noxe werden, indem sie - in diesem Fall unangemessene
- Sorgen und Ängste provozieren. Von zentraler Bedeutung ist die Attribution
der Phänomene.
In jedem Fall handelt es sich bei der Belastung zweiter Art um generalisierende Reaktionen auf wahrgenommene Umwelteinflüsse. Ihre Entstehung entspringt persönlichen Erfahrungen, Perzeptionen, Annahmen und Vermutungen über die Belastung erster Art. Hierher gehören nicht nur fundierte Kenntnisse und Kognitionen, sondern auch [>15] Phantasien und Befürchtungen über bereits erfolgte, gegenwärtig aktuelle oder zukünftige Expositionen, die real oder auch nur potentiell sein können. Damit bedeutet die Belastung zweiter Art in jedem Fall eine erhebliche Streßbelastung mit den entsprechenden Parametern. Sie muß folglich als längerfristig gesundheitsgefährdender Faktorgelten, dereine Reihe von psychovegetativen Beschwerden auszulösen vermag. Das Individuum wird geschwächt, und gleichzeitig wächst im Sinne eines Promotors die allgemeine Anfälligkeit für manifeste Erkrankungen, aber auch für schadstoffbedingte Beschwerden.
Beide Arten der Belastung können
einzeln wirksam werden oder aber eine Kombinationswirkung entfalten. Einerseits
ereignen sich gesundheitliche Auswirkungen von Umweltbelastungen unabhängig
von Wahrnehmung und Wissen der Betroffenen. Dies gilt besonders angesichts
der hochgradigen Nicht-Erfahrbarkeit zahlreicher Umwelteinflüsse auf
den Organismus (vgl. Preuss 1991). Andererseits vermag allein die Annahme
einer Belastung ohne reale Grundlage, beispielsweise aufgrund einer Falschinformation,
erhebliche Beschwerden zu evozieren. Dieser Wirkungspfad wird in Kapitel
6 ausführlicher untersucht. Die Folgen aus der Belastung erster und
zweiter Art können zusammentreffen und einen synergetischen Effekt
hervorrufen. Schadstoffbedingte und erlebensbedingte Störungen werden
sich in diesem Fall ergänzen und gegenseitig steigern. Additive und
überadditive Auswirkungen sind denkbar."
Sponsel, Rudolf (DAS). Buchhinweis: Ökopsychosomatik. Umweltbelastungen und psychovegetative Beschwerden (Sigrun Preuss). IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/psysom/oeko-ps.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle benutzt werden. Sofern die Rechte anderer berührt sind, müssen diese dort erfragt werden. In Streitfällen gilt der Gerichtsstand Erlangen als akzeptiert.
__ __Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen