(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=01.01.2023 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung: tt.mm.jj
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Erleben und Erlebnis bei Kandinsky und im Blauen Reiter _Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Erleben und Erlebnis bei Kandinsky und im Blauen Reiter
Über das Geistige in der Kunst.
Der blaue Reiter (mit Franz Marc).
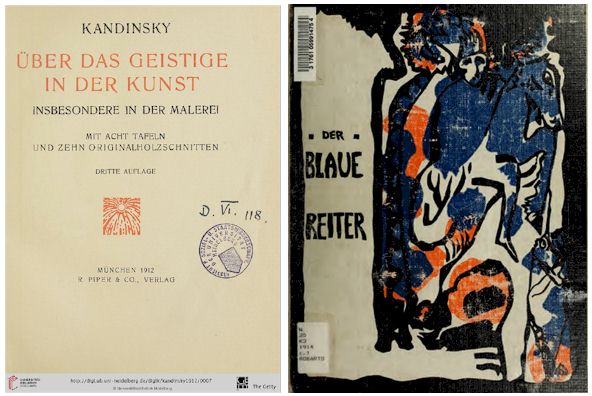
Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen
Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung *
Editorial
Die Kunst ist eine wichtige Quelle für besonderes Erleben: eben das künstlerische Erleben (> Metzger) und ein schönes Beispiel dafür, dass wir für das meiste, was wir erleben, gar keine Worte haben. Eine wirklich fundierte gesprochene und geschriebene Sprache für das Erleben, muss erst noch entwickelt werden - falls das überhaupt geht. Hierbei muss natürlich die Kunst (Architektur, Kunmtshandwerk, Bildende K., Darstellende K., Musik, Theater, Film, ..) besondere Berücksichtigung finden.
Über das Geistige in der Kunst (1912, 3.A) [Online]

Zusamenfassung
Kandinsky Über das Geistige in der Kunst
Kandinsky gebraucht die Worte erleben, erlebt, Erlebnis (Fundstellen:
erleb 8, erleben 2, erlebt(e,en,es) 1, Erlebnis 5. ), aber er erklärt
sie nicht, sondern setzt sie - wie viele andere, selbst Wissenschaftler,
auch - als allgemeinverständlich und nicht näher begründungsbedürftig
voraus.
_______
Fundstellen im Textkontext
Gesperrt bei Kandinsky hier fett.
4f: "Dieser wichtige innere Berührungspunkt ist aber bei seiner
ganzen
Wichtigkeit doch nur ein Punkt. Unsere Seele, die nach der langen
materialistischen Periode erst im Anfang des Erwachens ist, birgt
in sich Keime der Verzweiflung des Nichtglaubens, des Ziel- und
Zwecklosen. Der ganze Alpdruck der materialistischen Anschauungen,
welche aus dem Leben des Weltalls ein böses zweckloses Spiel gemacht
haben, ist noch nicht vorbei. Die erwachende Seele ist noch stark unter
dem Eindruck dieses Alpdruckes. Nur ein schwaches Licht dämmert
wie ein winziges Pünktchen in einem enormen Kreis des Schwarzen.
Dieses schwache Licht ist bloß eine Ahnung, welches zu sehen
die [>5]
Seele keinen vollen Mut hat, im Zweifel, ob nicht dieses Licht — der
Traum ist, und der Kreis des Schwarzen — die Wirklichkeit. Dieser
Zweifel und die noch drückenden Leiden der materialistischen Philosophie
unterscheiden stark unsere Seele von der der „Primitiven“.
In unserer Seele ist ein Sprung und sie klingt, wenn man es erreicht
sie zu berühren, wie eine kostbare in den Tiefen der Erde wiedergefundene
Vase, die einen Sprung hat. Deswegen kann der Zug
ins Primitive, wie wir ihn momentan erleben,
in der gegenwärtigen
ziemlich entliehenen Form nur von kurzer Dauer sein."
16: "Wenn weiter dieses „Wie“ auch die Seelenemotion des Künstlers
einschließt und fähig ist, sein feineres Erlebnis auszuströmen,
so stellt
sich schon die Kunst an die Schwelle des Weges, auf welchem sie [>17]
später unfehlbar das verlorne „Was“ wiederfindet, das „Was“, welches
das geistige Brot des jetzt beginnenden geistigen Erwachens bilden
wird.
Dieses „Was“ wird nicht mehr das materielle, gegenständliche „Was“
der hintengebliebenen Periode sein, sondern ein künstlerischer
Inhalt, die Seele der Kunst, ohne welche ihr Körper (das
„Wie“)
nie ein volles gesundes Leben führen kann, ebenso wie der einzelne
Mensch oder ein Volk.
Dieses Was ist der Inhalt, welchen nur die Kunst
in sich fassen
kann, und welchen nur die Kunst zum klaren Ausdruck bringen
kann durch die nur ihr gehörenden Mittel."
32: "Hier fühlt Schönberg genau, daß die größte
Freiheit, welche die
freie und unbedingte Atmungsluft der Kunst ist, nicht absolut sein
kann. Jeder Epoche ist ein eigenes Maß dieser Freiheit
gemessen.
Und über die Grenzen dieser Freiheit vermag die genialste Kraft
nicht zu springen. Aber dieses Maß muß jedenfalls
erschöpft werden
und wird jedesmal erschöpft. Es mag die widerspenstige Karre sich
sträuben wie sie will! Diese Freiheit zu erschöpfen sucht
auch Schönberg,
und auf dem Wege zum innerlich Notwendigen hat er schon
Goldgruben der neuen Schönheit entdeckt. Schönbergsche
Musik
führt uns in ein neues Reich ein, wo die musikalischen
Erlebnisse
keine akustischen sind, sondern rein seelische. Hier beginnt
die
„Zukunftsmusik“.
"
43f: "
WIRKUNG DER FARBE
Wenn man die Augen über eine mit Farben besetzte Palette gleiten
läßt, so entstehen zwei Hauptresultate:
1. es kommt eine rein physische Wirkung zustande,
d. h.
das Auge selbst wird durch Schönheit und andere Eigenschaften
der
Farbe bezaubert. Der Schauende empfindet ein Gefühl von Befriedigung,
Freude, wie ein Gastronom, wenn er einen Leckerbissen im Munde hat.
Oder es wird das Auge gereizt, wie der Gaumen von einer pikanten
Speise. Es wird auch wieder beruhigt oder abgekühlt, wie der Finger,
wenn er Eis berührt. Dies alles sind jedenfalls physische Gefühle,
welche als solche nur von kurzer Dauer sein können. Sie sind auch
oberflächlich und hinterlassen keinen dauernden Eindruck, wenn
die [>44]
Seele geschlossen bleibt. Ebenso wie man bei Berührung von Eis
nur das Gefühl einer physischen Kälte erleben
kann und dieses Gefühl
nach dem Wiedererwärmen des Fingers vergißt, so wird auch
die
physische Wirkung der Farbe vergessen, wenn das Auge abgewendet
wird. Und ebenso, wie das physische Gefühl der Kälte des
Eises, wenn
es tiefer eindringt, andere tiefere Gefühle erweckt und eine ganze
Kette psychischer Erlebnisse bilden
kann, so kann auch der oberflächliche
Eindruck der Farbe sich zu einem Erlebnis
entwickeln."
77 Fußnote: "Diese Vertiefungsgabe finden wir im Blau und ebenso
erst theoretisch
in ihren physischen Bewegungen. 1. vom Menschen weg und 2.
zum eigenen Zentrum. Und ebenso, wenn man das Blau (in jeder gewünschten
geometrischen Form) auf das Gemüt wirken läßt. Die
Neigung des Blau zur Vertiefung ist so groß, daß es gerade
in tieferen
Tönen intensiver wird und charakteristischer innerlich wirkt.
Je tiefer
das Blau wird, desto mehr rust es den Menschen in das Unendliche,
weckt in ihm die Sehnsucht nach Reinem und schließlich Übersinnlichem.
Es ist die Farbe des Himmels, so wie wir ihn uns vorstellen bei dem
Klange des Wortes Himmel.
Blau ist die typisch himmlische FarbeFN77.1).
Sehr tiefgehend
entwickelt das Blau das Element der RuheFN77.2). Zum Schwarzen [>78]
sinkend, bekommt es den Beiklang einer nicht menschlichen TrauerFN78.1.
Es wird eine unendliche Vertiefung in die ernsten Zustände, wo
es
kein Ende gibt und keines geben kann. Ins Helle übergehend, wozu
das Blau auch weniger geeignet ist, wird es von gleichgültigerem
Charakter
und stellt sich zum Menschen weit und indifferent, wie der
hohe hellblaue Himmel. Je heller also, desto klangloser, bis es zur
schweigenden Ruhe übergeht — weiß wird. Musikalisch dargestellt
ist helles Blau einer Flöte ähnlich, das dunkle dem Cello,
immer tiefer
gehend den wunderbaren Klängen der Baßgeige; in tiefer,
feierlicher
Form ist der Klang des Blau dem der tiefen Orgel vergleichbar.
FN77.1 . . . les nymbes . . . sont
dores pour l’empereur et les prophetes (also
für Menschen) et bleu de ciel pour les personnages
symboliques (also für
nur geistig existierende Wesen). (Kondakoff, N. Histoire
de Part bysantin consid.
princip. dans les miniatures. Paris 1886—1891. Vol. II,
p. 38,2.)
FN77.2 Nicht wie Grün — welches,
wie wir später sehen werden, irdische, selbstzufriedene
Ruhe ist — sondern feierliche, überirdische Vertiefung.
Dies ist
buchstäblich zu verstehen: auf dem Wege zu diesem
„über“ liegt das „irdische“,
welches nicht zu vermeiden ist. Alle
Qualen, Fragen, Widersprüche des Irdischen
müssen erlebt werden.
Keiner hat sich ihnen entzogen. Auch hier ist
innere Notwendigkeit, die durch das Äußere
verdeckt wird. Die Erkenntnis
dieser Notwendigkeit ist die Quelle der „Ruhe“. Da uns
aber diese Ruhe
am entferntesten liegt, so können wir uns auch im
Farbenreiche dem Überwiegen
des Blau innerlich schwer nähern."
FN78.1 Auch anders als violett,
wie dieses weiter unten bezeichnet wird.
97f: "Wenn wir schon heute anfangen würden, ganz das Band, das
uns
mit der Natur verknüpft, zu vernichten, mit Gewalt auf die Befreiung
loszusteuern und uns ausschließlich mit der Kombination von reiner
Farbe und unabhängiger Form zu begnügen, so würden wir
Werke
schaffen, die wie eine geometrische Ornamentik aussehen, die, grob
[>98]
gesagt, einer Krawatte, einem Teppich gleichen würden. Die Schönheit
der Farbe und der Form ist (trotz der Behauptung der reinen
Ästheten oder auch der Naturalisten, die hauptsächlich auf
„Schönheit“
zielen) kein genügendes Ziel in der Kunst. Wir sind eben infolge
unseres
elementaren Zustandes in der Malerei sehr wenig fähig, von ganz
emanzipierter
Farben-, Formenkomposition schon heute ein inneres
Erlebnis
zu erhalten. Die Nervenvibration wird freilich vorhanden sein (wie
etwa vor kunstgewerblichen Werken), sie bleibt aber hauptsächlich
im
Bereiche der Nerven stecken, weil sie zu schwache Gemütsvibrationen,
Erschütterungen der Seele hervorrufen wird. Wenn wir aber bedenken,
daß die geistige Wendung ein direkt stürmisches Tempo angeschlagen
hat, daß auch die „festeste“ Basis des menschlichen Geisteslebens,
d. h.
die positive Wissenschaft, mitgerissen wird und vor der Tür der
Auflösung
der Materie steht, so kann behauptet werden, daß nur noch
wenige „Stunden“ uns von dieser reinen Komposition trennen."
Der blaue Reiter [Online]
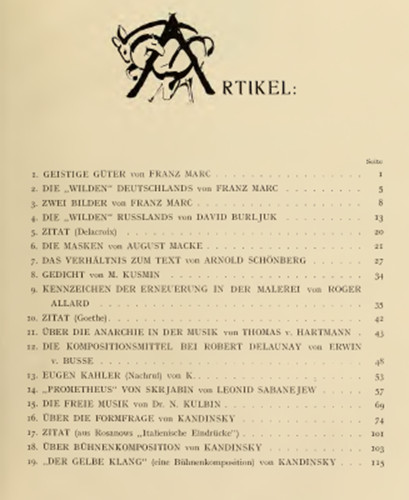
Zusammenfassung-Blauer-Reiter
(1912)
Der "Blaue Reiter" ist ein bemerkenswertes Buch, weil es die verschiedenen
Künste (Bildende Kunst, Musik, Literatur, Theater) zu Worte kommen
lässt, um dem Kunsterleben auf die Spur zu kommen.
Fundstellen
erleben 5 (1 Pseudo Künstlerleben), erlebt(e,en,es) 1 (1 Pseudo
verlebten Schutt, Vorwort Franz Marc), Erlebnis 12.
- Pseudo verlebter Schutt (Vorwort Franz Marc)
14: "DIE„WILDEN" RUSSLANDS
von D. BURLJUK
DerRealismus
verändert sich in Impressionismus. In der Kunstrein realistisch
zu
bleiben, ist undenkbar. Alles in der Kunst ist mehr oder weniger realistisch.
Es ist aber
unmöglich, auf diesem „mehr oder weniger" Prinzipien einer Schule
zu bauen. „Mehr oder
weniger" ist keine Aesthetik. Der Realismusist nur eine Spezies des
Impressionismus.
Der Impressionismusaber, d. h. das Leben durch das Prisma
eines Erlebnisses, ist schon
ein schöpferisches Leben des Lebens. Mein
Erlebnis ist eine Umgestaltung der Welt. Das
Vertiefen in ein Erlebnis bringt
mich zur schöpferischen Vertiefung. Das Schöpfen ist
gleichzeitig das Schöpfen der Erlebnisse
und das Schöpfen der Gestaltungen. Die Schöpfungs-
gesetze sind die einzige Aesthetik des Impressionismus. Und dies ist
zur selben Zeit die
Aesthetik des Symbolismus. „Der Impressionismusist ein oberflächlicher
Symbolismus."
(Andrej Bjely.)FN14.1).
FN14.1 Einer der bekanntestenmodernen„jungen"
Dichter. Red.
"
31f: "Ich war vorein paar Jahren tief beschämt, als ich entdeckte,
dass ich bei einigen
mir wohlbekannten Schubert-Liedern gar keineAhnung davon hatte, was
in dem zu-
grundeliegenden Gedicht eigentlich vorgehe. Als ich aber dann die Gedichte
gelesen
hatte, stellte sich für mich heraus, dass ich dadurch für
das Verständnis dieser Lieder
gar nichts gewonnen hatte, da ich nicht im geringsten durch sie genötigt
war, meine Auf-
fassung des musikalischen Vortrags zu ändern. Im Gegenteil: es
zeigte sich mir, dass ich,
ohne das Gedicht zu kennen, den Inhalt, den wirklichen Inhalt, sogar
vielleicht tiefer er- [>32]
fasst hatte, als wenn ich an der Oberfläche der eigentlichen Wortgedanken
haften ge-
blieben wäre. Noch entscheidender als dieses Erlebnis
war mir die Tatsache, dass ich
viele meiner Lieder, berauscht von dem Anfangsklang der ersten Textworte,
ohne
mich auch nur im geringsten umden weiteren Verlauf der poetischen Vorgänge
zu
kümmern, ja ohne diese im Taumeldes Komponierens auch nur im geringsten
zu er-
fassen, zu Ende geschrieben und erst nach Tagen darauf kam, nachzusehen,
was denn
eigentlich der poetische Inhalt meines Liedes sei. "
35: "DIE KENNZEICHEN DER ERNEUERUNGIN DER MALEREI
von ROGER ALLARD
Die Entfaltung
eines malerischen Stiles mitzuerleben
bis zu seiner Verknöcherung
und seinem Tode, der überdauert wird vondem Pseudostile seiner
Epigonen, bildet
für den Geist die beste Schule, die Gesetzmässigkeit künstlerischer
Evolutionen zu
studieren."
41: "Auch bei den Bildhauern, wie Duchamp-Villon und Alexandre Archipenko,
erleben
wir die Wendungzu den neuen Ideen."
- 54 Pseudo "Künstlerleben"
55: "Eine grosse Zahl tief erlebter Gedichte
wurden nach seinem Tod gefunden, von denen
er [Kahler] nie gesprochen."
57: "PROMETHEUS VON SKRJABIN
von L. SABANEJEW
Es istschwer, bei der Analyse des Skrjabinschen Schaffens die einzelnen
Gestaltungen des-
selben von der allgemeinen Idee, der endgültigen ,,Kunstidee",
die jetzt dem Bewusstsein
des Komponisten vollkommen klar geworden ist, zu trennen. Das ist die
Kunstideeals
ein gewisser mystischer Vorgang, der zum Erreichen eines ekstatischen
Erlebnisses dient
— der Ekstase, dem Sehen in höheren Plänen der Natur. Wir
sehen eine logische Ent-
wicklung dieser Idee von Skrjabins erster Symphonie bis zum Prometheus.
In der ersten
Symphonie — ein Hymnus der Kunst als Religion, in der dritten — die
Befreiung des
Geistes von Ketten, Selbstbehauptung der Persönlichkeit, ein Poem
der Ekstase — Freude
des freien Vorganges, die Schaffensekstase. Diesalles sind verschiedene
Entwicklungs-
stadien einer und derselben Idee, welche die vollkommene Verkörperung
im Skrjabinschen
Mysterium finden soll — in grandiosem Ritualvorgang, inwelchem zum
Zweck des eksta-
tischen Aufschwunges alle Erregungsmittel, alle „Sinnenliebkosungen"
(anfangend mit
Musik bis zum Tanz — mit Lichtspielen und Symphonien von Düften)
ausgenützt werden.
Wenn man tief in das Wesen der mystischen Kunst von Skrjabin eindringt,
wird es klar,
dass man weder Grund noch Recht hat, diese Kunst ausschliesslich mit
Musik abzugrenzen.
Die mystisch-religiöse Kunst, die dem Ausdruck der sämtlichen
geheimen Fähigkeiten
des Menschen, dem Erreichen der Ekstase dient, brauchte immer und von
jeher alle
Mittel zur Wirkung auf die Psyche. "
63f: "Mitihr beginnt das Prometheus-Poem* des schöpferischen Geistes,
welcher, schonfrei
geworden, frei die Welt schafft. Dasist eine Art symphonischen Konspektes
des
Mysteriums, worin die Mitwirkenden gezwungen werden, die ganze Evolution
des schöpfe-[>64]
rischen Geistes mit zu erleben,
wo die Teilung in empfangende, passive und in kunst-
schöpfende Menscheninterpreten fallen wird. Diese Teilungist im
Prometheus noch zu
beobachten: er hat die gewohnte Form einer Symphonie, die von Orchester
und Chor
ausgeführt wird. In einer blaulila Dämmerung erklingt die
mystische Harmonie, bei dem.
Flattern derselben klingt das Hauptthema(i) in den Waldhörnern:
[Noten]"
72: "Diese Musik gibt eine volle Freiheit der Inspiration und besitzt
die schon oben-
genannten Vorzüge der natürlichen Musik: sie kann subjektive
Erlebnisse darstellen und
zugleicher Zeit die Lyrik der Stimmungen undLeidenschaften, sowie Illusionen
der
Naturhervorrufen."
83 Fußnote: "1) DenInhalt des gewohnten Schönen hat der Geist
schon absorbiert und findet keine neue
Nahrung darin. Die Form dieses gewohnten Schönen gibt dem faulen
körperlichen Auge die gewohnten
Genüsse. DieWirkung des Werkes bleibt im Bereiche des Körperlichen
stecken. Das geistige Erlebnis
wird unmöglich. Sobildet oft dieses Schöne eine Kraft, die
nicht zum Geist, sondern vom Geist führt."
89: "Undtatsächlich: wennes eine prinzipielle Frage der Form gäbe,
so würde auch eine
Antwort möglich sein. Und jeder, der diese Antwort kennt, würde
Kunstwerke schaffen
können. D. h. zur selben Zeit würde die Kunst nicht mehr
existieren. Praktisch gesagt:
Die Frage der Form verändert sich in die Frage: welche Form soll
ich in diesem Falle
anwenden, um zum notwendigen Ausdruck meines inneren
Erlebnisses zu gelangen? Die
Antwortist in diesem Falle immer wissenschaftlich präzis, absolut
und für andere Fälle
relativ. D. h. eineForm, die die beste in einem Falle ist, kann in
einem anderen Falle die
schlechteste sein: alles hängt hier von der inneren Notwendigkeit
ab, die allein eine Form
richtig machen kann. Und nur dann kann eine Form eine Bedeutung für
mehrere haben,
wenn die innere Notwendigkeit unter dem Druck der Zeit und des Raumes
einzelne Formen
wählt, die miteinander verwandt sind. Dieses ändert aber
an der relativen Bedeutung
der Form gar nichts, da die auch in diesem Falle richtige Form in vielen
anderen Fällen
falsch sein kann."
90: "Daspraktische Resultat: man darf nie einem Theoretiker (Kunst-
historiker, Kritiker etc.) glauben, wenn er behauptet, dass er
irgendeinen objektiven Fehler im Werke entdeckt hat.
Und: das Einzige, wasder Theoretiker mit
Recht behaupten kann, ist das,
dasser bis jetzt diese oder jene Anwendung des Mittels noch nicht gekannt
hat. Und: die
Theoretiker, die, vonder Analyse der schon dagewesenen Formen ausgehend,
einWerk
tadeln oder loben, sind die schädlichsten Irreführer, die
zwischen demWerk und dem naiven
Beschauereine Mauer bilden.
Vondiesem Standpunkte aus (welcher leider meistens
der einzig möglicheist) ist
die Kunstkritik der schlimmste Feind der Kunst.
Der ideale Kunstkritiker wäre also nicht
der Kritiker, welcher die
„Fehler"1), "Verirrungen", „Unkenntnisse", „Entlehnungen" usw. usw.
zu entdecken
suchen würde, sondern der, welcher zu fühlen suchen würde,
wie diese oder jene Form
innerlich wirkt und dann sein Gesamterlebnis
dem Publikum ausdrucksvoll mitteilen würde.
Hier würde natürlich der Kritiker eine Dichterseele brauchen,
da der Dichter ob-
jektiv fühlen muss, um subjektiv sein Gefühl zu verkörpern.
D. h. der Kritiker würde
eine schöpferische Kraft besitzen müssen. In Wirklichkeit
sind aberdie Kritiker sehr oft
misslungene Künstler, die am Mangel eigener schöpferischer
Kraft scheitern und deshalb
sich berufen fühlen, die fremde schöpferische Kraft zu lenken."
91: "Hier muss ich präzis sein. Eine fremde Formzu gebrauchen heisst
in der Kritik,
im Publikum und oft bei den Künstlern ein Verbrechen, ein Betrug.
Das ist aber in Wirk-
lichkeit nur dann derFall, wenn der,,Künstler" diese fremden Formen
ohne innere Not-
wendigkeit braucht und dadurch ein lebloses, totes Scheinwerk schafft.
Wennaber der
Künstler zum Ausdruck seiner inneren Regungen
und Erlebnisse sich einer oder der andern
fremden" Formder inneren Wahrheit entsprechend bedient, so übter
sein Recht aus,
sich jeder ihm innerlich nötigen Form zu bedienen — sei es ein
Gebrauchsgegen-
stand, ein Himmelskörper oder eine durch einen andern Künstler
schon künstlerisch
materialisierte Form."
99 "2. Das Aufbauendes seelisch-geistigen Lebens des 20. Jahrhunderts,
welches wir
miterleben und welches sich schon
jetzt in starken, ausdrucksvollen und bestimmten Formen
manifestiert und verkörpert."
112: "Die folgende kleine Bühnen komposition ist ein Versuch, aus
dieser Quelle zu schöpfen.
Essind hier drei Elemente, die zu äusseren Mitteln iminnerenWertedienen:
1. musikalischer Ton und seine Bewegung,
2. körperlich-seelischer Klang und seine Bewegung durch Menschen
und Gegen-
stände ausgedrückt,
3. farbiger Ton undseine Bewegung(eine spezielle Bühnenmöglichkeit).
So besteht hier schliesslich das Drama aus dem Komplex
der inneren Erlebnisse
(Seelenvibrationen) des Zuschauers."
Literatur (Auswahl)
- Kandinsky, Wassily (1893) Über die Gesetzmäßigkeit der Arbeiterlöhne. (Dissertation).
- Kandinsky, Wassily (1911) Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in der Malerei. München: Piper (3. Aufl. 1912). Revidierte Neuauflage, Benteli Verlag, Bern 2004.
- Kandinsky, Wassily & Marc, Franz (1912) Der Blaue Reiter. München: Piper.
- Kandinsky, Wassily (1913) Klänge, mit 12 Farbholzschnitten und 44 Schwarz-Weiß-Holzschnitten. München: Piper
- Kandinsky, Wassily (1926) Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. Bauhausbücher Nr. 9, München 1926. (online).
- Kandinsky, Wassily (2005) Unterricht am Bauhaus. Vorträge, Seminare, Übungen 1923–1933. Hrsg. von Angelika Weißbach. Gebr. Berlin: Mann.
Links(Auswahl: beachte)
- https://archive.org
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
__
Primitive
Kunst der Naturvölker. Der Ausdruck "primitiv" suggeriert Minderwertigkeit und ist daher nicht mehr angemessen. Vor und um die Jahrhunderwende und im frühen 20. Jahrhundert wurde die Kunst der Naturvölker entdeckt. Gauguin wanderte 1891 nach Haiti aus. Einher ging die Entdeckung der der Geisteskranken (Prinzhorn) und die Entwicklung der naiven Malerei (Rousseau)
__
Standort: Erleben und Erlebnis bei Kandinsky und im Blauen Reiter.
*
Überblick Kunst in der IP-GIPT.
Wolfgang Mezger Der Beitrag der Gestalttheorie zur Frage der Grundlage des künstlerischen Erlebens.
Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse
Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis * Zusammenfassung *
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Erleben und Erlebnis bei Kandinsky und im Blauen Reiter. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/Kandinsky.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert:
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
01.01.2023 Angelegt, gesichtet, Fundstellen erfasst, ausgewertet und zusammengefasst.