(ISSN 1430-6972)
IP-GIPTDAS=17.12.2022 Internet-Erstausgabe, letzte Änderung TMJ
Impressum: Diplom-Psychologe Dr. phil. Rudolf Sponsel Stubenlohstr. 20 D-91052 Erlangen
E-Mail: sekretariat@sgipt.org _ Zitierung & Copyright
Anfang_Erleben und Erlebnis in Giselher Guttmanns Einführung in die Neuropsychologie_Datenschutz_Überblick__Rel. Beständiges _Titelblatt_ Konzept_ Archiv_ Region_ English contents__ Service_iec-verlag__Dienstleistungs-Info * _ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen
Erleben und Erlebnis in Giselher
Guttmanns
Einführung in die Neuropsychologie
Originalrecherche von Rudolf Sponsel, Erlangen
Zusammenfassung-Guttmann-Neuropsychologie-3.3.2:
Das Buch Einführung in die Neuropsychologie enthält einen
ganzen Abschnitt "3.3.2 Evoziertes Potential und Erleben".
Nach Guttmanns Stand der Forschung können gleiche Reize unterschiedlich
erlebt und unterschiedliche Reize gleich erlebt werden, so dass man nicht
von einer Entsprechung der Reiz-Erregungs-Gesetze und Reiz-Erlebens-Gesetzen
sprechen kann. Den Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeitszuwendung und Aktionspotential
kann man messen. S. 138: "Garcia-Ausst (1963) konnte zeigen, daß
die Amplituden des akustisch evozierten Potentials bei Aufmerksamkeitszuwendungen
steigen, bei Ablenkung hingegen sinken." Und S. 139: "Sogar «subliminale»
Reizunterschiede, die den Versuchspersonen gar nicht bewußt waren
(ihr Einfluß konnte in anschließenden Assoziationsversuchen
gesichert werden), scheinen imstande zu sein, charakteristische Potentialveränderungen
auszulösen (Shevrin und Fritzler 1968). ... Ein weiteres Ergebnis
zur GG139E4Erlebnisabhängigkeit
des evozierten Poten[>140]tials erbrachte ein Experiment von Chapman
und Bragdon (1964), in dem die Versuchspersonen einfache Aufgaben zu lösen
hatten, wobei optisch dargebotene Ziffern beachtet werden mußten.
Zwischen diesen «sinnvollen» Reizen wurden bedeutungslose Reize
von gleicher Helligkeit und Dauer eingeschaltet. Eine getrennte Analyse
der bedeutsamen und bedeutungslosen Reize ergab bemerkenswerte Potentialunterschiede.
Die sinnvollen Zahlenreize lösten bei allen Personen Reizantworten
mit weit größeren Amplituden und einem etwas anderen Verlauf
aus. Daß dieses Ergebnis kein Artefakt aufgrund von Augenbewegungen
ist, wurde durch die Registrierung und Auswertung des Elektrookulogramms
(siehe Seite 137) gesichert." S. 141: "Bei einer Diskrepanz von objektiver
und subjektiver Wirklichkeit sind also bestimmte Komponenten des akustischen
Poten[>141]tials Abbild des GG141e1Erlebens
und können als biologisches Korrelat der psychischen Prozesse angesehen
werden - ein Befund, der auch in einer Kontrolluntersuchung bestätigt
werden konnte. "
- Fundstellenkürzel erleben, erlebt(e,en,es)
- Beziehungen zwischen dem evozierten Potential und dem GG136e1Erleben herzustellen, da aus der Reizabhängigkeit eines
- Reiz-Erregungs-Gesetze auch als GG136e2Reiz-Erlebens-Gesetze betrachtet werden dürfen. Ob bestimmte Komponenten des
- verschiedenen Empfindungen führen, oder aber unterschiedliche Reize als gleich GG136e3erlebt werden. Einer der ersten, die zeigen
- gleicher Reizintensität das Potential größer als in Fällen, in denen der Reiz weniger wichtig ist und nur «peripher» GG136e5erlebt
- Blitzen vor dunklem Hintergrund: Die Potentialamplitude folgt also dem Helligkeitskontrast - genau wie das GG138e1Erleben.
- Gegenüberstellung von Potentialverlauf und GG140e1Erleben gestattet (Guttmann 1968b, 1969): Bietet man längere Zeit hindurch
- von objektiv gleich lauten Clicks auf ihre Intensität zu beurteilen und nach jedem Reiz anzugeben, ob er «gleich» GG140e3erlebt
- GG140e4erlebten Reize denen gegenübergestellt wurden, die durch gleich bzw. lauter empfundene Clicks evoziert worden waren,
- gemessene Potentialgröße S-S II, war bei den «leiser» GG140e5erlebten Reizen am kleinsten, stieg in der Kategorie «gleich» um
- akustischen Poten[>141]tials Abbild des GG141e1Erlebens und können als biologisches Korrelat der psychischen Prozesse
- Abb. 54: Der Zusammenhang zwischen evoziertem Potential und GG141e2Erleben: Potentialunterschiede bei
- objektiv gleichbleibenden, aber unterschiedlich laut GG141e3erlebten Clicks.
- zunehmenden Verflachung seines Verlaufs. Diese Veränderung steht in Einklang mit der GG136E1erlebnismäßigen Habituation
- Veränderungen der evozierten Potentiale aufireten, die dem im GG138E1Erlebnisbereich als Maskierung bekannten Phänomen
- GG138E2erlebnismäßig beobachtbaren Erscheinungen entsprechen auch die Potentialverläufe, Die intensitätsabhängige
- nachfolgen ließ - obgleich GG139E3erlebnismäßig deutliche Helligkeitsveränderungen zu beobachten waren. Die Autoren
- Ein weiteres Ergebnis zur GG139E4Erlebnisabhängigkeit des evozierten Poten[>140]tials erbrachte ein Experiment von
- Ich selbst habe die GG140E1Erlebnisabhängigkeit des evozierten Potentials durch eine Versuchsanordnung zu überprüfen
Fundstellenkürzel Erlebnis
Ende der
Zusammenfassung
Kontext-Fundstellenmarkierungen-Abschnitt-3.3.2 (vollständige Textwiedergabe)
Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse. * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis
e:=erleben , erlebt 12 (ohne Überschrift); E:= Erlebnis... 6
136: "3.3.2 Evoziertes Potential und Erleben
Für die Neuropsychologie sind diejenigen Experimente von besonderer
Bedeutung, in denen versucht wird, unmittelbare Beziehungen zwischen dem
evozierten Potential und dem GG136e1Erleben
herzustellen, da aus der Reizabhängigkeit eines Potentials noch nichts
über seine Rolle als Korrelat von Bewußtseinsprozessen ausgesagt
werden kann. Wohl sind unsere Wahrnehmungen weitgehend von den Reizen der
Umwelt bestimmt, doch ist diese Abhängigkeit keineswegs so streng,
daß Reiz-Erregungs-Gesetze auch als GG136e2Reiz-Erlebens-Gesetze
betrachtet werden dürfen. Ob bestimmte Komponenten des evozierten
Potentials als Korrelat von Bewußtseinsprozessen angesehen werden
können, kann nur die Analyse von Situationen zeigen, in denen eine
Diskrepanz zwischen objektiver und subjektiver Wirklichkeit besteht, in
denen also gleiche Reize zu verschiedenen Empfindungen führen, oder
aber unterschiedliche Reize als gleich GG136e3erlebt
werden. Einer der ersten, die zeigen konnten, daß gleichbleibende
Reize verschiedene kortikale Antworten evozieren, je nachdem auf welche
«inneren» Zustandsbedingungen sie treffen, war Hernändez-Peön
(1960). Wird ein gleichbleibender Reiz längere Zeit hindurch repetitiv
in monotoner Folge dargeboten, so verkleinern sich alle Komponenten des
evozierten Potentials und es kommt zu einer zunehmenden Verflachung seines
Verlaufs. Diese Veränderung steht in Einklang mit der GG136E1erlebnismäßigen
Habituation. Der monoton und gleichförmig ablaufende
Reiz «verschwindet» auch aus dem bewußten
GG136e4Erleben
- genau wie das evozierte Potential. Auch wenn ein Reiz besonders beachtet
wird und im Mittelpunkt des Interesses steht, ist bei gleicher Reizintensität
das Potential größer als in Fällen, in denen der Reiz weniger
wichtig ist und nur «peripher» GG136e5erlebt
wird. Eines der ältesten Experimente war ein realitätsnaher Versuch
von Hernändez-Peön, in dem eine Katze während einer fortlaufenden
akustischen Reizung für eine Weile durch eine Maus abgelenkt wurde,
die man in den Versuchskäfig setzte. Die akustischen Reizantworten
hatten in diesem Zeitraum wesentlich kleinere Amplituden als vor- und nachher.
Ein ähnliches Phänomen konnten Spong, Haider und Lindsley (1965)
auch am Menschen nachweisen. Die Versuchspersonen wurden gleichzeitig optisch
und akustisch stimuliert und sollten instruktionsgemäß ihre
Aufmerksamkeit einmal den Blitzen, das andere Mal den Clicks zuwenden.
Die Potentiale der jeweils beachteten Reizdimension waren
Abb. 53. Die Abhängigkeit der Potentialkomponente NI des Geschmackspotentials von der Reizintensität bei Stimulation der Zunge mit Rechteckimpulsen von 2 msec Dauer und einer Frequenz von 200 Hz. Mittelung von je 40 Reizantworten. (Aus: Plattig 1968.) > [137]
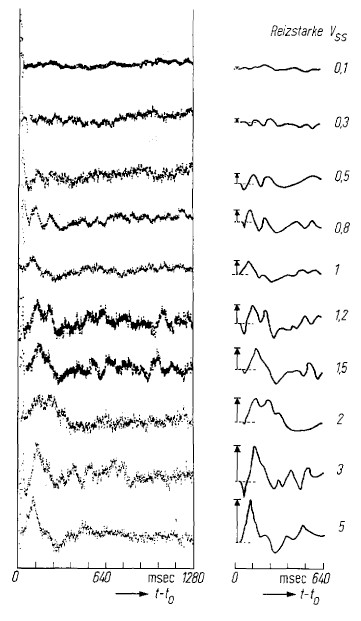
[>138]
durchwegs beträchtlich größer als die der unbeachteten.
Eine ähnliche Veränderung fanden Haider et al. 1964 und Haider
(1967), immer dann, wenn in einer konstanten Reizfolge ein Reiz als «unerwarteter»
Stimulus eingeschaltet wurde. Die Potentialamplitude des interpolierten
Reizes war merklich größer als die der vorausgehenden und nachfolgenden
gleichförmigen Reize. Auch Garcia-Ausst (1963) konnte zeigen, daß
die Amplituden des akustisch evozierten Potentials bei Aufmerksamkeitszuwendungen
steigen, bei Ablenkung hingegen sinken.
Im optischen Bereich fanden White und Eason (1966),
daß die Größe des evozierten Potentials nicht allein von
der Intensität des Blitzreizes, sondern auch von der Umfeldbeleuchtung
abhängig ist. Durch Intensitätsänderungen der Umfeldbeleuchtung
und der auf ein räumlich kleines Gebiet beschränkten Blitzreize
konnten evozierte Potentiale bei unterschiedlichen Helligkeitsdifferenzen
zwischen Reiz und Hintergrund untersucht werden. Es zeigte sich, daß
das optische Potential die größte Amplitude besitzt, wenn der
Hintergrund dunkel, der Blitz jedoch hell ist. Ist der Kontrast gering,
erhält man kleine Potentiale, also auch dann, wenn sowohl der Hintergrund
wie auch der Blitz sehr hell sind. Die Potential- amplituden sind in diesem
Fall nicht größer, als bei sehr schwachen Blitzen vor dunklem
Hintergrund: Die Potentialamplitude folgt also dem Helligkeitskontrast
- genau wie das GG138e1Erleben.
Harter und White (1967) versuchten Übereinstimmungen zwischen dem
Potential verlauf und dem Erleben zu untersuchen, indem sie Versuchspersonen
mit kurzen Folgen von Lichtblitzen stimulierten und für jede der verschiedenen
Reizfrequenzen angeben ließen, wie viele aufeinanderfolgende Blitze
wahrgenommen wurden. Die geschätzte Zahl - die immer weit unter der
wahren Häufigkeit der Lichtblitze lag - zeichnete sich im Verlauf
der Potentiale ab und stimmte mit der Anzahl der deutlich abgehobenen negativen
Potential- komponenten überein. Donchin et al. (1963) konnten zeigen,
daß bei Darbietung von Doppelblitzen Veränderungen der evozierten
Potentiale aufireten, die dem im GG138E1Erlebnisbereich
als Maskierung bekannten Phänomen entsprechen: Bei einem sehr kurzen
Zeitintervall zwischen den beiden Reizen wird nur ein einziger Blitz wahrgenommen,
bei einem etwas größeren zeitlichen Abstand scheint der erste
Blitz des Paares wesentlich heller zu sein als der zweite. Diesen GG138E2erlebnismäßig
beobachtbaren Erscheinungen entsprechen auch die Potentialverläufe,
Die intensitätsabhängige Potentialamplitude der ersten Lichtblitzantwort
nimmt zu, wenn das Intervall verkleinert wird; werden die Blitze in so
kurzem Abstand geboten, daß sie wahrnehmungsmäßig verschmelzen,
gehen auch die Potentiale ineinander über. Von einer anderen Wahrnehmungstäuschung,
die der Maskierung überaus ähnlich ist, wurden hingegen zunächst
ab [>139] weichende Ergebnisse berichtet: Bietet man nacheinander
zwei gleich starke Lichtreize, die nicht auf dieselben Netzhautstellen
fallen, sondern auf zwei verschiedene aber eng benachbarte Regionen (verwendet
man also z. B. als ersten Reiz einen Kreis, als zweiten einen an die Kontur
des ersten anschließenden Kreisring), erscheint die Helligkeit des
ersten Reizes merklich herabgesetzt, wenn der zweite Reiz 40-100 msec nach
Ende des ersten geboten wird. Dieses Phänomen wird Metakontrast genannt.
Schiller und Chorover (1966) fanden, daß die
Amplituden und Latenzen der Potentiale, die vom ersten der beiden Lichtreize
evoziert wurden, gleich blieben, wenn man nur den ersten Reiz allein bot
oder aber in verschiedenen Zeitintervallen den zweiten nachfolgen ließ
- obgleich GG139E3erlebnismäßig
deutliche Helligkeitsveränderungen zu beobachten waren. Die Autoren
kommen zum Schluß, daß beim Metakontrast die untersuchten Potentialkomponenten
mit der objektiven Stimulusintensität und nicht mit der GG139e1erlebten
Reizstärke korrelieren. Freilich erlauben diese Ergebnisse auch andere
Interpretationen, da die Darbietung eines zweiten Reizes nach 60-120 msec
den Verlauf des ersten Potentials, bei dem zu diesem Zeitpunkt gerade die
intensitätsabhängigen Hauptkomponenten auf treten, in schwer
abschätzbarer Weise beeinflußt. In einer späteren Arbeit
konnte zudem gezeigt werden, daß auch beim Metakontrast die zu erwartende
Übereinstimmung zwischen der Potentialamplitude und der subjektiven
Helligkeit beobachtet werden kann, wenn die Reize auf das Gebiet der Fovea
centralis beschränkt werden. Erst unter dem Einfluß von Streulicht
aus parafovealen Regionen verändert sich der Potential verlauf in
der oben beschriebenen Weise (Vaughan und Silverstein 1968). Auch der Bedeutungsgehalt
und die emotionale Tönung des Reizmaterials wirken sich auf den Potentialverlauf
aus: Lifshitz (1966) bot Bilder mit indifferentem, abstoßendem und
anziehendem Inhalt, und zwar mit scharfer und unscharfer Einstellung des
Projektionssystems. Dadurch. wird bei geringfügigen Veränderungen
der physikalischen Eigenschaften der sinnvolle Reiz zu einem sinnfreien
Stimulus. Die evozierten Potentiale unterschieden sich nicht nur unter
diesen beiden Darbietungsbedingungen, sondern zeigten - zumindest bei einigen
Versuchspersonen - auch charakteristische Unterschiede, wenn nach den drei
affektiven Kategorien getrennt ausgewertet wurde. Sogar «subliminale»
Reizunterschiede, die den Versuchspersonen gar nicht bewußt waren
(ihr Einfluß konnte in anschließenden Assoziationsversuchen
gesichert werden), scheinen imstande zu sein, charakteristische Potentialveränderungen
auszulösen (Shevrin und Fritzler 1968).
Ein weiteres Ergebnis zur GG139E4Erlebnisabhängigkeit
des evozierten Poten[>140]tials erbrachte ein Experiment von Chapman
und Bragdon (1964), in dem die Versuchspersonen einfache Aufgaben zu lösen
hatten, wobei optisch dargebotene Ziffern beachtet werden mußten.
Zwischen diesen «sinnvollen» Reizen wurden bedeutungslose Reize
von gleicher Helligkeit und Dauer eingeschaltet. Eine getrennte Analyse
der bedeutsamen und bedeutungslosen Reize ergab bemerkenswerte Potentialunterschiede.
Die sinnvollen Zahlenreize lösten bei allen Personen Reizantworten
mit weit größeren Amplituden und einem etwas anderen Verlauf
aus. Daß dieses Ergebnis kein Artefakt aufgrund von Augenbewegungen
ist, wurde durch die Registrierung und Auswertung des Elektrookulogramms
(siehe Seite 137) gesichert. Auch Veränderungen des Aktiviertheitsniveaus
halten die Autoren für unwahrscheinlich, obgleich die Deutung der
Ergebnisse in dieser Richtung naheliegend erscheint. Ähnliche Veränderungen
der Potentialgestalt in Abhängigkeit vom Bedeutungsgehalt des Reizes
berichten Sutton et al. (1967), Cohen und Walter (1966).
Ich selbst habe die GG140E1Erlebnisabhängigkeit
des evozierten Potentials durch eine Versuchsanordnung zu überprüfen
versucht, die auf einer in der Psychologie schon lange bekannten Diskrepanzsituation
beruht und eine unmittelbare Gegenüberstellung von Potentialverlauf
und GG140e1Erleben gestattet
(Guttmann 1968b, 1969): Bietet man längere Zeit hindurch objektiv
gleichbleibende Töne, so werden diese bisweilen unterschiedlich laut
GG140e2erlebt
und scheinen manchmal leiser, manchmal lauter zu sein. Darauf beruht der
folgende Versuchsplan: Den Versuchspersonen wurde die Aufgabe gestellt,
eine Serie von objektiv gleich lauten Clicks auf ihre Intensität zu
beurteilen und nach jedem Reiz anzugeben, ob er «gleich»
GG140e3erlebt
wurde, wie die meisten anderen oder «lauter» bzw. «leiser».
Allen Versuchspersonen erschienen einige der objektiv gleichbleibenden
Reize leiser, andere hingegen lauter. Eine selektive Analyse, in welcher
für jede Person die Potentiale der leiser GG140e4erlebten
Reize denen gegenübergestellt wurden, die durch gleich bzw. lauter
empfundene Clicks evoziert worden waren, erbrachte beträchtliche,
statistisch gesicherte Unterschiede. Bestimmte Potentialkomponenten veränderten
sich mit den subjektiven. Intensitätsunterschieden, nämlich die
Amplituden der ersten negativen und der zweiten positiven Welle, von denen
aus anderen Arbeiten bekannt ist, daß sie mit den objektiven Intensitätsunterschieden
korrelieren. Ihre Summe, die von Spitze zu Spitze gemessene Potentialgröße
S-S II, war bei den «leiser» GG140e5erlebten
Reizen am kleinsten, stieg in der Kategorie «gleich» um durchschnittlich
14 % an und erreichte für die «lauter» klassifizierten
Reize mit einer Zunahme um insgesamt 35 o/o ihren höchsten Wert (Abb.
54). Bei einer Diskrepanz von objektiver und subjektiver Wirklichkeit sind
also bestimmte Komponenten des akustischen Poten[>141]tials Abbild
des GG141e1Erlebens
und können als biologisches Korrelat der psychischen Prozesse angesehen
werden - ein Befund, der auch in einer Kontrolluntersuchung bestätigt
werden konnte. Die Frage, ob das sensorisch evozierte Potential über
die objektiven Sinnestüchtigkeitsprüfungen hinaus auf differential
psychologische Bedeutung besitzen könnte, d. h. ob sich Eigenheiten
im Potentialverlauf feststellen lassen, die mit irgendwelchen wahrnehmungsbezogenen
Leistungs- oder Persönlichkeitsmerkmalen korrelieren, ist bisher erst
unzureichend untersucht worden. Einige noch unsichere Hinweise deuten auf
einen Zusammenhang zwischen der Potentialstabilität (der intraindividuellen
Konstanz eines Potentialverlaufs) und der Aufmerksamkeitsleistung
einer Person (Guttmann 1971). Die Bestätigung solcher Beziehungen
würde ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet erschließen: Jede
psychologische Untersuchung mit Hilfe der traditionellen Testmethoden kann
nur über Vermittlung eines Leistungsverhaltens erfolgen; die Versuchsperson
muß kooperativ eine mehr oder minder schwierige Aufgabensituation
bewältigen, durch die erst die eigentlich interessierenden Variablen
erfaßt werden können. Dabei ist unvermeidbar, daß sich
auch zahlreiche Störfaktoren, wie Motivation, Kooperationsbereitschaft
usw. aus wirken. Wäre es möglich, eine individuelle Fähigkeit
nicht über Vermittlung eines Leistungsverhaltens, sondern durch unmittelbare
Beobachtung der zugehörigen hirnelektrischen Korrelate zu erfassen,
könnte man auf diese Weise analog zur objektiven Sinnestüchtigkeitsprüfung
eine «objektive Psychodiagnostik» betreiben. Die Frage, ob
die sensorisch evozierten Potentiale im Rahmen einer differentiellen Neuropsychologie
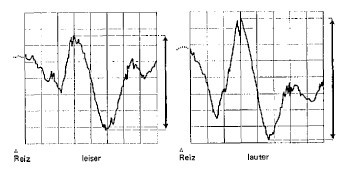
Abb. 54: Der Zusammenhang zwischen evoziertem Potential und GG141e2Erleben: Potentialunterschiede bei objektiv gleichbleibenden, aber unterschiedlich laut GG141e3erlebten Clicks.
[>142] von Bedeutung sein dürften, wird jedoch erst nach eingehenderen
empirischen Untersuchungen entschieden werden können.
Zwischen der Beobachtung der Aktivität von
einzelnen kortikalen Neuronen und der für die Neuropsychologie so
bedeutsamen Untersuchung von sensorisch evozierten Potentialen, in welchen
die Erregungsaktivität einer großen Zahl von Nervenzellen
zum Ausdruck kommt, besteht nach wie vor eine weite Kluft. Es ist zu hoffen,
daß dieser große Sprung im Komplexitätsniveau der Beobachtungen
nur quantitativer Natur ist. Diese Ansicht wird durch eine Arbeit von Fields
gestützt, in der die Größe und die Gestalt von optischen
Reizen variiert und an der Ratte Reizantworten von verschiedenen Ableitstellen
registriert wurden. Dabei konnten ortsgebundene Verlaufsänderungen
des optisch evozierten Potentials gefunden werden, die ausschließlich
mit einem bestimmten Reizaspekt korrelierten: In medialen Kortexregionen
veränderte sich der Potentialverlauf nur, wenn die Größe
der Reize variiert wurde, blieb aber bei verschiedener Reizgestalt gleich.
Potentiale von lateralen Kortexregionen änderten sich hingegen nicht
mit der Große, wohl aber mit der Gestalt der Reize (Fields 1969).
Dieser Befund scheint dafür zu sprechen, daß das veränderte
Verlaufsmuster der sensorisch evozierten Potentiale bei Reizunterschieden
gleichfalls Ausdruck der Tatsache ist, daß durch abweichende Reizeigenheiten
unterschiedliche kortikale Funktionseinheiten aktiviert werden - also auch
im evozierten Potential das Prinzip der Erregungsverzweigung zu spezifischen
Endstellen zum Ausdruck kommt, freilich als Aktivitätsmittelwert über
eine große Anzahl von nervösen Elementen. Der im sensorisch
evozierten Potential zum Ausdruck kommende «Mittelwert» der
Erregungsaktivität
eines ausgedehnteren Rindenbezirks wird für bestimmte Fragestellungen
jedoch der Beobachtung von kleineren Regionen oder gar von einzelnen Nervenzellen
vorzuziehen sein und psychologisch sinnvollere und angemessenere Kennwerte
liefern können.
Als Aktivitätskorrelat der Wahrnehmung besitzen
die sensorisch evozierten Potentiale allein aufgrund der Tatsache, daß
sie von der unversehrten Kopfhaut ohne Beeinträchtigung der Versuchsperson
registriert werden können, für die neuropsychologische Forschung
gegenwärtig jedenfalls die weitaus größte Bedeutung."
Literatur (Auswahl)
- Guttmann, Giselher (1972) Einführung in die Neuropsychologie. Bern: Huber.
Links(Auswahl: beachte)
Glossar, Anmerkungen und Endnoten:
GIPT= General and Integrative Psychotherapy, internationale Bezeichnung für Allgemeine und Integrative Psychotherapie.
___
Standort: Erleben und Erlebnis in Giselher Guttmanns Einführung in die Neuropsychologie.
*
Haupt- und Verteilerseite Die Erforschung des Erlebens und der Erlebnisse
Zur Methode der Fundstellen-Textanalyse. * Hauptbedeutungen Erleben und Erlebnis
*
| Suchen in der IP-GIPT,
z.B. mit Hilfe von "google": <suchbegriff>
site:www.sgipt.org
z.B. Inhaltsverzeichnis site:www.sgipt.org. |
Dienstleistungs-Info.
*
Sponsel, Rudolf (DAS). Erleben und Erlebnis in Giselher Guttmanns Einführung in die Neuropsychologie. IP-GIPT. Erlangen: https://www.sgipt.org/gipt/erleben/GuttmannG.htm
Copyright & Nutzungsrechte
Diese Seite darf von jeder/m in nicht-kommerziellen
Verwertungen frei aber nur original bearbeitet und nicht inhaltlich
verändert und nur bei vollständiger Angabe der Zitierungs-Quelle
benutzt werden. Das direkte, zugriffsaneignende Einbinden in fremde Seiten
oder Rahmen ist nicht gestattet, Links und Zitate sind natürlich willkommen.
Sofern die Rechte anderer berührt sind, sind diese dort zu erkunden.
Sollten wir die Rechte anderer unberechtigt genutzt haben, bitten wir um
Mitteilung. Soweit es um (längere) Zitate aus ... geht,
sind die Rechte bei/m ... zu erkunden oder eine Erlaubnis einzuholen.
korrigiert:
Änderungen wird gelegentlich überarbeitet, ergänzt und vertieft * Anregungen und Kritik willkommen
17.12.22 Aufbereitet, ausgewertet, ins Netz.
16.12.22 Angelegt